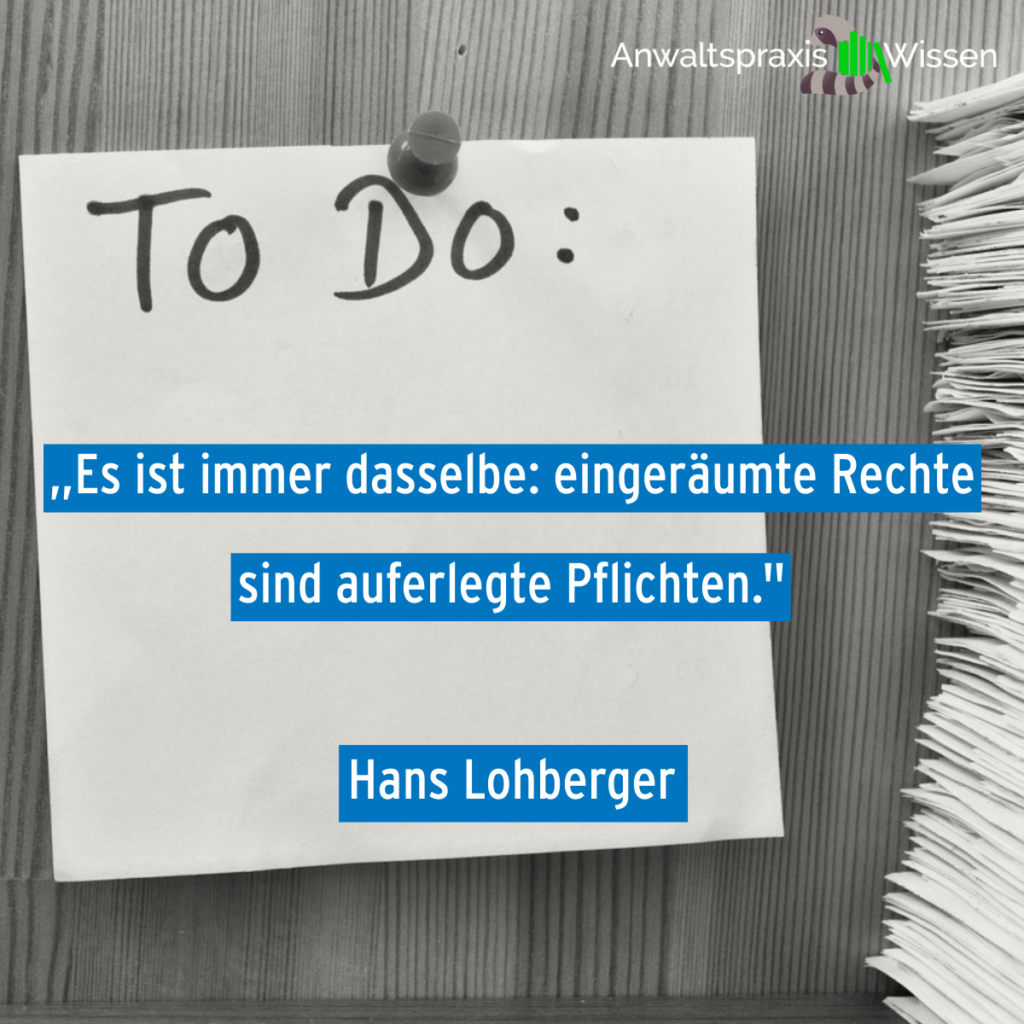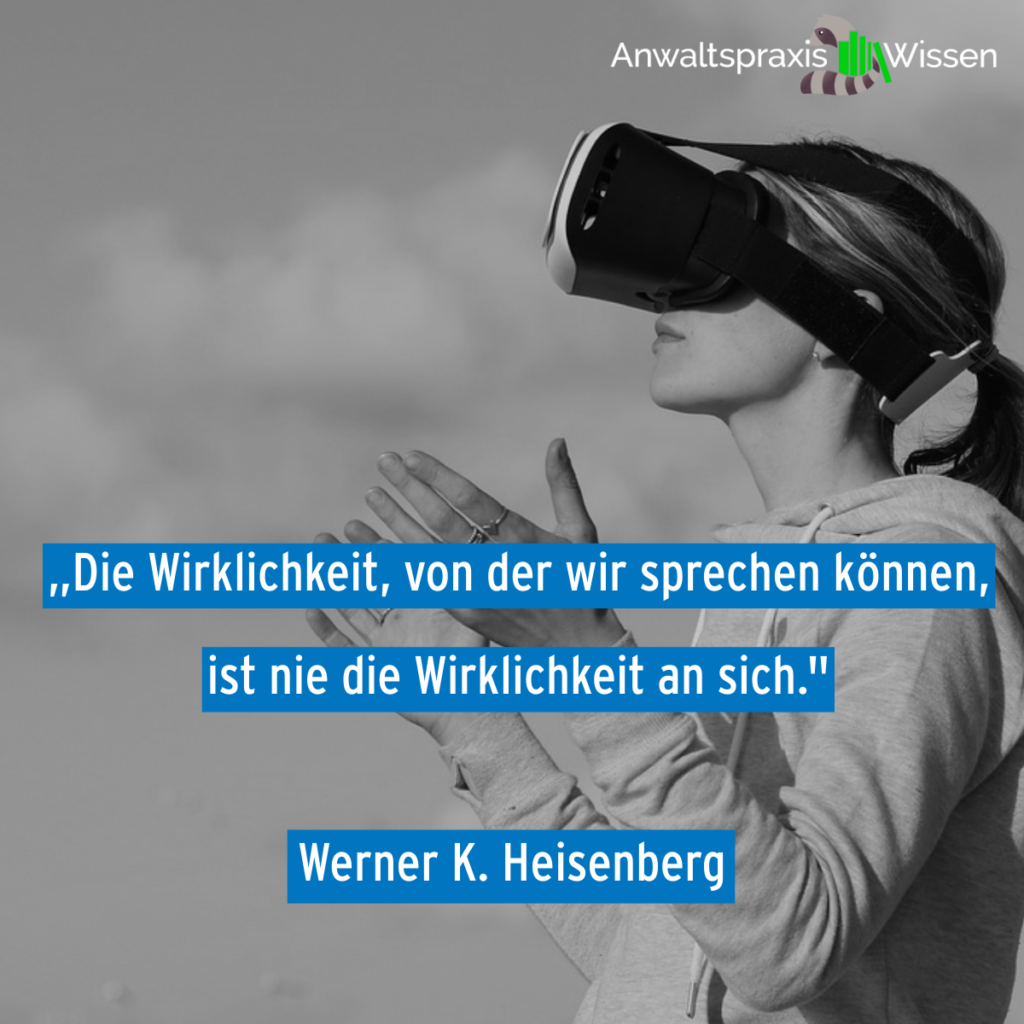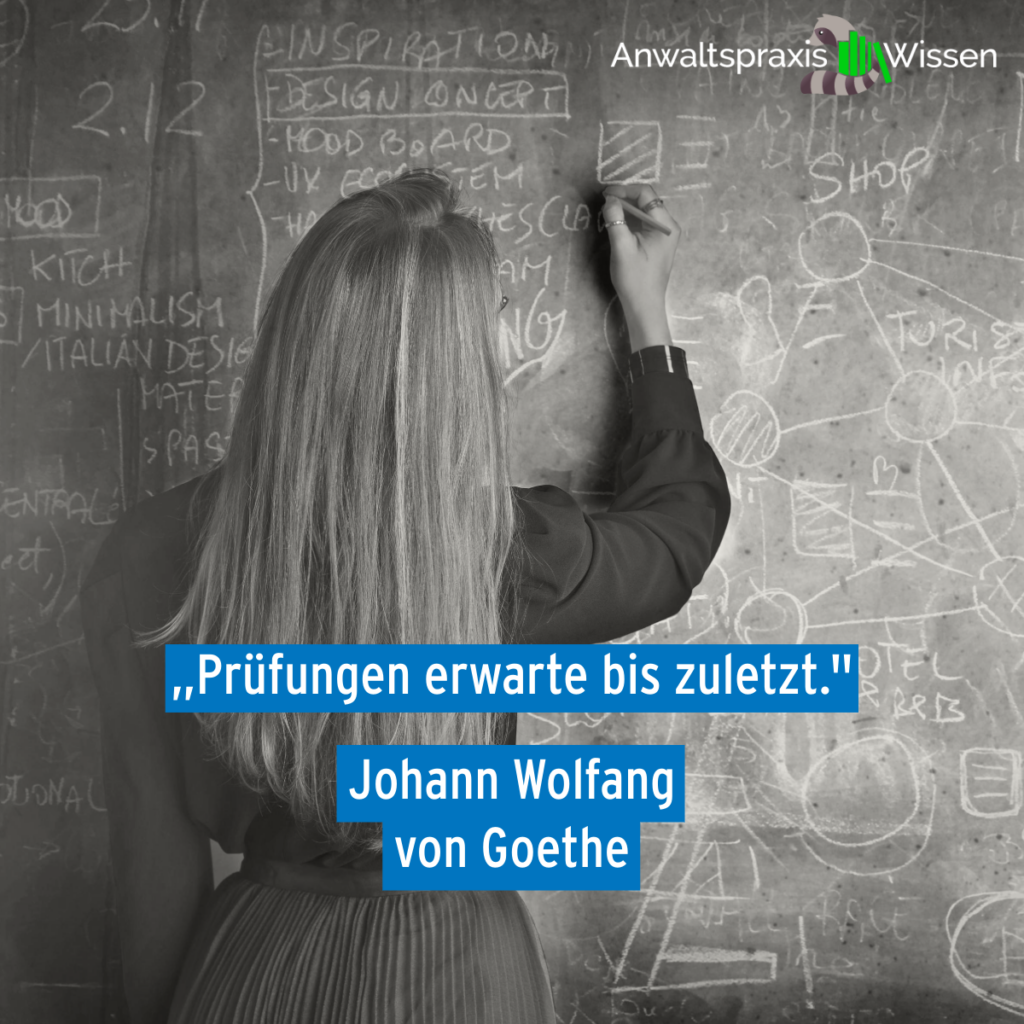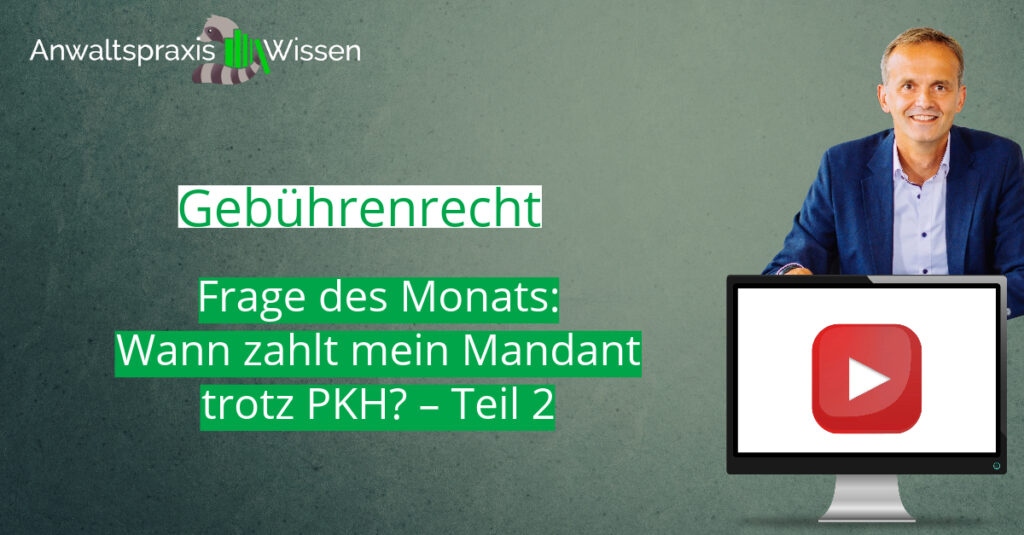Einführung
Mit dem voraussichtlich am 1.10.2023 in Kraft tretenden „Gesetz zur Überarbeitung des Sanktionenrechts – Ersatzfreiheitsstrafe, Strafzumessung, Auflagen und Weisungen sowie Unterbringung in einer Entziehungsanstalt“ hat der Gesetzgeber die in § 64 StGB geregelten Voraussetzungen für die Anordnung der Unterbringung des Angeklagten in einer Entziehungsanstalt in mehrfacher Hinsicht verschärft und überdies die in § 67 Abs. 5 S. 1 a.F. noch gegebene Möglichkeit, im Falle eines erfolgreichen Therapieabschlusses bereits nach Verbüßung der Hälfte der ausgeurteilten Strafe eine Reststrafenaussetzung zur Bewährung zu erhalten, massiv eingeschränkt bzw. für die allermeisten Verurteilten praktisch abgeschafft.
Diese Neuregelung, die in Ermangelung einer anderweitigen gesetzlichen Bestimmung gem. § 2 Abs. 6 StGB auch für bereits laufende Verfahren gelten wird, wird sich auf die Strafrechtspraxis in erheblichem Maße auswirken, hat die Unterbringung nach § 64 StGB für den Angeklagten durch die Reform doch erheblich an Attraktivität verloren. Dies wiederum hat zur Folge, dass bei der Festlegung der Verteidigungsstrategie künftig verstärkt geprüft werden muss, ob eine Unterbringung überhaupt noch angestrebt werden soll oder ob es – insbesondere im Hinblick auf die Folgen eines etwaigen Scheiterns der Therapie – den Interessen des Mandanten im Gegenteil nicht eher entspricht, eine solche zu verhindern.
Zudem schränkt der grundsätzliche Wegfall der Halbstrafenaussetzung den Spielraum bei Verständigungsgesprächen nach § 257c StPO ein: Zwar ist eine Verständigung über die Maßregel seit jeher unzulässig, aber eine im Raum stehende Freiheitsstrafe von z.B. sechs Jahren hat in der Vergangenheit für viele Angeklagte doch einiges an Schrecken verloren, wenn über § 64 StGB die Möglichkeit bestand, nach einem dank Anrechnung der U-Haft eher kurzen Vorwegvollzug alsbald in die Therapieeinrichtung wechseln zu können und von dort aus schon nach der Hälfte der Strafzeit entlassen zu werden. Diesen „Trost“ gibt es nun nicht mehr.
Die nachfolgenden Ausführungen zeigen die Beweggründe des Gesetzgebers für die Reform auf und geben einen ersten Überblick über die Neuregelungen.
Die Beweggründe des Gesetzgebers
Insbesondere die teils sehr weite Auslegung des § 64 StGB a.F. durch den BGH hat dazu geführt, dass die Zahl der Unterbringungen in einer Entziehungsanstalt über viele Jahre hinweg massiv angestiegen ist, von 2002 bis 2020 hat sie sich deutlich mehr als verdoppelt. Auch die Zahl der jährlichen Aburteilungen mit Unterbringung in der Entziehungsanstalt hat erheblich zugenommen, sie stieg von 1.812 im Jahr 2007 auf 3.317 im Jahr 2019 (BT-Drucks 20/5913, S. 22). Durch diese Entwicklung sind in nahezu allen Bundesländern die Maßregeleinrichtungen stark unter Druck geraten. Es kam zu erheblichen Überbelegungen (BT-Drucks 20/5913, S. 27) sowie immer wieder auch zu Entlassungen aus der sog. Organisationshaft, weil es den Vollstreckungsbehörden nicht gelungen war, innerhalb eines akzeptablen Zeitraums einen Therapieplatz zur Verfügung zu stellen. Allein in Baden-Württemberg mussten im Jahr 2022 nach Auskunft des dortigen Sozialministeriums 34 Verurteilte entlassen werden. Aber auch in anderen Bundesländern mussten immer wieder die Gerichte eingreifen, weil die Wartezeiten auf einen Therapieplatz ein unzumutbares Ausmaß erreicht hatten (s. z.B. OLG Bremen, Beschl. v. 29.11.2022 – 1 Ws 136/22; OLG Frankfurt/Main, Beschl. v. 14.4.2022 – 7 Ws 51/22; OLG Naumburg, Beschl. v. 25.10.2021 – 1 Ws (s) 325/21, NStZ-RR 2022, 159 m. Anm. Bode). Hierdurch haben sich in nicht wenigen Fällen die Chancen auf einen erfolgreichen Abschluss der Therapie noch vor deren Beginn erheblich verschlechtert, ist die Rückkehr eines suchtkranken Verurteilten in sein früheres Umfeld, und sei es auch nur vorübergehend, im Hinblick auf den Behandlungserfolg doch ersichtlich kontraproduktiv. Zudem sind aufgrund der vielen Unterbringungen auch die Kosten für den Maßregelvollzug stark angestiegen, was dann neben den Überbelegungen nicht unerheblich dazu beigetragen hat, dass die Rufe nach einer Reform vor allem aus den Ländern kontinuierlich lauter und schließlich erhört wurden.
Darüber hinaus wurde der Reformbedarf auch damit begründet, dass sich die Struktur der im Maßregelvollzug untergebrachten Klientel verändert habe; den Kliniken würden in nicht unerheblichem Umfang Patienten zugewiesen, bei denen keine eindeutige Abhängigkeitserkrankung vorliege. Dass diese Einschätzung plausibel ist, legt schon der Umstand nahe, dass sich der Anteil der voll schuldfähigen Verurteilten in der Zeit von 1995 bis 2017 von 20 % auf 59,8 % beinahe verdreifacht hat (BT-Drucks 20/5913, S. 23). Auch konnte man sich nicht länger dem Argument verschließen, dass die in § 67 Abs. 5 StGB a.F. vorgesehene Möglichkeit, bereits zum Halbstrafenzeitpunkt in den Genuss einer Reststrafenaussetzung zur Bewährung zu kommen, häufig einen sachwidrigen Anreiz für eine Unterbringung in der Entziehungsanstalt darstellte, war eine solche Entlassung bislang doch wesentlich leichter zu erreichen als im „normalen“ Strafvollzug, wo nur etwa 1,6 % der Verurteilten in den Genuss einer solchen frühzeitigen Entlassung kommen (MüKo-StGB/Groß/Kett-Straub, 4. Aufl., § 57 Rn 6).
Gesetzt hat diesen Anreiz allen voran der BGH: Dessen sehr weite Auslegung vor allem des Hangbegriffs i.S.d. § 64 StGB, von van Gemmeren (MüKo-StGB, 4. Aufl., § 64 Rn 23) als „nahezu uferlos“ kritisiert, hat ganz maßgeblich zum starken Anstieg der Fallzahlen beigetragen (zur Rechtsprechung des BGH Hillenbrand, StRR 12/2022, 6 und ZAP F .22, 1029), zumal alle Senate ihren ausgesprochen unterbringungsfreundlichen Kurs gegenüber den Instanzgerichten mit großem Nachdruck durchgesetzt haben. Es wurden vor allem in den letzten Jahren oftmals Urteile aufgehoben, in denen die Unterbringung unterblieben war, wohingegen deren Anordnung umgekehrt kaum einmal beanstandet wurde.
All dies hat den Gesetzgeber letztlich dazu bewogen, der dargestellten Entwicklung durch mehrere Neuregelungen mit dem Ziel entgegenzuwirken, den Anstieg der Fallzahlen möglichst zu bremsen oder zumindest abzumildern (BT-Drucks 20/5913, S. 43).
Die Änderungen im Einzelnen
1. In Umsetzung dieses Vorhabens wurde zunächst der Begriff des Hangs enger gefasst. War der Hang nach der Rechtsprechung des BGH bislang definiert als eingewurzelte, auf psychische Disposition zurückgehende oder durch Übung erworbene Neigung, immer wieder Rauschmittel zu konsumieren (so z.B. BGH, Beschl. v. 8.2.2022 – 6 StR 11/22), kann ein Hang nach § 64 StGB n.F. nunmehr erst dann bejaht werden, wenn der Angeklagte an einer Substanzkonsumstörung leidet, infolge derer eine dauernde und schwerwiegende Beeinträchtigung der Lebensgestaltung, der Gesundheit, der Arbeits- oder der Leistungsfähigkeit eingetreten ist und fortdauert. Ziel dieser Änderung ist es, die Anordnungsvoraussetzung des Hangs stärker auf Fälle zu beschränken, in denen der Angeklagte tatsächlich der Behandlung in einer Entziehungsanstalt bedarf, und so die Ressourcen des Maßregelvollzugs zielgenauer zu nutzen (BT-Drucks 20/5913, S. 68).
a) Die Aufnahme des Begriffs der Substanzkonsumstörung, die nach Ansicht des Gesetzgebers einen begrifflichen Bezug zur „medizinischen Welt“ herstellen soll (BT-Drucks 20/5913, S. 44), verfolgt das Ziel, den Hang auf bestimmte medizinisch definierte Kategorien schwerer und deshalb behandlungsbedürftiger Formen des übermäßigen Konsums berauschender Mittel zu begrenzen und so die Therapieanordnung enger an den Therapiebedarf zu koppeln. Erfasst werden substanzbezogene Abhängigkeitserkrankungen (ICD-10-GM F10 bis F19, Erweiterung .2: „Abhängigkeitssyndrom“) und schwere Formen des „schädlichen Gebrauchs“ (ICD-10-GM F10 bis F19, Erweiterung .1: „Schädlicher Gebrauch“) bzw. – nach der Terminologie des ICD-11 – Fälle eines „Schädlichen Gebrauchsmusters“ (ICD-11 6C40 ff., Erweiterung .1: „Harmful pattern of use“).
Allerdings sollen nicht die jeweils geltenden Definitionen eines Krankheitsbildes in Klassifikationssystemen wie ICD-10 und ICD-11 unmittelbar ins Gesetz übertragen und dessen Auslegung vom Inhalt und von den Wandlungen solcher Systeme abhängig gemacht werden. Stattdessen handelt es sich um einen eigenständigen Rechtsbegriff, durch dessen Einführung die zunehmend zu beobachtenden Einweisungen von Drogendealern vermieden werden sollen, bei denen der Betäubungsmittelkonsum zwar Teil des Lebensstils ist, aber nicht den Schweregrad erreicht, der tatsächlich eine Behandlung und Unterbringung in einer Entziehungsanstalt erfordert (BT-Drucks 20/5913 a.a.O.).
Allerdings muss sich der Substanzmissbrauch noch nicht zu einer Abhängigkeit verfestigt haben, sodass insbesondere auch bei Jugendlichen und Heranwachsenden ein therapeutisches Eingreifen schon in einem Entwicklungsstadium des Substanzkonsums möglich ist, in dem der Behandlungsaufwand geringer ist und die Erfolgsaussichten größer sind als bei einer bereits ausgebildeten Abhängigkeitserkrankung (BT-Drucks 20/5913 a.a.O.).
Demgegenüber reichen der „einfache“ schädliche Gebrauch oder der „vorübergehende schädliche Gebrauch“ für eine Unterbringung in der Entziehungsanstalt nicht mehr aus (BT-Drucks 20/5913, S. 69). In der Praxis wird deshalb künftig verstärkt darauf geachtet werden müssen, ob eine etwaige Suchtproblematik des Angeklagten bereits zu einer Behandlungsbedürftigkeit geführt hat. Eine solche darf nicht vorschnell unterstellt werden, denn wie bereits nach altem Recht gilt, dass sämtliche Anordnungsvoraussetzungen zur Überzeugung des Tatgerichts sicher feststehen müssen (hierzu BGH, Beschl. v. 23.2.2022 – 6 StR 650/21). Es gibt mithin kein „in dubio pro Unterbringung“.
b) Darüber hinaus ist für die Annahme eines Hangs künftig erforderlich, dass die Substanzkonsumstörung zu einer dauernden und schwerwiegenden Beeinträchtigung der Lebensgestaltung, der Gesundheit, der Arbeits- oder Leistungsfähigkeit geführt hat (BT-Drucks 20/5913, S. 44). Solche Beeinträchtigungen müssen in mindestens einem dieser Bereiche eingetreten sein (BT-Drucks 20/5913, S. 45).
Mit dieser Änderung verfolgt der Gesetzgeber erklärtermaßen das Ziel, die weite Auslegung des Hangs durch den BGH zurückzudrängen. Nach dessen Rechtsprechung genügte es bislang, dass der Täter aufgrund seines Rauschmittelkonsums sozial gefährdet oder gefährlich erschien, was nicht erst dann der Fall war, wenn er Rauschmittel in einem solchen Umfang zu sich nahm, dass seine Gesundheit oder seine Arbeits- und Leistungsfähigkeit erheblich beeinträchtigt waren (BGH, Beschl. v. 16.6.2020 – 1 StR 155/20). Zwar kam derartigen Beeinträchtigungen bei der Prüfung eines Hangs indizielle Bedeutung zu, ihr Fehlen schloss aber den Hang nicht aus (BGH, Beschl. v. 23.2.2022 – 6 StR 15/22). Diese Rechtsprechung ist nunmehr überholt.
Denn das neue Recht setzt zwingend eine dauernde und schwerwiegende Beeinträchtigung in einem der vorgenannten Bereiche voraus; diese muss im Urteil selbstständig festgestellt werden. Damit werden äußere und vor allem überprüfbare Veränderungen in der Lebensführung des Angeklagten maßgeblich für die Unterbringungsanordnung (BT-Drucks 20/5913, S. 69). Dies bedeutet insbesondere, dass der Hang nicht mit dem bloßen Ausmaß des Rauschmittelkonsums bzw. den vom Angeklagten zu sich genommenen Mengen begründet werden darf. Hinzukommen muss vielmehr eine andauernde erhebliche Beeinträchtigung in einem der vorgenannten Lebensbereiche wie beispielsweise der Verlust des Arbeitsplatzes, weil der Angeklagte berauscht zur Arbeit erschienen oder konsumbedingt so unzuverlässig geworden ist, dass das Arbeitsverhältnis beendet werden musste. Hat der Konsum bereits zu gesundheitlichen Problemen geführt, empfiehlt es sich für die Verteidigung, wenn denn eine Unterbringung angestrebt wird, frühzeitig entsprechende Befundberichte vorzulegen, damit Sachverständiger und Gericht über möglichst vollständige Informationen verfügen.
2. Darüber hinaus hat der Gesetzgeber das Kausalitätserfordernis zwischen dem Hang und der Anlasstat verschärft. Anlass hierfür waren insbesondere Klagen aus der forensischen Praxis, wonach den Entziehungsanstalten in nicht unerheblichem Umfang Patienten zugewiesen würden, bei denen keine schwere Suchtmittelkonsumstörung vorliege, sondern eher ein missbräuchlicher Drogenkonsum als Teil eines delinquenten Lebenswandels bzw. einer primär delinquenten Orientierung, bei denen der Drogenhandel auch einträgliche Erwerbsquelle ist und der persönliche Drogenkonsum gegenüber dem Profitinteresse nachrangig erscheint. Die Konsumstörung sei bei diesen Personen nicht die primäre Störung, sondern Begleiterscheinung. Diese Patienten hätten die therapeutische Atmosphäre nachteilig verändert und zudem die Ausbildung therapiefeindlicher Strukturen in den Einrichtungen gefördert (BT-Drucks 20/5913, S. 46).
Als Ursache für diese Entwicklung hat der Gesetzgeber auch hier die Rechtsprechung insbesondere des BGH ausgemacht. Denn hiernach war es für die Annahme des symptomatischen Zusammenhangs zwischen Hang und Tat nicht erforderlich, dass der Hang die alleinige oder überwiegende Ursache für die Tatbegehung war, sondern es genügte, wenn er neben anderen Ursachen zu ihr beigetragen hat (BGH, Beschl. v. 10.2.2022 – 1 StR 396/21; s. auch die Nachw. bei Fischer, StGB, 70. Aufl., § 64 Rn 13).
Nach neuem Recht genügt eine Mitursächlichkeit des Hangs für die Tatbegehung nicht mehr. Stattdessen soll die Unterbringung in einer Entziehungsanstalt wieder vorrangig für diejenigen vorgesehen werden, die in diesem Rahmen gut zu erreichen sind und die dortigen Angebote nutzen können. Demgegenüber sei eine spezifische Entwöhnungsbehandlung nicht das richtige Instrument im Umgang mit Tätern, deren Tat nicht vorrangig auf den Hang, sondern überwiegend auf andere Faktoren wie etwa eine schwere dissoziale Entwicklung zurückgeht (BT-Drucks 20/5913, S. 47). Konkret bedeutet dies, dass die rechtswidrige Tat nach § 64 StGB n.F. überwiegend auf den Hang zurückgehen muss. Dies soll der Fall sein, wenn er mehr als andere Umstände für die Begehung der Anlasstat ausschlaggebend war; beim Zusammentreffen mehrerer Ursachen muss der Hang die anderen Ursachen quantitativ überwiegen. Dem Gericht obliegt es, das Vorliegen dieses Kausalzusammenhangs gegebenenfalls unter Hinzuziehung eines Sachverständigen positiv festzustellen (BT-Drucks 20/5913, S. 69).
Diese Änderung soll den Anwendungsbereich des § 64 StGB wieder stärker auf Straftaten beschränken, die typischerweise von suchtkranken Tätern begangen werden, also insbesondere auf die klassische Beschaffungskriminalität. Von einer überwiegenden Verursachung der Tat durch den Hang wird daher vor allem in Fällen auszugehen sein, in denen die Tat auf Drogenhunger oder die Notwendigkeit zum Erwerb des Rauschmittels zur Vermeidung von Entzugserscheinungen zurückgeht, aber auch wenn aggressive Handlungen infolge der Abhängigkeit bzw. einer Intoxikation begangen worden sind (BT-Drucks 20/5913, S. 46). Hier ist insbesondere an Gewalttaten von Alkoholabhängigen zu denken.
Demgegenüber soll es künftig für eine Anordnung der Unterbringung nicht mehr ausreichen, wenn Straftaten begangen werden, um neben dem Drogenkonsum den eigenen, womöglich aufwendigen Lebensbedarf zu finanzieren, oder wenn ein suchtunabhängiges dissoziales Verhalten für die Tatbegehung wesentlich war (BT-Drucks 20/5913, S. 47). Auch insoweit hat der Gesetzgeber den Willen, die Rechtsprechung des BGH einzudämmen.
3. Eine Änderung bzw., wie die Gesetzesbegründung formuliert, eine „moderate Anhebung“ der Anforderungen (BT-Drucks 20/5913, S. 70) hat auch das Kriterium der Erfolgsaussicht erfahren. Genügte es für eine Anordnung der Unterbringung bislang, wenn eine durch Tatsachen begründete Wahrscheinlichkeit für das Erreichen des Behandlungsziels vorlag, muss dies nach § 64 StGB n.F. nunmehr aufgrund tatsächlicher Anhaltspunkte zu erwarten sein.
„Zu erwarten“ ist ein Therapieerfolg hiernach, wenn eine Wahrscheinlichkeit höheren Grades für einen Therapieerfolg gegeben ist (BT-Drucks 20/5913, S. 69). Damit soll im Interesse eines möglichst effektiven Einsatzes der Maßregel sichergestellt werden, dass nur Angeklagte von ihr erfasst werden, deren Behandlung den gesetzlich vorausgesetzten Erfolg erwarten lässt (BT-Drucks 20/5913, S. 48).
Der zu erwartende Therapieerfolg muss sich, wie nach bisherigem Recht auch, sicher positiv feststellen lassen, seine entsprechende Überzeugung hat das Gericht in den Urteilsgründen darzulegen (vgl. BGH, Beschl. v. 8.2.2022 – 4 StR 235/22). Erforderlich ist insoweit eine richterliche Gesamtwürdigung der Täterpersönlichkeit und aller sonstigen maßgebenden Umstände. Jedenfalls in Fällen, in denen sich dies nicht angesichts der Feststellungen von selbst versteht, hat das Gericht näher darzulegen, welche konkret zu benennenden Anhaltspunkte sich dafür finden lassen, dass es innerhalb des nach § 64 S. 2 StGB maßgeblichen Zeitraums nicht mehr zur Begehung hangbedingter, erheblicher rechtswidriger Taten kommen wird (BT-Drucks 20/5913, S. 69).
Insoweit hat der Gesetzgeber vor allem folgende Aspekte in den Blick genommen:
a) Insbesondere hat das Gericht die Behandlungsfähigkeit und Behandlungsbereitschaft des Angeklagten zu prüfen. Damit geht es in erster Linie um in der Person und Persönlichkeit des Täters liegende Umstände, vor allem solche, die seine Sucht und deren Behandlungsfähigkeit unmittelbar kennzeichnen – also vor allem Art und Stadium der Sucht, bereits eingetretene physische und psychische Veränderungen und Schädigungen, frühere Therapieversuche sowie eine aktuelle Therapiebereitschaft. Der Gesetzgeber geht davon aus, dass diese Anhebung der Anforderungen an eine günstige Behandlungsprognose dazu führt, dass die Unterbringung häufiger ausscheiden wird als bisher (BT-Drucks 20/5913, S. 70).
(1) So soll eine Unterbringung etwa dann nicht in Betracht kommen, wenn der Angeklagte eine Behandlung nachdrücklich ablehnt und nicht zu erwarten steht, dass er sich im Maßregelvollzug der Notwendigkeit der Behandlung öffnen und an ihr mitwirken wird. Dass es in einer solchen Konstellation, also wenn der Angeklagte eine Therapie aus- und nachdrücklich ablehnt und zudem keinerlei Veränderungsbereitschaft zeigt, an der Erfolgsaussicht fehlt, hat der BGH allerdings auch bereits vor der Gesetzesreform anerkannt (Beschl. v. 11.10.2022 – 5 StR 274/22), sodass insoweit keine größeren Veränderungen zu erwarten sind.
Zu beachten bleibt freilich, dass die Erfolgsaussicht weiterhin nicht bereits dann verneint werden darf, wenn der Angeklagte in der Hauptverhandlung unterhalb der Schwelle zur endgültigen Verweigerung einen gewissen Unwillen zur Therapie kundtut oder deren Sinnhaftigkeit anzweifelt. Dies sieht offenbar auch der Gesetzgeber so, wenn er auf eine gewisse Anpassungszeit in der Unterbringung verweist (BT-Drucks 20/5913 a.a.O.).
(2) Umgekehrt kann aus einer ausdrücklich erklärten Therapiebereitschaft noch nicht ohne weiteres der Schluss gezogen werden, dass ein erfolgreicher Abschluss der Behandlung zu erwarten ist. Dies soll insbesondere dann gelten, wenn zugleich gewichtige ungünstige Umstände vorliegen, etwa wenn der Angeklagte bereits mehrere Therapien abgebrochen oder sie zwar durchgestanden hat, aber immer wieder rückfällig geworden ist, wenn ein verfestigter und langjähriger Rauschmittelkonsum vorliegt oder eine ausgeprägte zusätzliche Persönlichkeitsstörung, die die Suchtproblematik eher in den Hintergrund stellt, sowie wenn in der Person des Angeklagten eine kaum veränderbare defizitäre Kränkungs- und Frustrationstoleranz sowie eine fehlende Reflexions- und Introspektionsfähigkeit gegeben ist (BT-Drucks 20/5913 a.a.O.). Auch eine vollziehbare Ausreisepflicht kann der Erfolgsaussicht entgegenstehen.
Dies ist indes nicht völlig neu, denn der BGH hat bereits in der Vergangenheit entschieden, dass eine erklärte Therapiebereitschaft allein das Gewicht zahlreicher negativer Faktoren nicht aufzuwiegen vermag (BGH, Beschl. v. 4.12.2019 – 1 StR 433/19).
b) Darüber hinaus hat der Gesetzgeber das in der Praxis häufig anzutreffende Problem mangelnder Sprachkenntnisse bzw. unzureichender Sprachkompetenzen aufgegriffen. Die Erwartung erfolgreicher Behandlung sei in der Regel dann nicht berechtigt, wenn der Angeklagte nicht über die für die Behandlung in der Entziehungsanstalt erforderlichen Sprachkenntnisse verfügt (BT-Drucks 20/5913, S. 70). Zu Recht hat der Gesetzgeber insoweit darauf verwiesen, dass die Therapie in einer Entziehungsanstalt eine primär verbale, sprachbasierte Therapie sei, bestehend insbesondere aus diversen Einzel- und Gruppentherapien. Die Aufarbeitung der eigenen Lebensgeschichte, des Suchtmittelkonsums und dessen Ursachen sowie der Zusammenhänge zwischen Sucht und Delinquenz sowie die Erarbeitung von rückfallprophylaktischen Strategien, der Erwerb von Fähigkeiten sowie gegebenenfalls die Verarbeitung von Suchtmittelrückfällen stellen das Kernstück der Behandlung dar. Diese kann daher nur dann erfolgversprechend sein, wenn eine echte, d.h. therapeutisch sinnvolle Kommunikation zwischen dem Therapeuten und dem Patienten möglich ist (BT-Drucks 20/5913 a.a.O.; MüKo-StGB/van Gemmeren, 4. Aufl., § 64 Rn 71). Bestehen hier erhebliche Defizite, können diese in den in den Entziehungsanstalten angebotenen Deutschkursen, die überdies die für die eigentliche Behandlung benötigte Zeit einschränken, nicht ausgeglichen werden.
Hiervon ausgehend ist es nachvollziehbar, wenn der Gesetzgeber derartige Sprachprobleme als einem Behandlungserfolg im Wege stehend einstuft. Ausnahmen sollen im Einzelfall möglich sein, wenn eine qualifizierte Teilnahme an der Therapie über Sprachmittler oder auch fremdsprachige Therapeuten sichergestellt werden kann. Dies soll nach Auffassung des Rechtsausschusses des Bundestages z.B. der Fall sein, wenn die Behandlung in einer Einrichtung erfolgen kann, die darauf ausgelegt ist, Personen in einer Sprache zu behandeln, die der Angeklagte beherrscht (BT-Drucks 20/7026, S. 21). Dies dürfte freilich in der Praxis schwer umsetzbar sein.
4. Die bisherige Attraktivität einer Unterbringung nach § 64 StGB bestand vor allem für Angeklagte, die langjährige Haftstrafen zu erwarten hatten, darin, dass im Falle eines erfolgreichen Therapieabschlusses die Möglichkeit bestand, bereits zum Halbstrafenzeitpunkt auf Bewährung entlassen zu werden (§ 67 Abs. 5 S. 1 StGB a.F.). Dies stellte eine erhebliche Privilegierung gegenüber „normalen“ Strafgefangenen dar, die die oftmals recht hohen Voraussetzungen des § 57 Abs. 2 StGB nicht erfüllen und deshalb ganz überwiegend mindestens zwei Drittel der gegen sie verhängten Strafe verbüßen müssen.
a) Diese Privilegierung hat der Gesetzgeber nunmehr als „ungewollten Anreiz“ angesehen (BT-Drucks 20/5913, S. 49) und deshalb eine Angleichung an die übliche (Mindest-)Verweildauer im allgemeinen Strafvollzug vorgenommen. Eine Reststrafenaussetzung zur Bewährung ist daher nach § 67 Abs. 5 S. 1 StGB n.F. nunmehr erst möglich, wenn zwei Drittel der verhängten Strafe erledigt sind.
Zusätzlich müssen, wie bereits zuvor, auch die Voraussetzungen des § 57 Abs. 1 S. 1 Nr. 2, Nr. 3 und S. 2 StGB vorliegen (hierzu Hillenbrand, ZAP 2023, 151). Dies ergibt sich aus § 57 Abs. 1 S. 2 StGB, auf den der neu gefasste § 67 Abs. 5 S. 1 StGB aus Gründen der Klarstellung nunmehr ausdrücklich verweist. Die Entlassung setzt also neben dem Erreichen der Mindestverbüßungszeit insbesondere voraus, dass sie unter Berücksichtigung des Sicherheitsinteresses der Allgemeinheit verantwortet werden kann. Dabei sind insbesondere die Persönlichkeit des Verurteilten, sein Vorleben, die Umstände seiner Tat, das Gewicht des bei einem Rückfall bedrohten Rechtsguts, das Verhalten des Verurteilten im Vollzug, seine Lebensverhältnisse und die Wirkungen zu berücksichtigen, die von der Reststrafenaussetzung für ihn zu erwarten sind.
Sind die vorgenannten Voraussetzungen gegeben, ist der Verurteilte zwingend auf Bewährung zu entlassen; ein Ermessen des Gerichts besteht nicht (BT-Drucks 20/5913, S. 72).
Für die Verteidigung bedeutet die Änderung, dass noch sorgfältiger als bisher geprüft werden muss, ob für den Mandanten tatsächlich eine Unterbringung in einer Entziehungsanstalt angestrebt werden soll. Denn mit der Halbstrafenaussetzung ist das für viele Angeklagte ausschlaggebende Motiv, sich auf eine solche Behandlung einzulassen, weggefallen. Darüber hinaus besteht, wie bislang auch schon, im Falle eines Scheiterns der Behandlung die erhebliche Gefahr, dass die verhängte Freiheitsstrafe vollständig verbüßt werden muss, wird sich doch kaum einmal eine Strafvollstreckungskammer finden, die bei einer gescheiterten Therapie und damit einhergehend einem nach wie vor nicht behandelten Suchtproblem zu einer günstigen Prognose kommt.
Ferner muss in den Blick genommen werden, dass der Verurteilte nicht nur willens, sondern auch in der Lage sein muss, sich so auf die Behandlung einzulassen, dass sie am Ende auch erfolgreich abgeschlossen werden kann. Bestehen hier Zweifel, wird eine Entlassung zum Zweidrittelzeitpunkt im regulären Strafvollzug oftmals eher zu erreichen sein als im Falle einer Unterbringung mit ihrer hohen Abbruchsquote von über 50 % (Schäfer/Sander/Gemmeren, Praxis der Strafzumessung, 6. Aufl., Rn 473), insbesondere wenn sich der Verurteilte erstmals in Strafhaft befindet und ihm deshalb, ein einwandfreies Vollzugsverhalten vorausgesetzt, das sogenannte Erstverbüßerprivileg zugutekommt, wonach beim erstmaligen Vollzug einer Freiheitsstrafe eine Vermutung dafür spricht, dass der Vollzug nach Ablauf von zwei Dritteln der Haftzeit seine Wirkung erreicht hat und dies der Begehung neuer Straftaten entgegenwirkt (Fischer, StGB, 70. Aufl., § 57 Rn 14 m.w.N.).
b) Eine Halbstrafenaussetzung ist dagegen nur noch theoretisch möglich, praktisch hingegen hat sie sich für nahezu alle Verurteilten erledigt. Zwar sieht § 67 Abs. 2 S. 3 StGB n.F. vor, dass das Gericht die Aussetzung auch schon nach Erledigung der Hälfte der Strafe bestimmen kann, wenn die Voraussetzungen des § 57 Abs. 2 entsprechend erfüllt sind. Eine solche Entscheidung, die gesonderter Begründung bedarf, erfordert jedoch, dass das Gericht – bereits im Urteilszeitpunkt – ausnahmsweise die hinreichend konkrete Aussicht bejaht, dass aufgrund der Therapie eine Reststrafenaussetzung voraussichtlich bereits entsprechend § 57 Abs. 2 StGB möglich sein wird. Eine solche Prognose wird kaum einmal getroffen werden können, weshalb auch der Gesetzgeber davon ausgeht, dass die Voraussetzungen für eine derart frühe Entlassung nur höchst selten zu bejahen sein werden (BT-Drucks 20/5913, S. 72).
Es wird daher nahezu immer auf den Zweidrittelzeitpunkt hinauslaufen. Dementsprechend hat sich das Gericht in Fällen, in denen die ausgeurteilte Freiheitsstrafe mehr als drei Jahre beträgt, künftig bei der Bemessung des Vorwegvollzugs an diesem Zeitpunkt zu orientieren (§ 67 Abs. 2 S. 3 StGB n.F.).
5. Schließlich hat auch die StPO eine Änderung erfahren, und zwar dahingehend, dass Entscheidungen, mit denen eine Unterbringung für erledigt erklärt wird (§ 67d Abs. 5 S. 1 StGB), auch dann sofort vollziehbar sind, wenn der Verurteilte gegen die Entscheidung sofortige Beschwerde einlegt (§ 463 Abs. 6 S. 3 StPO n.F.). Damit soll bundeseinheitlich eine zeitnahe Rückverlegung von Verurteilten, bei denen eine Fortführung der Unterbringung keine Aussicht auf Erfolg mehr hat, in den regulären Strafvollzug ermöglicht werden. Zudem will der Gesetzgeber verhindern, dass das therapeutische Klima in den Einrichtungen durch dort bis zur Rechtskraft der Erledigungsentscheidung verbleibende Personen negativ beeinflusst wird (BT-Drucks 20/5913, S. 33). Die bis zur Reform vertretene Auffassung, dass die Unterbringung in der Entziehungsanstalt im Falle einer sofortigen Beschwerde des Betroffenen gegen deren Erledigterklärung weiter zu vollstrecken ist, ist damit überholt. Es besteht jedoch die Möglichkeit für den Verurteilten, Antrag nach § 307 Abs. 2 StPO zu stellen (BT-Drucks 20/5913, S. 34).