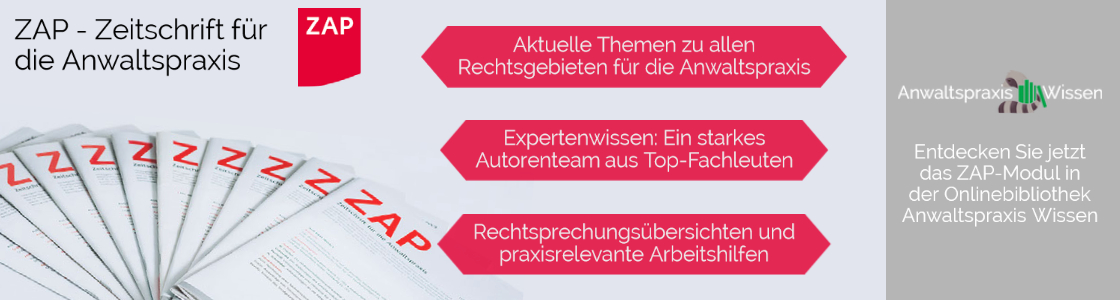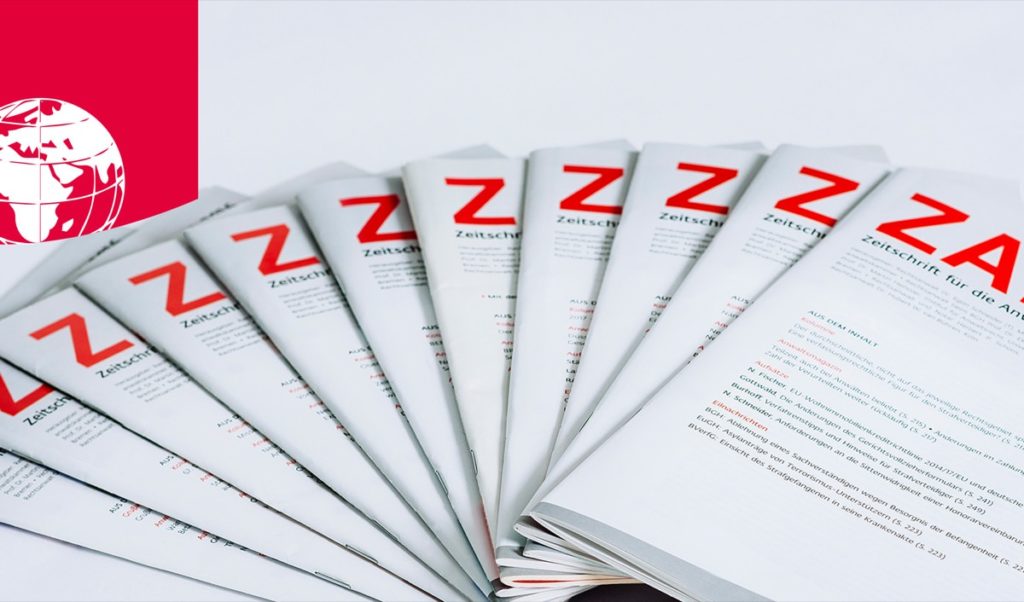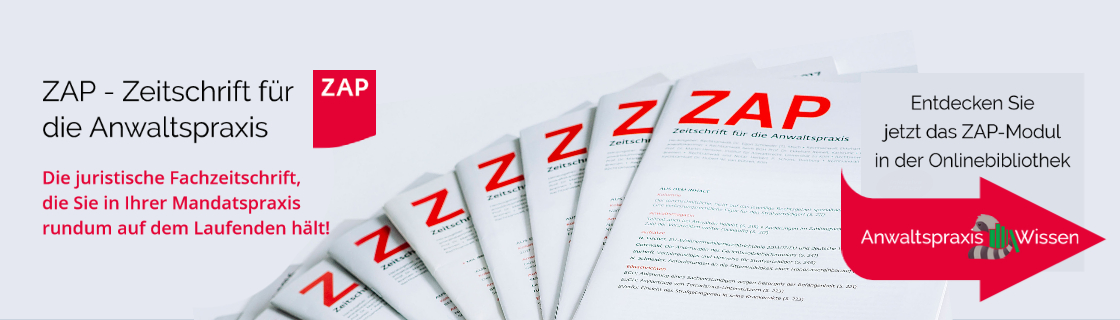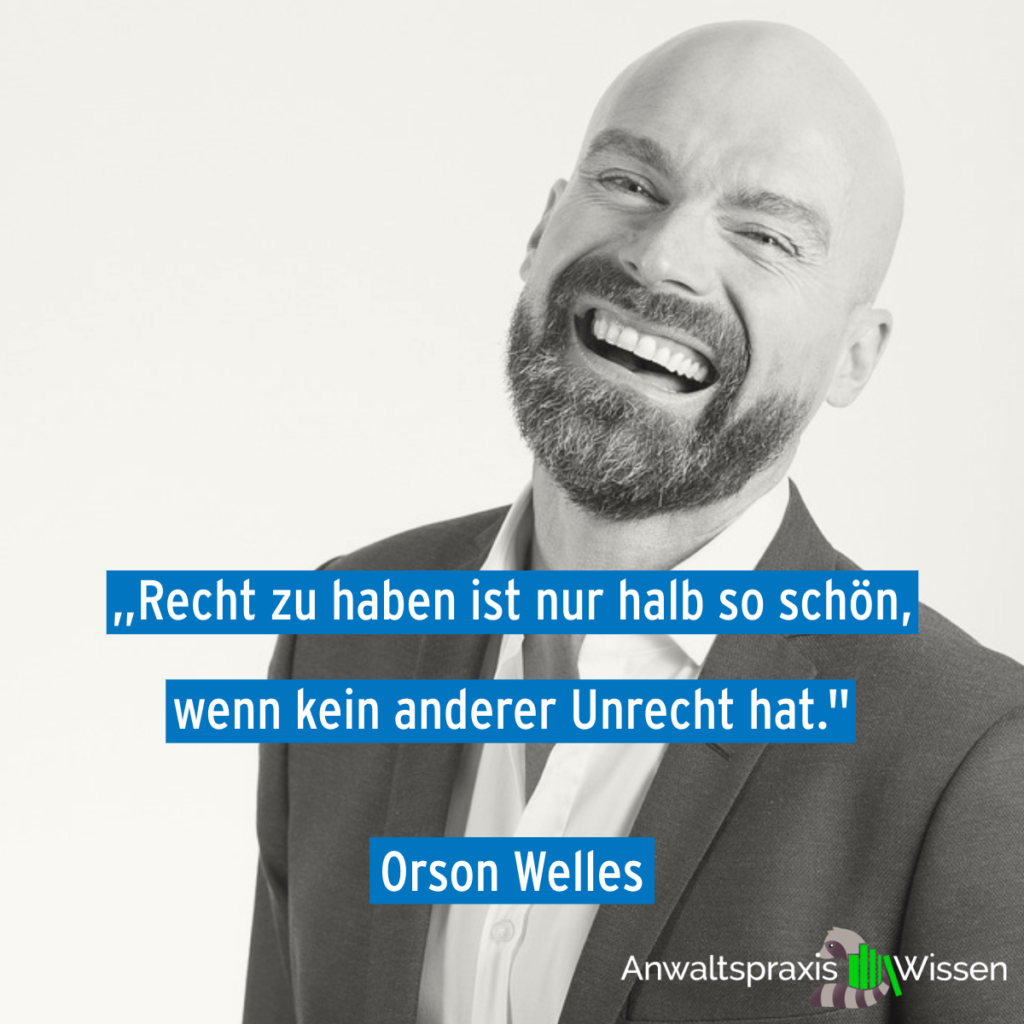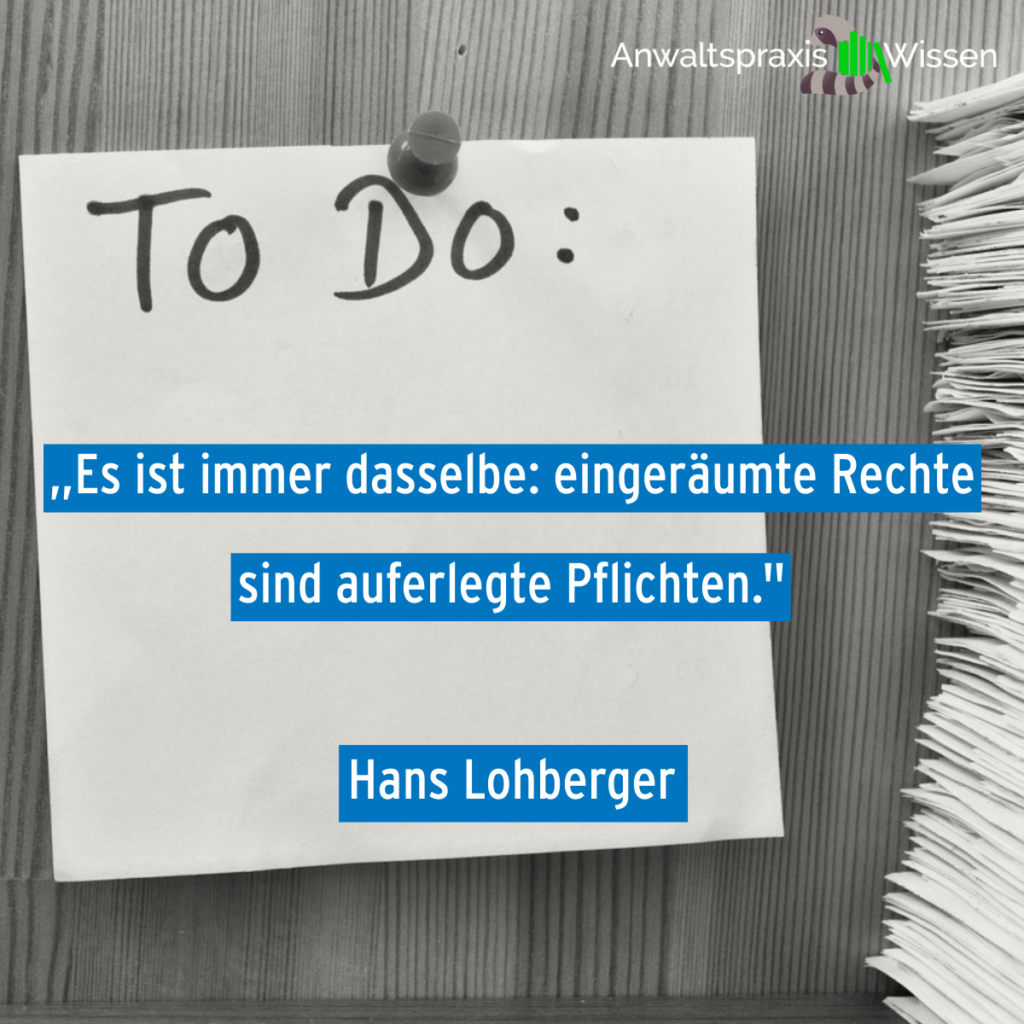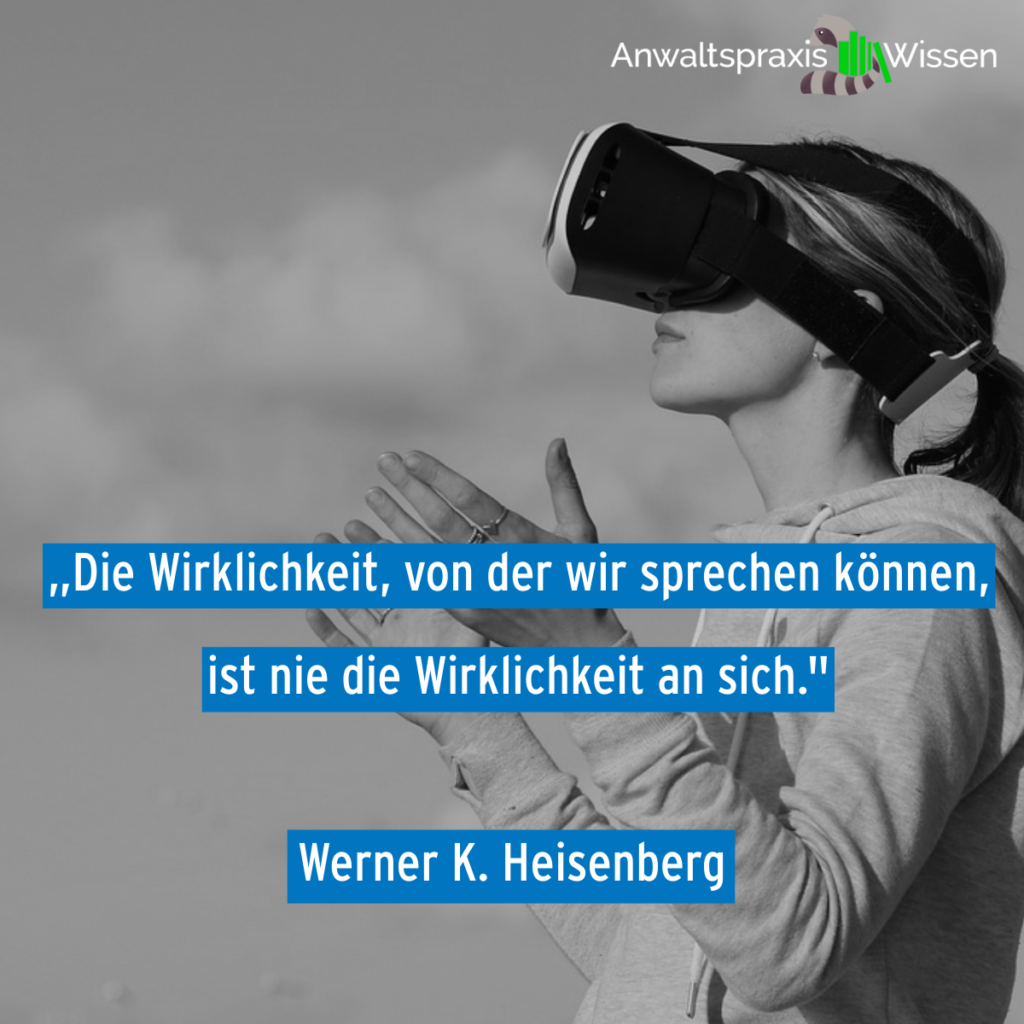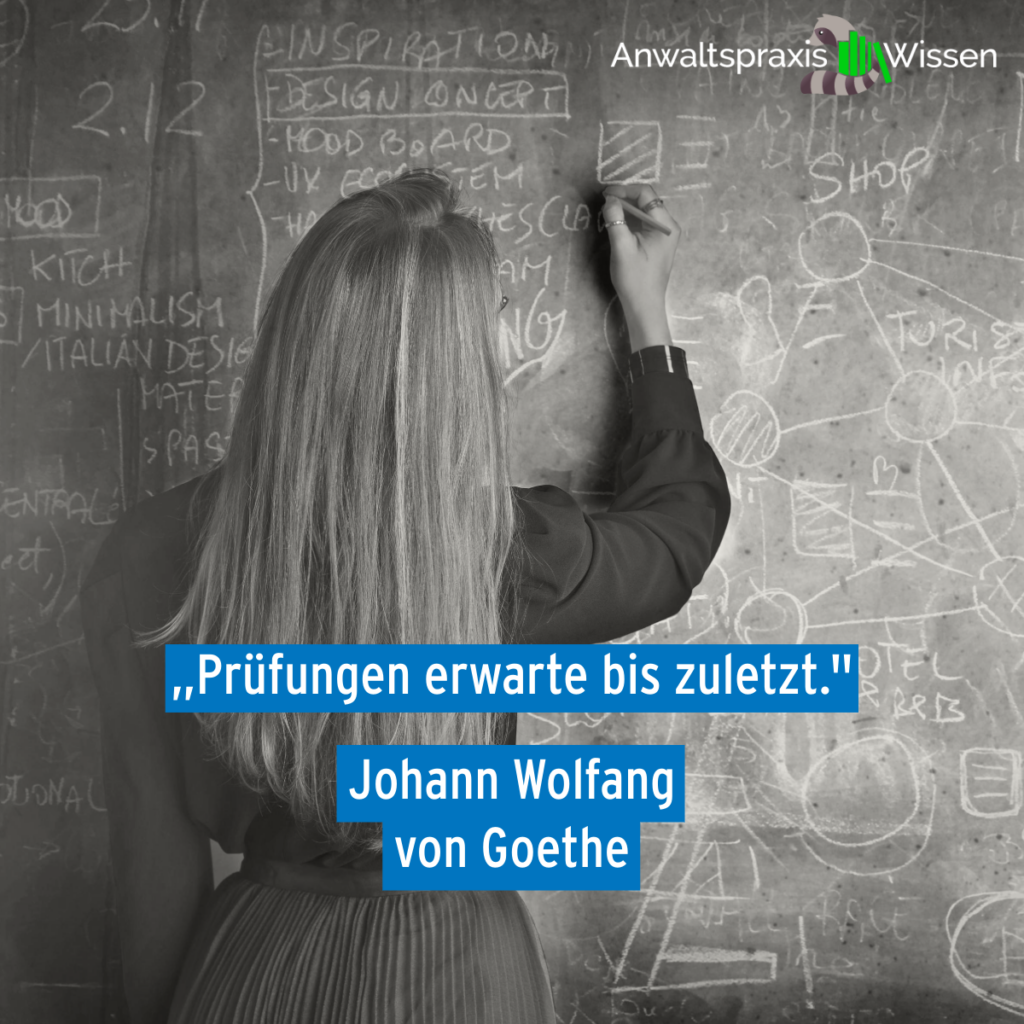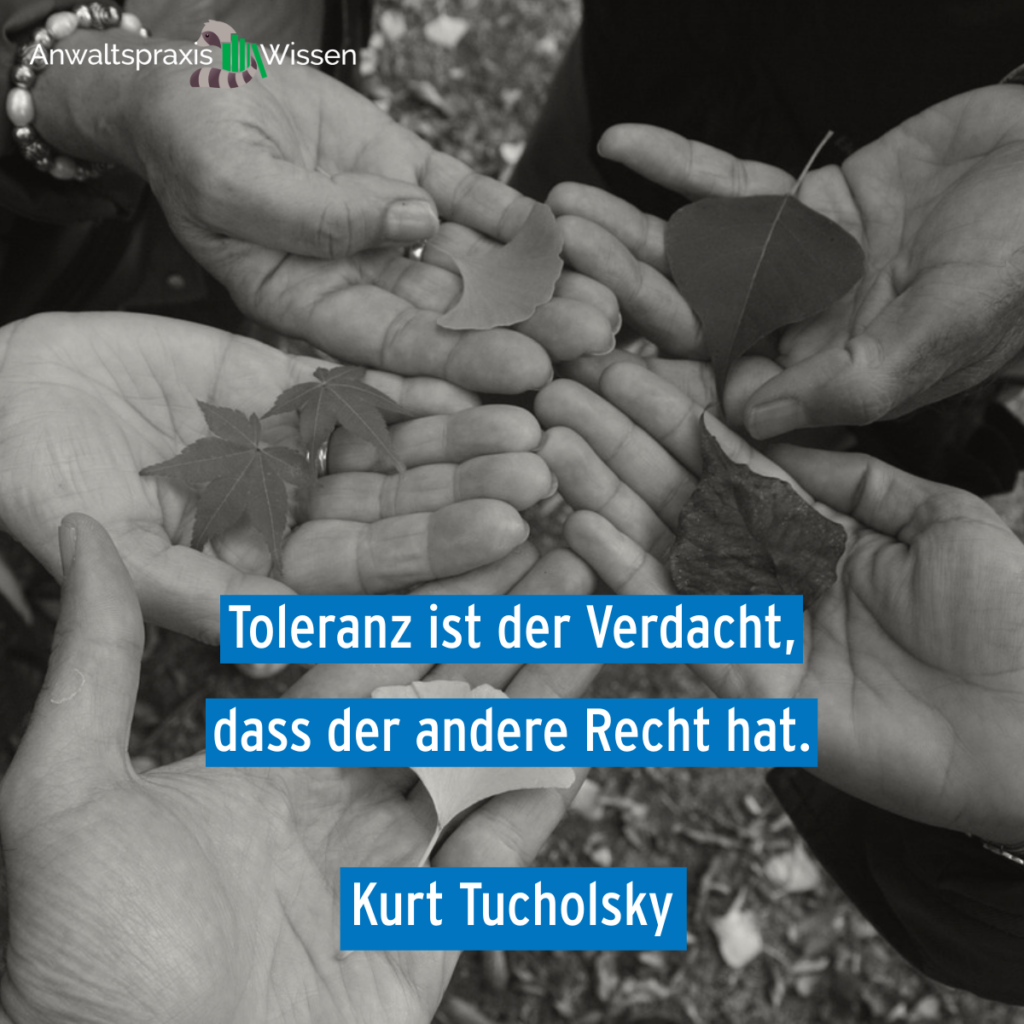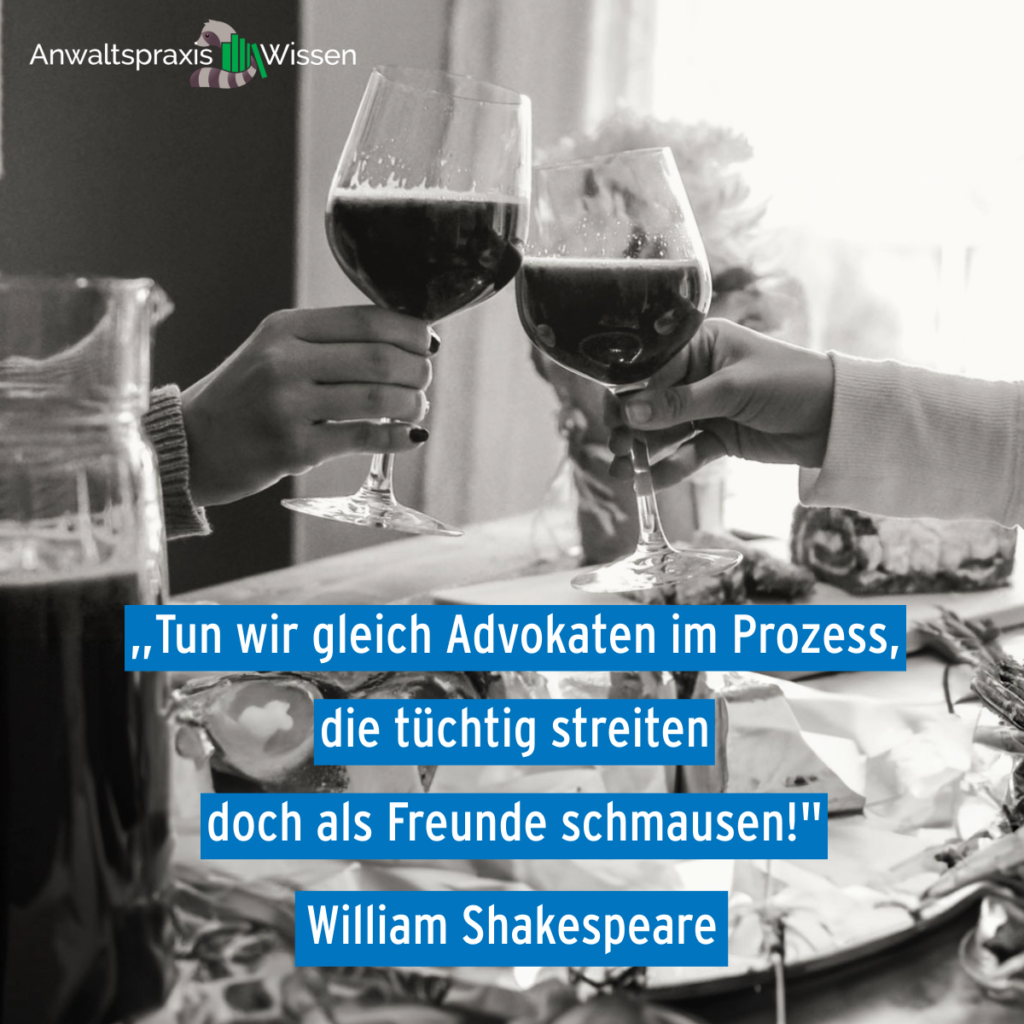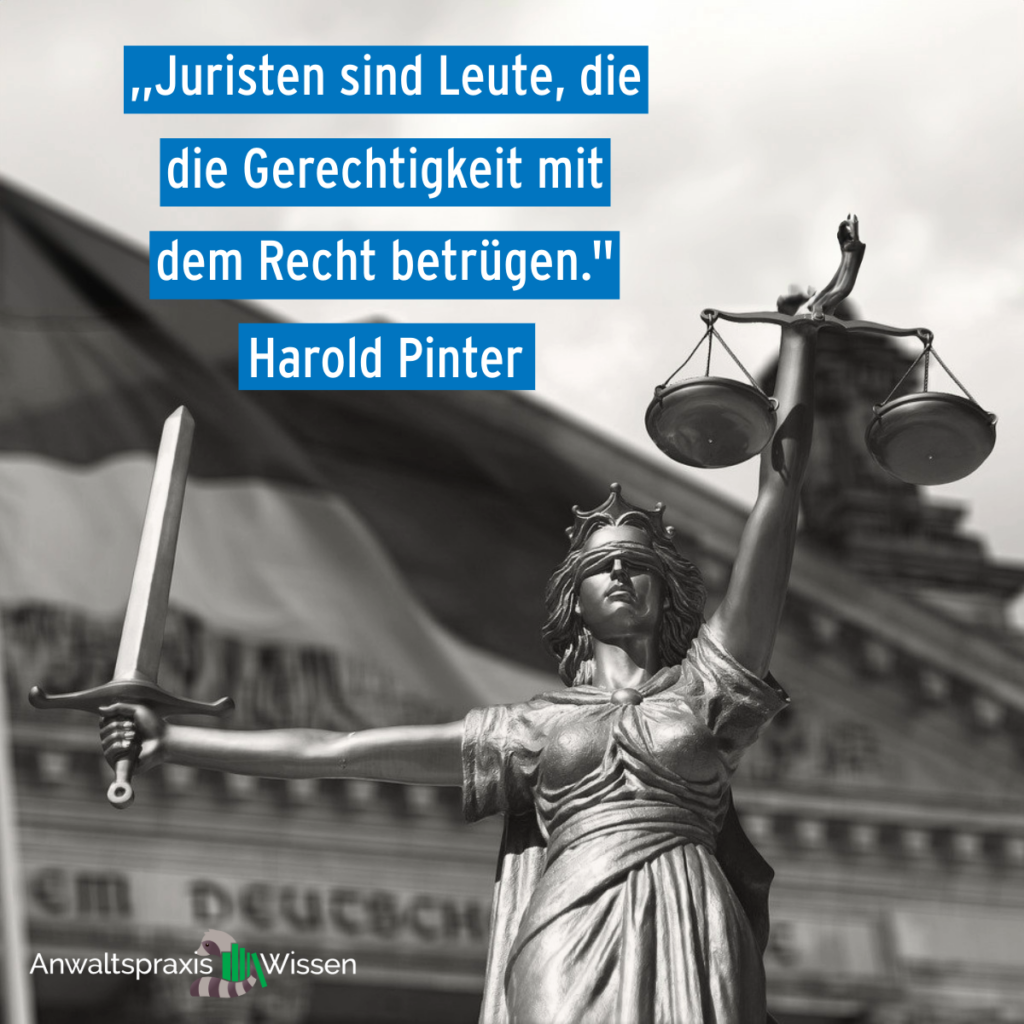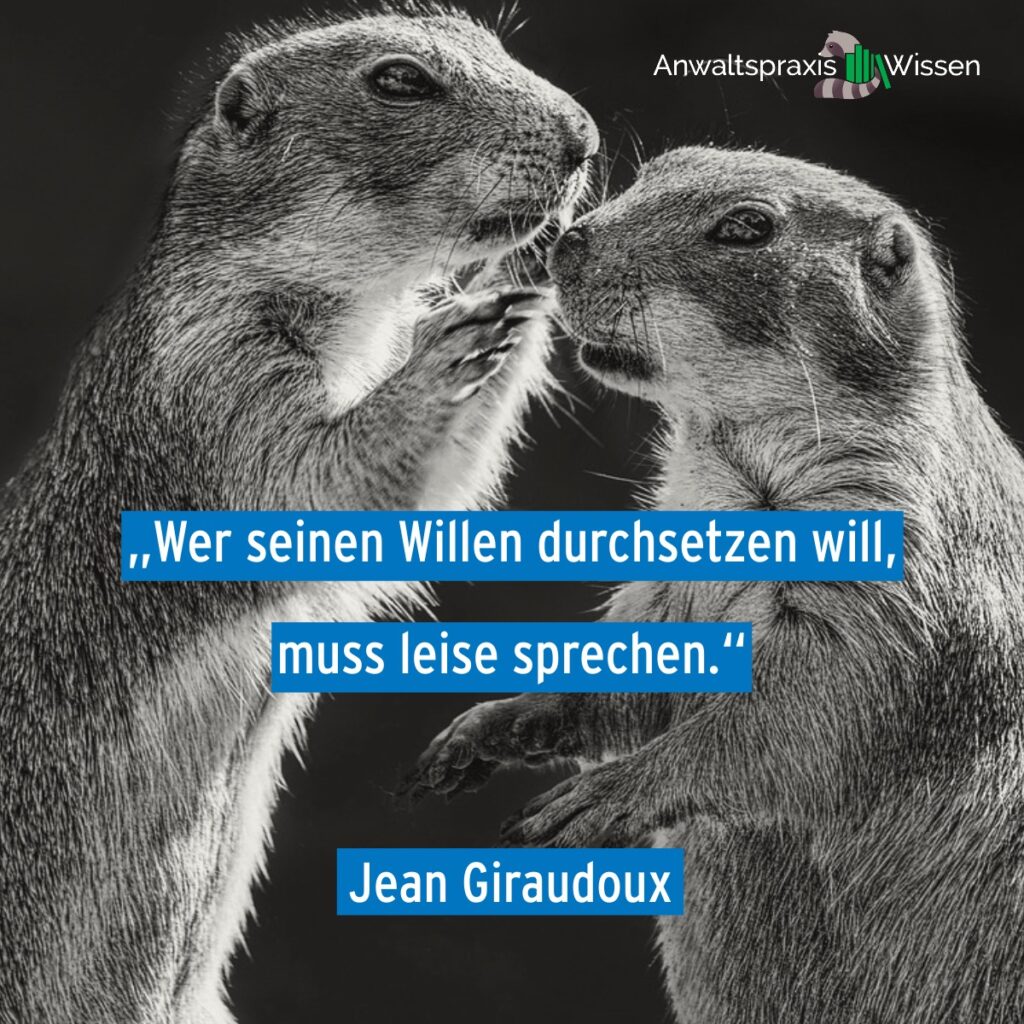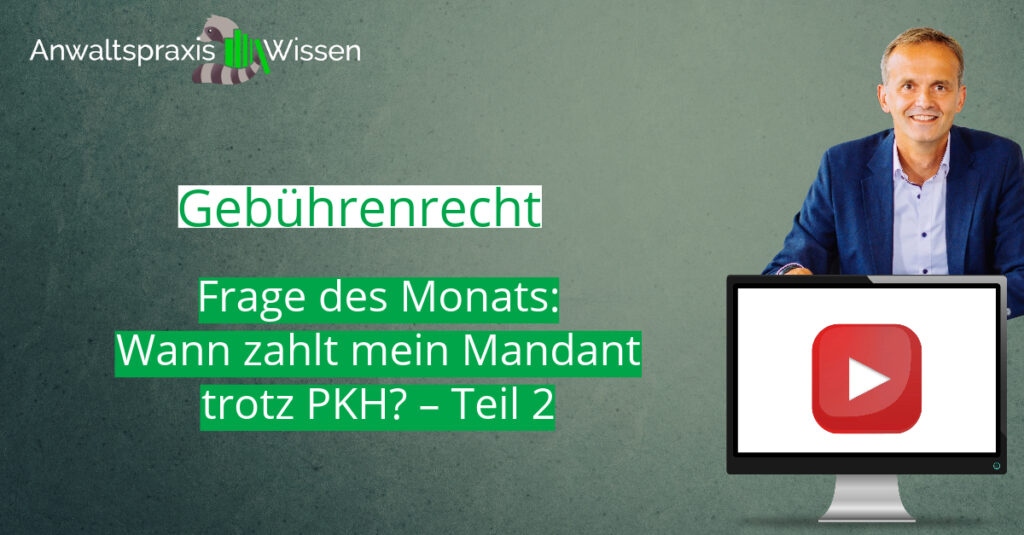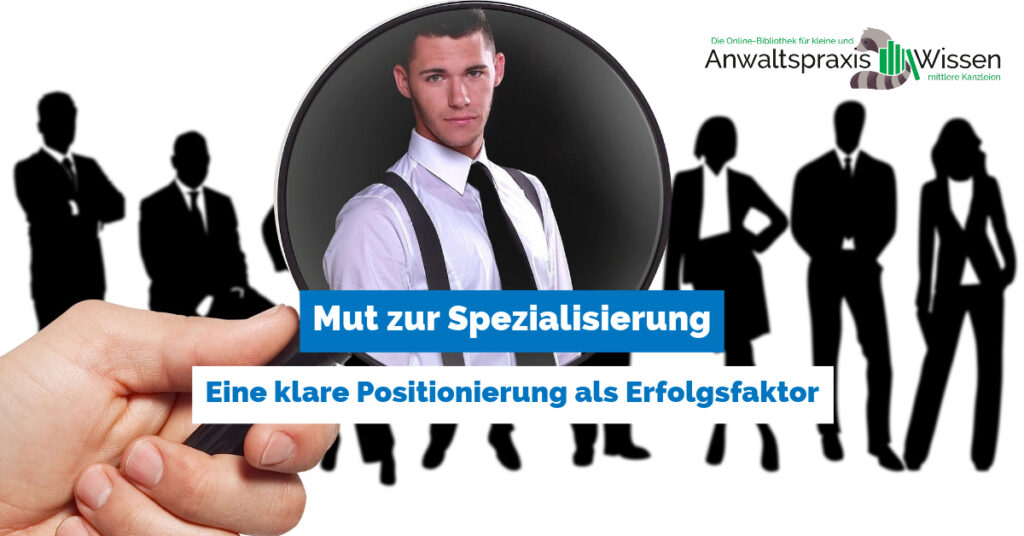Die Verjährungsfrist für einen Schadenersatzanspruch wegen des Kaufs eines vom VW-Abgasskandal betroffenen Neuwagens beginnt spätestens mit dem Schluss des Jahres 2016. Denn spätestens zu diesem Zeitpunkt hat Anlass bestanden, zu prüfen, ob der eigene Pkw betroffen ist. Dies entschied jetzt erneut der VII. Senat des BGH und bekräftigte damit seine bisherige Linie (vgl. dazu zuletzt Anwaltsmagazin ZAP 2022, S. 214 u. ZAP 2022, S. 260). Das Argument der Klägerseite, das betroffene Fahrzeug sei ein Audi gewesen und die Audi-AG habe die Käufer erst später informiert, ließen die Richter und Richterinnen nicht gelten.
Der Fall: Die Klägerin hatte im Jahr 2011 einen Audi Q5 2.0 TDI als Neufahrzeug gekauft, in das ein von der später bekannt gewordenen Abgasmanipulation betroffener Dieselmotor des Typs EA 189 verbaut war. Mit ihrer im Jahr 2020 eingereichten Klage verlangte die Klägerin von der Volkswagen AG die Erstattung des Kaufpreises abzgl. einer Nutzungsentschädigung nebst Zahlung von Prozesszinsen Zug um Zug gegen Übereignung und Herausgabe des Fahrzeugs, sowie die Feststellung des Annahmeverzugs der Beklagten und die Zahlung vorgerichtlicher Rechtsverfolgungskosten. Der Einrede der Verjährung begegnete sie mit der Behauptung, erst durch ein Schreiben der Audi AG im Januar 2017 von der Betroffenheit ihres eigenen Fahrzeugs vom sog. Abgasskandal erfahren zu haben. In den Vorinstanzen hatte sie mit dieser Argumentation Erfolg, nicht jedoch letztinstanzlich vor dem BGH.
Der VII. Senat hält die auf § 826 BGB gestützte Klage für verjährt. Die Vorinstanzen hätten rechtsfehlerhaft angenommen, dass die Klägerin die für den Verjährungsbeginn erforderliche Kenntnis ohne grobe Fahrlässigkeit i.S.v. § 199 Abs. 1 Nr. 2 Fall 2 BGB erst im Jahr 2017 erlangt habe. Grob fahrlässige Unkenntnis der Klägerin von der Betroffenheit ihres Fahrzeugs habe vielmehr schon bis Ende 2016 vorgelegen. Die dreijährige Verjährungsfrist des § 195 BGB habe daher mit Schluss des Jahres 2016 begonnen und habe deshalb durch die im Jahr 2020 erhobene Klage nicht mehr gehemmt werden können.
Der BGH argumentiert, dass die Klägerin – ausgehend von ihrer außer Streit stehenden allgemeinen Kenntnis vom sog. Dieselskandal – spätestens bis Ende 2016 Veranlassung hatte, die Betroffenheit ihres Fahrzeugs zu ermitteln. Dass sie nach einer allgemeinen Ankündigung des VW-Konzerns, die Kunden zu informieren, möglicherweise tatsächlich kein Anschreiben noch im Jahr 2016 bekommen habe, und dass die Kunden Ende 2015 noch gebeten worden seien, vor aktiver Kontaktaufnahme zu einem Volkswagen-Partnerbetrieb weitere schriftliche Informationen abzuwarten, begründe kein zeitlich unbegrenztes berechtigtes Vertrauen der Klägerin darauf, ihr Fahrzeug sei nicht betroffen. Angesichts der Länge des seit Bekanntwerden des sog. Dieselskandals verstrichenen Zeitraums habe für die Klägerin deshalb spätestens bis Ende 2016 Anlass bestanden, diese Betroffenheit selbst zu recherchieren. Dass sie dies nicht getan habe, sei grob fahrlässig.
Ergänzend erteilte der VII. Senat auch einem etwaigen auf § 852 S. 1 BGB gestützten Anspruch auf Restschadensersatz eine Absage. Der Hersteller habe durch den Neuwagenverkauf nichts