Wird ein Bagger auf einem offen zugänglichen Betriebsgelände, ohne dass andere Nutzer des Betriebsgeländes (z.B. Arbeiter, Fußgänger, Radfahrer und Kraftfahrzeugführer) von den von Betriebsfahrzeugen ausgehenden Gefahren ausgeschlossen sind, rückwärts gefahren, sind als spezifische Ausprägung des allgemeinen Rücksichtnahmegebots die Kardinalpflichten des § 9 Abs. 5 StVO zu beachten. (Leitsatz des Gerichts)
I. Sachverhalt
Unfall zwischen Lkw mit Anhänger und Bagger
Die Parteien streiten um die Haftungs- und die Haftungsanteile nach einem Unfall mit einem der Beklagten zu 1) gehörenden Bagger. Dabei war ein der Klägerin gehörender Anhänger beschädigt worden. Der Beklagte zu 1) hatte den von ihm geführten Bagger auf dem Betriebsgelände er Beklagten nach dem Anhalten aus einer Kurvenfahrt heraus unmittelbar zurücksetzt. Das LG hatte die Klage abgewiesen. Auf die Berufung der Klägerin hat das OLG die Klage als teilweise begründet angesehen. Es hat der Klägerin eine Mitverschuldensquote von 30 % angerechnet.
II. Entscheidung
Keine Haftung nach § 7 Abs. 1 StVG
Eine Haftung nach § 7 Abs. 1 StVG komme, wie das LG zutreffend festgestellt habe, nicht in Betracht, da der beteiligte Bagger der Beklagten zu 1) gemäß § 8 Nr. 1 StVG privilegiert sei. Damit könne entgegen dem Vortrag der Klägerin auch § 17 Abs. 3 StVG nicht zur Anwendung kommen, abgesehen davon, dass angesichts des Fahrverhaltens des Fahrers des klägerischen Fahrzeugs nicht von einer Unabwendbarkeit ausgegangen werden könne.
Haftung nach §§ 823 Abs. 1, 831 BGB
Die Beklagte haften nach Auffassung des OLG der Klägerin aber dem Grunde nach gemäß §§ 823 Abs. 1, 831 BGB. Der Beklagte zu 2) habe die Beschädigung des Anhängers jedenfalls fahrlässig (§ 276 Abs. 2 BGB) herbeigeführt, indem er den von ihm geführten Bagger der Beklagten zu 1) nach dem Anhalten aus einer Kurvenfahrt heraus unmittelbar zurücksetzte. Insoweit liege unabhängig davon, ob der Unfall nach dem Vortrag der Beklagten auf dem Betriebsgelände stattgefunden hat und dort die StVO aufgrund der entsprechenden Beschilderung der Beklagten oder jedenfalls sinngemäß im Rahmen von § 276 Abs. 2 BGB mittelbar zur Anwendung kommen könne oder der Unfall nach dem Vortrag der Klägerin außerhalb des Betriebsgeländes stattgefunden habe und die StVO unmittelbar zur Anwendung komme, ein Verstoß gegen die Kardinalpflicht des § 9 Abs. 5 StVO vor (vgl. zur spezifischen Ausprägung des allgemeinen Rücksichtnahmegebots etwa BGH, Urt. v. 17.1.2023 – VI ZR 203/22, r+s 2023, 265; Urt. v. 15.12.2015 – VI ZR 6/15, NJW 2016, 1098 m.w.N.; OLG Hamm, Beschl. v. 9.2.2023 – I-7 U 3/23). Die gleichzeitige, nicht § 19 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 StVO entsprechende Anordnung eines generellen Vorrangrechts von Betriebsfahrzeugen – zumal noch widersprüchlich beschildert, da es einmal nur für Schienenfahrzeuge angeordnet worden ist – habe entgegen der Auffassung der Beklagten nicht zur Folge, dass diesbezüglich die genannte Pflicht zum Gefährdungsausschluss beim Rückwärtsfahren zurücktrete, da auf dem offen zugänglichen Gelände in keiner Weise sichergestellt gewesen sei, dass andere Nutzer des Betriebsgeländes (z.B. Arbeiter, Fußgänger, Radfahrer und Kraftfahrzeugführer) von den von den Betriebsfahrzeugen ausgehenden Gefahren ausgeschlossen gewesen seien.
Rückschaupflicht
Der Beklagte zu 2) sei verpflichtet gewesen, sein beabsichtigtes Rangiermanöver nach dem mangels hinreichenden Raums missglückten Abbiegevorgang erst nach ausreichender Umschau, erforderlichenfalls Einweisung einzuleiten. Der Beklagte zu 2) als Führer des nach eigenem Vortrag massiven, schweren und unübersichtlichen Baggers, der nur über eine den direkt rückwärtigen Bereich erfassende Kamera sowie einen linksseitigen Außenspiegel verfügt habe, habe sich, da er nicht im Bereich einer gesicherten Arbeitsstelle, sondern gerade im freigegebenen Zufahrtsverkehr unterwegs war, nicht darauf verlassen können, dass der Bereich hinter ihm zu jeder Zeit frei sein würde. Dies gilt umso mehr, wenn er, wie vorgetragen, die Fahrspur hinter ihm nicht habe einsehen können.
Die Klägerin müsse sich auf ihren Anspruch nach § 254 Abs. 1 BGB einen Mitverschuldensanteil von 30 % anrechnen lassen. Der Klägerin sei ein Verstoß ihres Fahrers gegen § 1 Abs. 2 StVO in unmittelbarer oder mittelbarer Anwendung zuzurechnen, weil dieser trotz des vor ihm befindlichen Baggers seine Fahrt an diesem vorbei fortgesetzt habe. Dieser Verstoß erfahre indes entgegen der Würdigung des LG keine spezifische Ausprägung durch § 5 Abs. 3 StVO, denn es liege kein Überholen vor. Ein Überholen sei begrifflich gegeben, wenn ein Verkehrsteilnehmer von hinten an einem anderen vorbeifahre, der sich auf derselben Fahrbahn in derselben Richtung bewege oder nur mit Rücksicht auf die Verkehrslage anhalte (Freymann in: Geigel, Haftpflichtprozess, 29. Aufl. 2024, StVO § 5 Rn 156; vgl. BGH, Beschl. v. 15.9.2016 – 4 StR 90/16, NJW 2016, 3462). Das Beklagtenfahrzeug habe die Richtungsfahrbahn der Ausfahrt vom Betriebsgelände bereits dahingehend verlassen, dass der Abbiegevorgang nach rechts in den anderen Geländeteil eingeleitet gewesen sei, aber lediglich wegen des nicht ausreichenden Abbiegewinkels unterbrochen werden musste. Eine Bewegung in derselben Richtung wie der klägerische Lkw sei aber bereits zu dem Zeitpunkt, als der Fahrer des Lkw den Bagger zu passieren begann, nicht mehr gegeben gewesen. Gleichwohl hätte sich der Fahrer des klägerischen Lkw aufgrund der Gesamtsituation gemäß § 1 Abs. 2 StVO veranlasst sehen müssen, seine Annäherung zu verlangsamen, das Fahrverhalten des vor ihm befindlichen Baggers abzuwarten und seine eigene Fahrt ggf. zu unterbrechen.
Mutmaßlich überhöhte Geschwindigkeit des klägerischen Lkw ohne Bedeutung
Ohne kausale Auswirkung bleibe in diesem Zusammenhang eine gegenüber der Anordnung einer Höchstgeschwindigkeit von 10 km/h bzw. Schrittgeschwindigkeit (je nach Schild) auf dem Betriebsgelände – mutmaßlich – überhöhte Geschwindigkeit des klägerischen Lkw, so dass es auch insoweit nicht darauf ankomme, ob der Unfall auf dem Betriebsgelände stattgefunden hat. Ein späterer Unfall könne einer Geschwindigkeitsüberschreitung nicht allein schon deshalb zugerechnet werden, weil das Fahrzeug bei Einhaltung der vorgeschriebenen Geschwindigkeit erst später an die Unfallstelle gelangt wäre, vielmehr müsse sich in dem Unfall gerade die auf das zu schnelle Fahren zurückzuführende erhöhte Gefahrenlage aktualisieren (zu allem BGH, Urt. v. 26.4.2005 – VI ZR 228/03, r+s 2005, 477 m.w.N.; siehe zuletzt auch OLG Hamm, Beschl. v. 5.8.2024 – I-7 U 57/24 m.w.N.). Eine kritische Verkehrslage beginne für einen Verkehrsteilnehmer dann, wenn die ihm erkennbare Verkehrssituation konkreten Anhalt dafür biete, dass eine Gefahrensituation unmittelbar entstehen könne. Für einen vorfahrtsberechtigten Verkehrsteilnehmer sei dies in Bezug auf seinen Vorrang zwar nicht bereits der Fall, wenn nur die abstrakte, stets gegebene Gefahr eines Fehlverhaltens anderer bestehe, vielmehr müssten erkennbare Umstände eine bevorstehende Verletzung seines Vorrechts nahelegen. Von Bedeutung seien hierbei neben der Fahrweise des Wartepflichtigen alle Umstände, die sich auf dessen Fahrweise auswirken können, also auch die Fahrweise des Bevorrechtigten selbst. Gebe er dem Wartepflichtigen durch einen Verkehrsverstoß Anlass, die Wartepflicht – namentlich infolge einer Fehleinschätzung der Verkehrslage – zu verletzen, so könne die kritische Verkehrslage bereits vor der eigentlichen Vorfahrtsverletzung eintreten (BGH, Urt. v. 25.3.2003 – VI ZR 161/02, r+s 2003, 256 m.w.N.; siehe dazu zuletzt auch BGH, Urt. v. 22.11.2016 – VI ZR 533/15, r+s 2017, 95 m.w.N.; OLG Hamm, Beschl. v. 5.8.2024 – I-7 U 57/24).
Unfall für Kläger nicht vermeidbar
Gemessen daran sei der Unfall für den Fahrer des Klägerfahrzeugs zum Zeitpunkt des Eintritts der kritischen Verkehrssituation weder räumlich noch zeitlich vermeidbar gewesen noch hätten sich die Personen- und Sachschäden erheblich anders dargestellt. Die kritische Verkehrssituation sei hier frühestens eingetreten, als der Beklagte zu 2) den Bagger aus der ursprünglichen Vorwärtsfahrt endgültig zum Stehen gebracht, spätestens, als er die Rückwärtsbewegung eingeleitet hatte.
Abwägung
Der Mitverschuldensbeitrag sei dem Verschulden der Beklagten entgegenzusetzen, wobei auch der nur mittelbaren Verletzung der Pflichten aus § 9 Abs. 5 StVO im Rahmen des § 1 Abs. 2 StVO ein entsprechendes Gewicht zukomme (vgl. BGH, Urt. v. 15.12.2015 – VI ZR 6/15, NJW 2016, 1098 m.w.N.). Danach ist eine Gewichtung des Verschuldensanteils der Klägerseite mit 30 % und der Beklagtenseite mit 70 % angemessen. Dem für sich genommen ganz erheblich wiegenden Verstoß des Beklagten zu 2) gegen die Kardinalpflicht des Gefährdungsausschlusses bei Rückwärtsfahrt stehe ein deutlich geringer zu gewichtender Verstoß des Fahrers des klägerischen Lkw gegen allgemeine und auch in der konkreten Situation einleuchtende Sorgfaltspflichten gegenüber. Kein besonderes Gewicht sei dem von den Beklagten aufgegriffenen Umstand beizumessen, dass der Fahrer des Klägerfahrzeugs nicht befugt gewesen sei, das Betriebsgelände überhaupt zu befahren, da die Beschilderung insoweit nicht hinreichend einfach erfassbar gewesen sei und sich dieser Umstand, wenn auch kausal, so doch im Hinblick auf die Fortgeltung der hier zur Anwendung zu bringenden Regelung der StVO nicht maßgeblich ausgewirkt habe. Die (beiderseitige) Einhaltung der im Verkehr erforderlichen Sorgfalt sei insoweit unabhängig von der etwaigen Frage eines einseitigen Hausrechts zu beurteilen.
III. Bedeutung für die Praxis
Zutreffend
M.E. auf der Grundlage der vom OLG angeführten BGH-Rechtsprechung zur Rückschaupflicht beim Rückwärtsfahren zutreffend, und zwar auch die Abwägung der Haftungsanteile von 30 % zu 70 %.
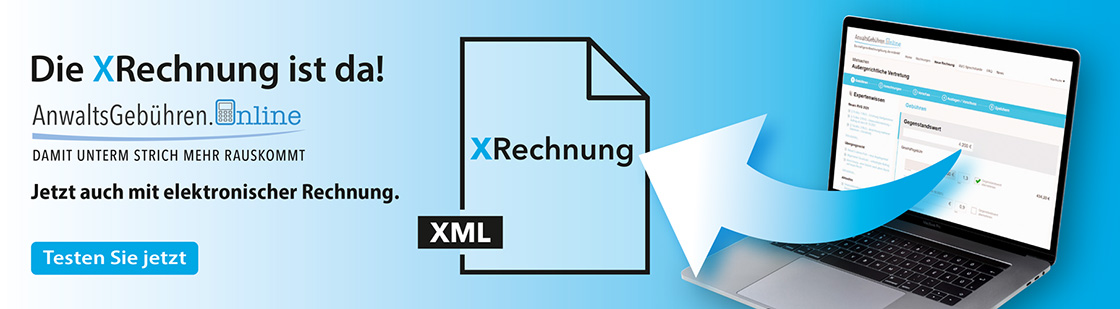

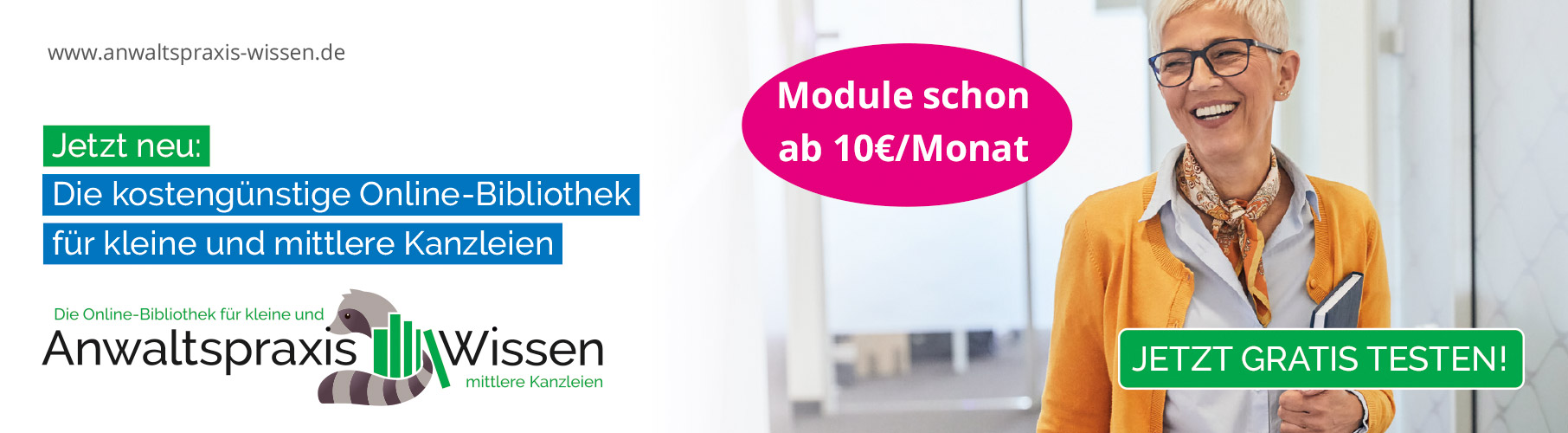


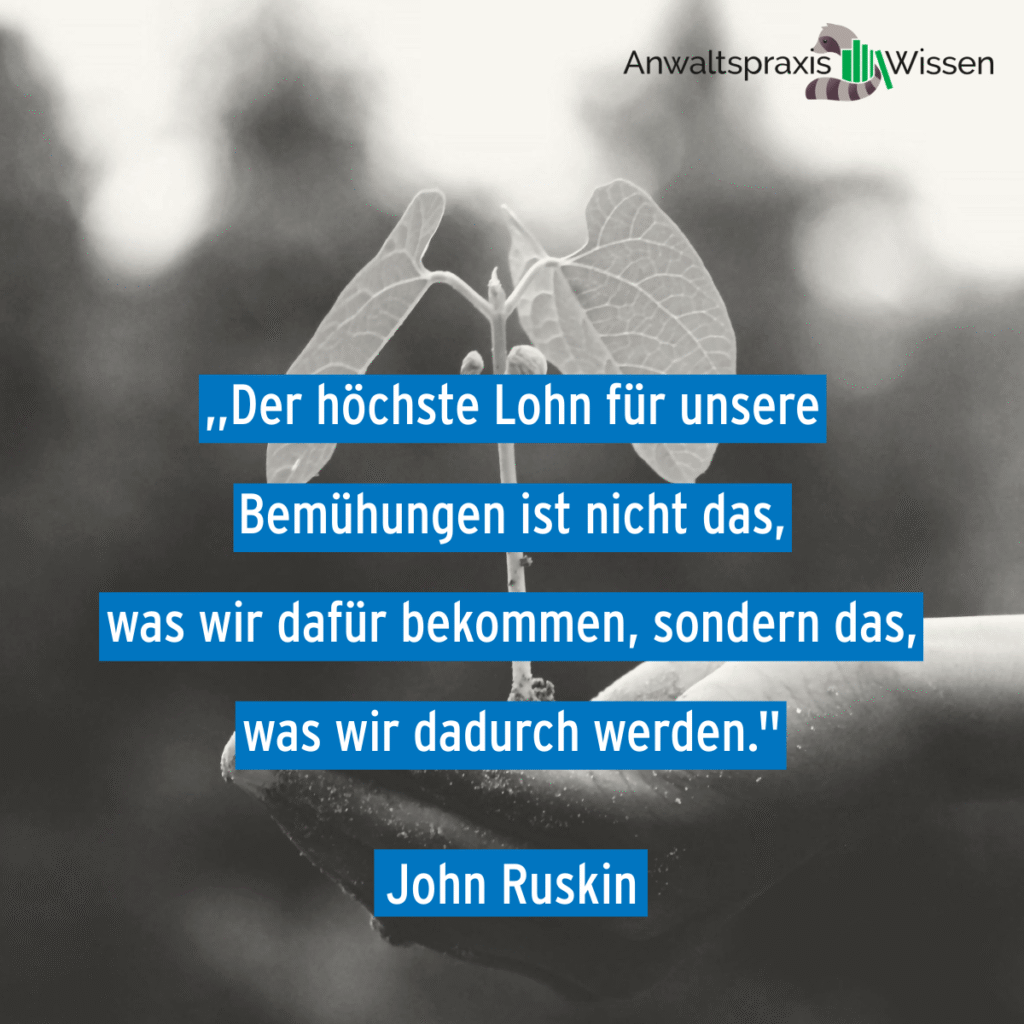

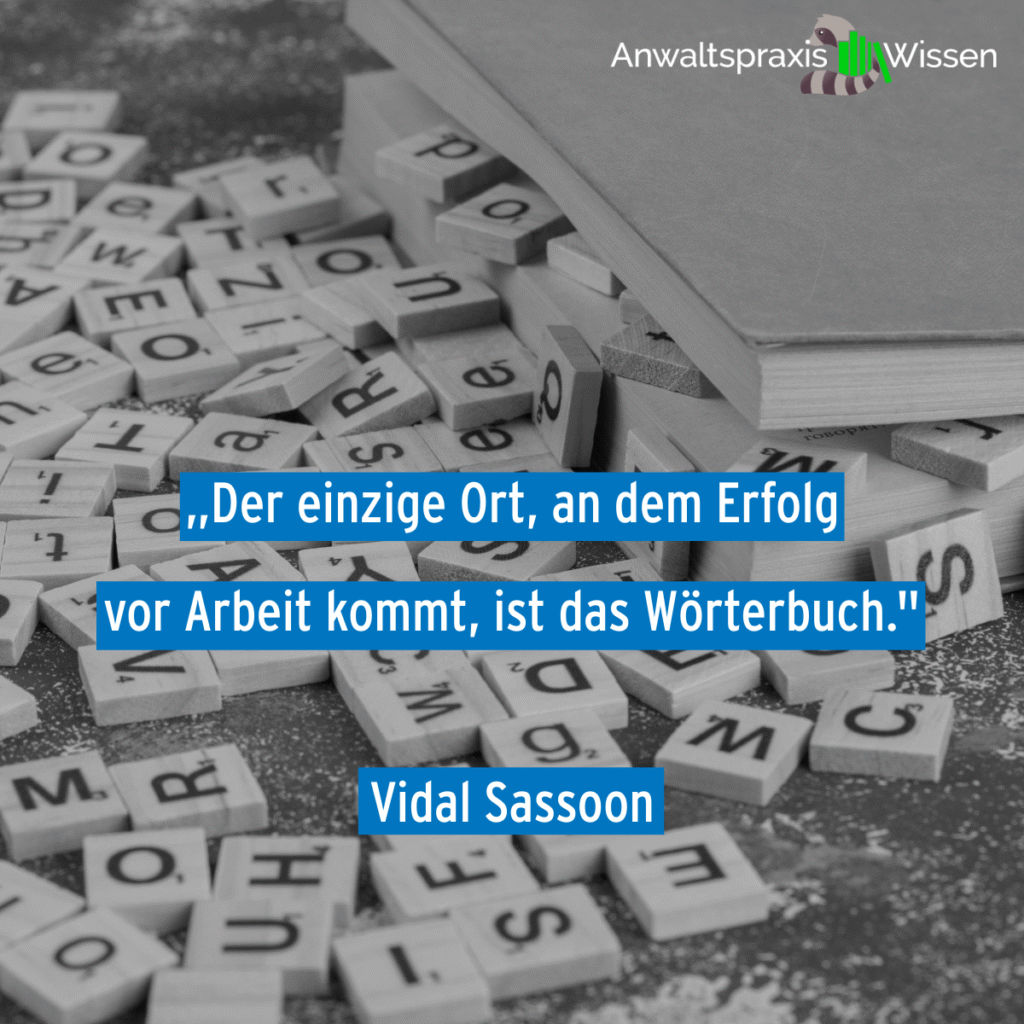
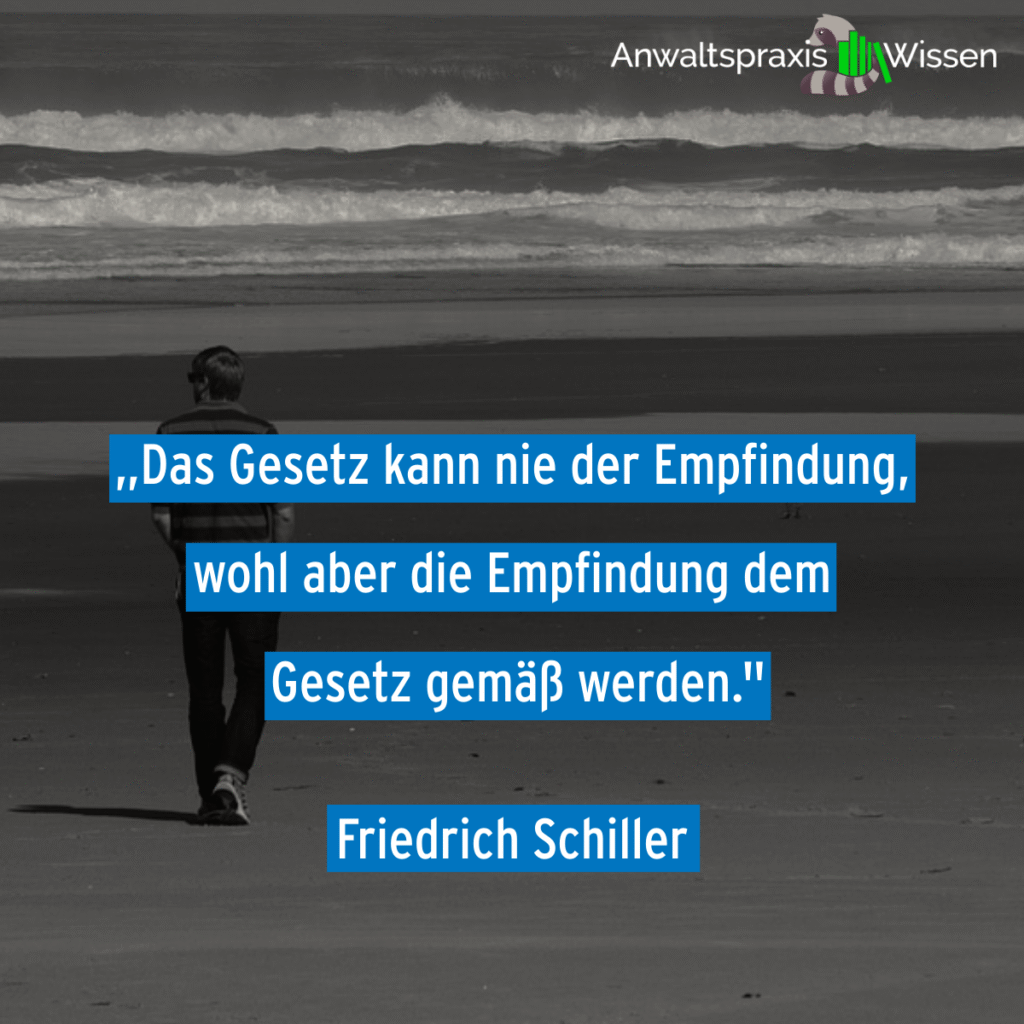
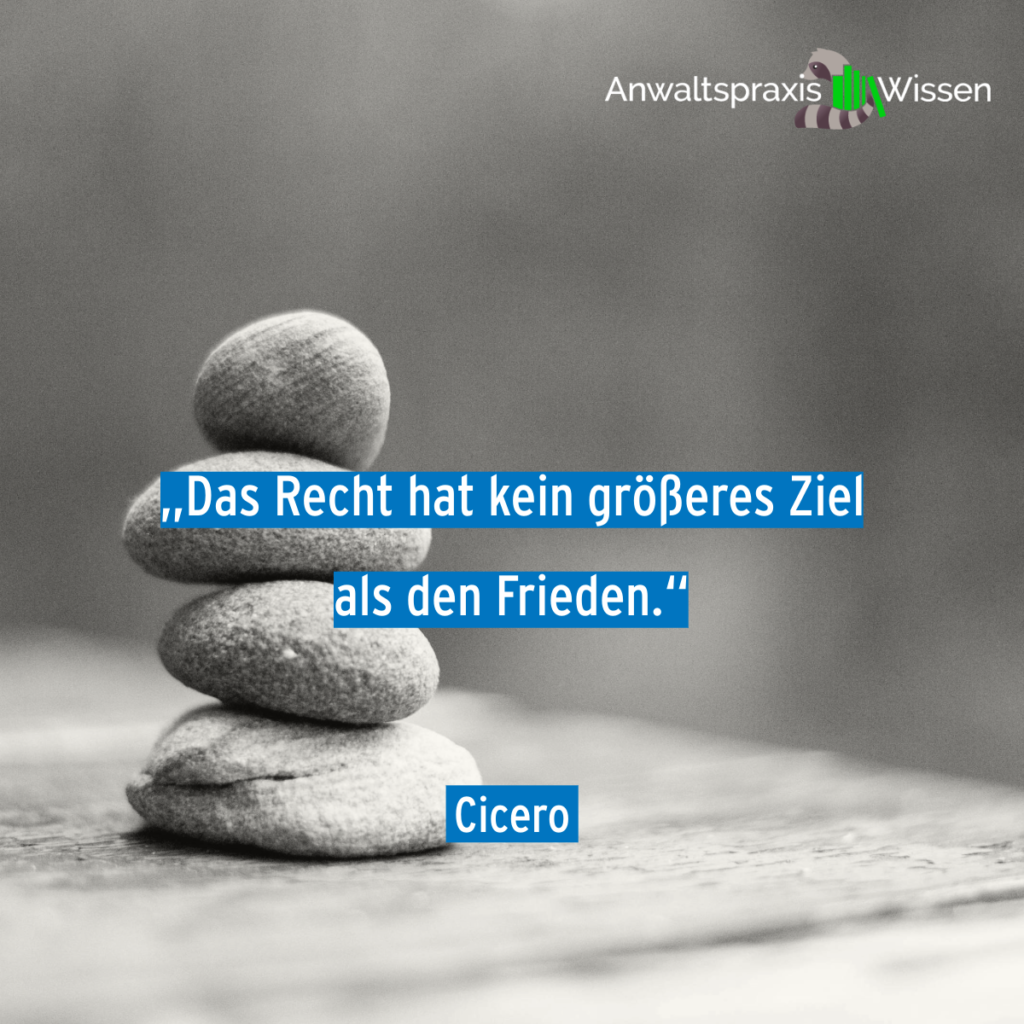

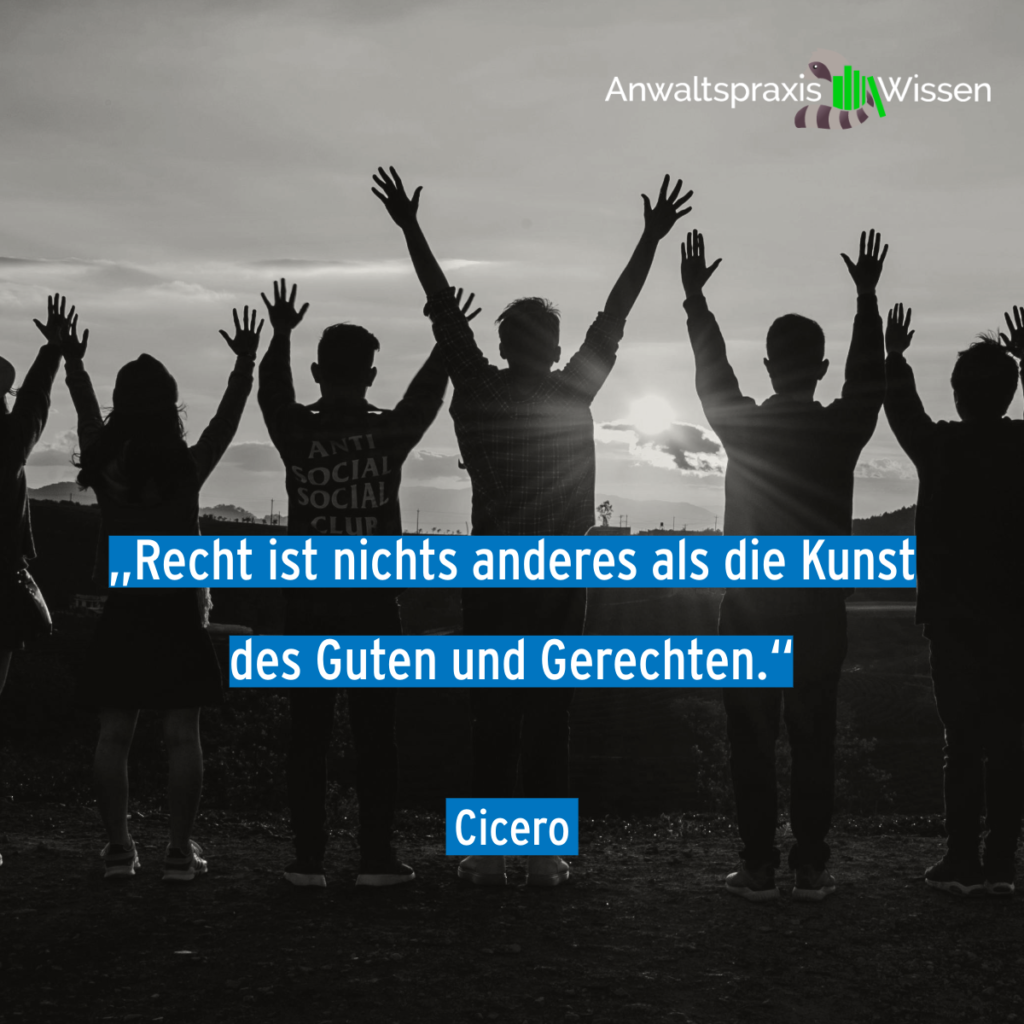
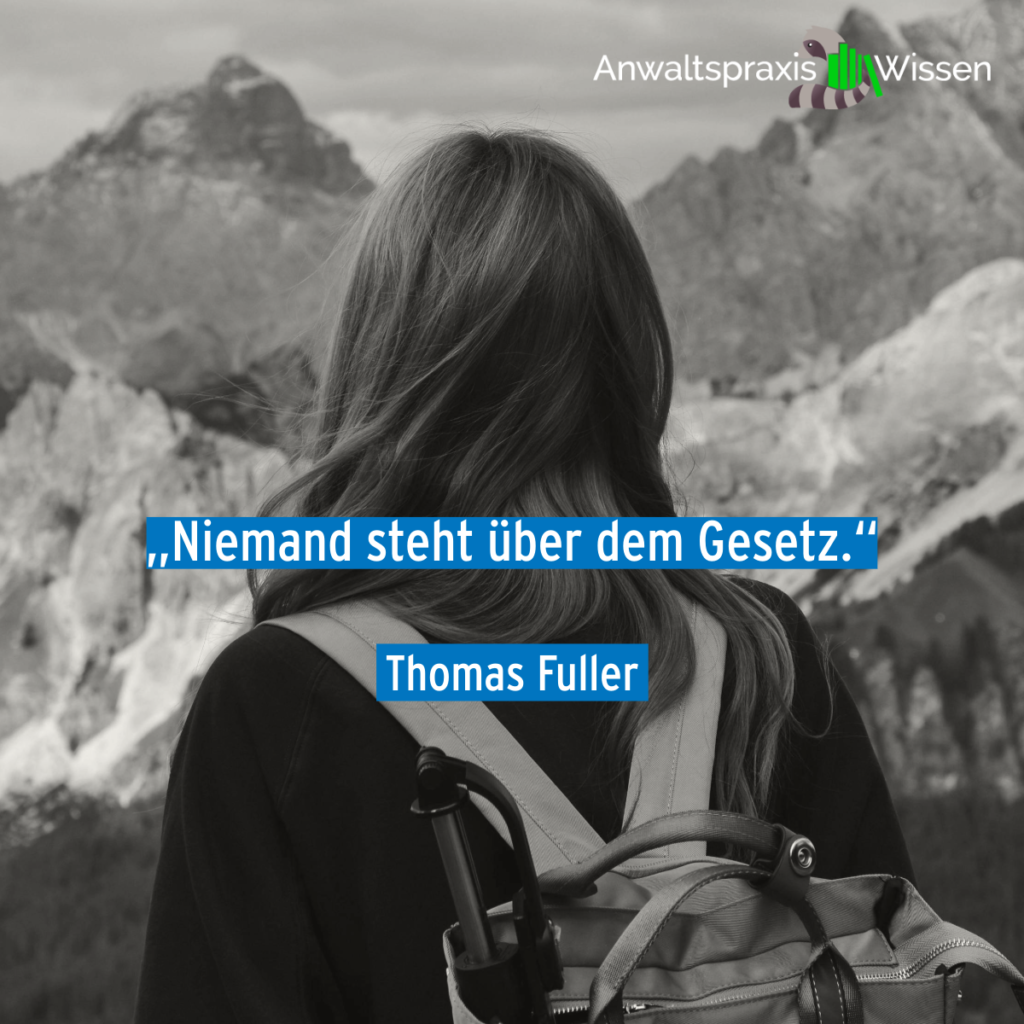
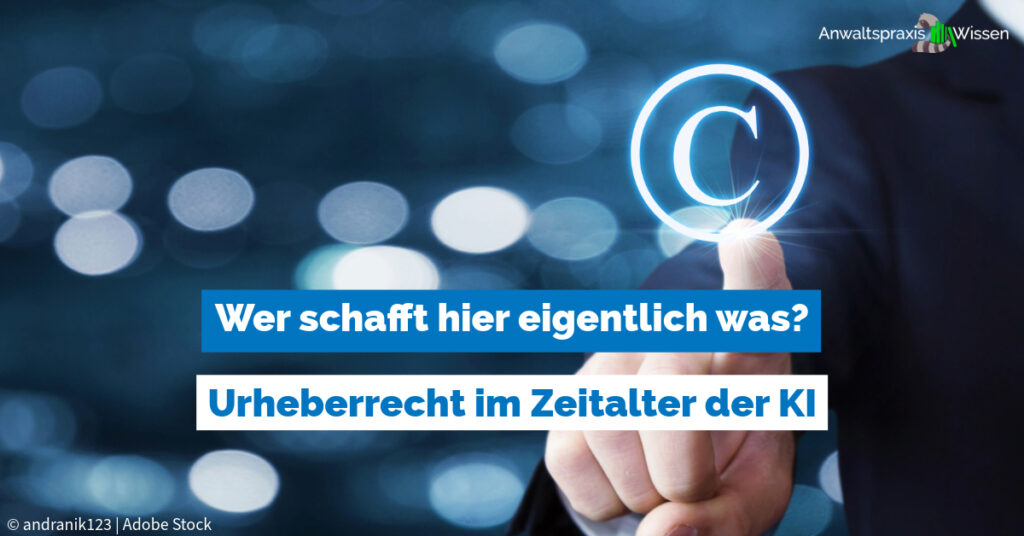

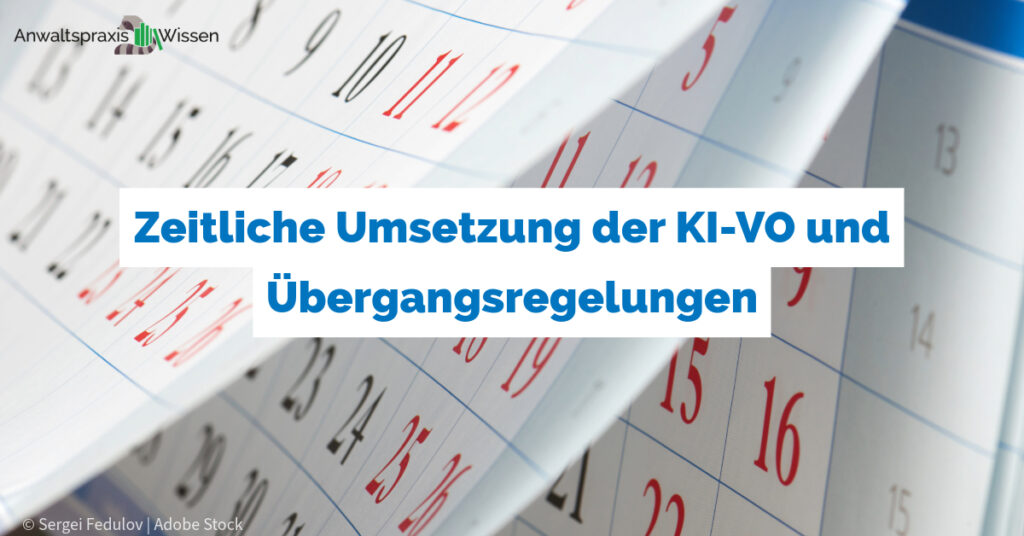




![Erbrecht im Gespräch: Kurze[s] Update: #15 Die Rechte des Erben vor dem Erbfall – mit Walter Krug](https://anwaltspraxis-magazin.de/wp-content/uploads/2025/05/Erbrecht-im-Gespraech-15-1024x536.jpeg)

