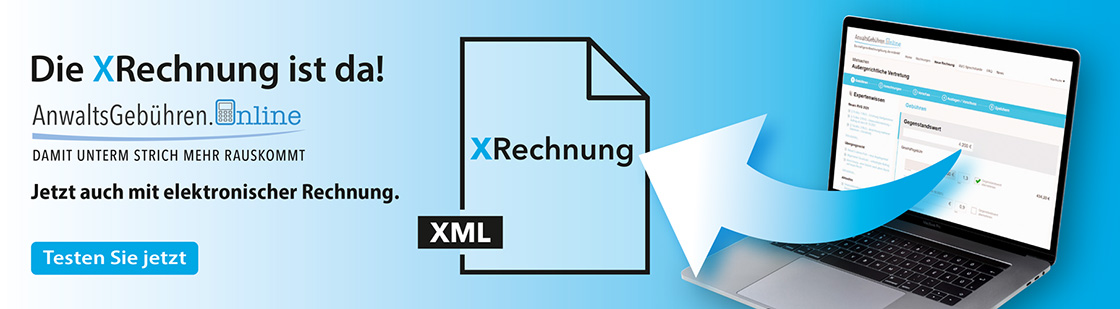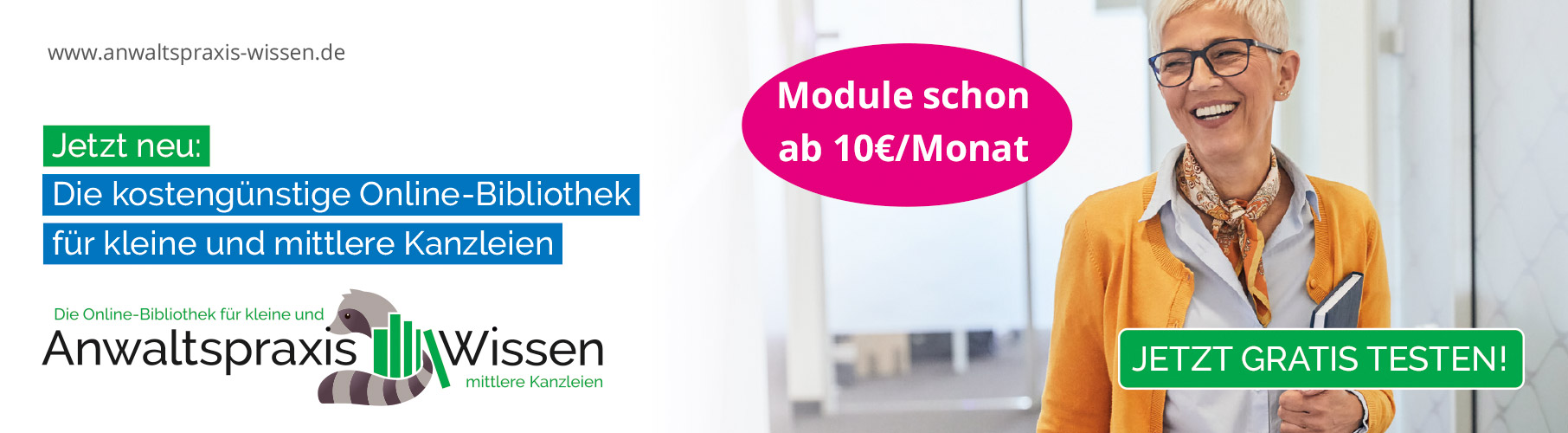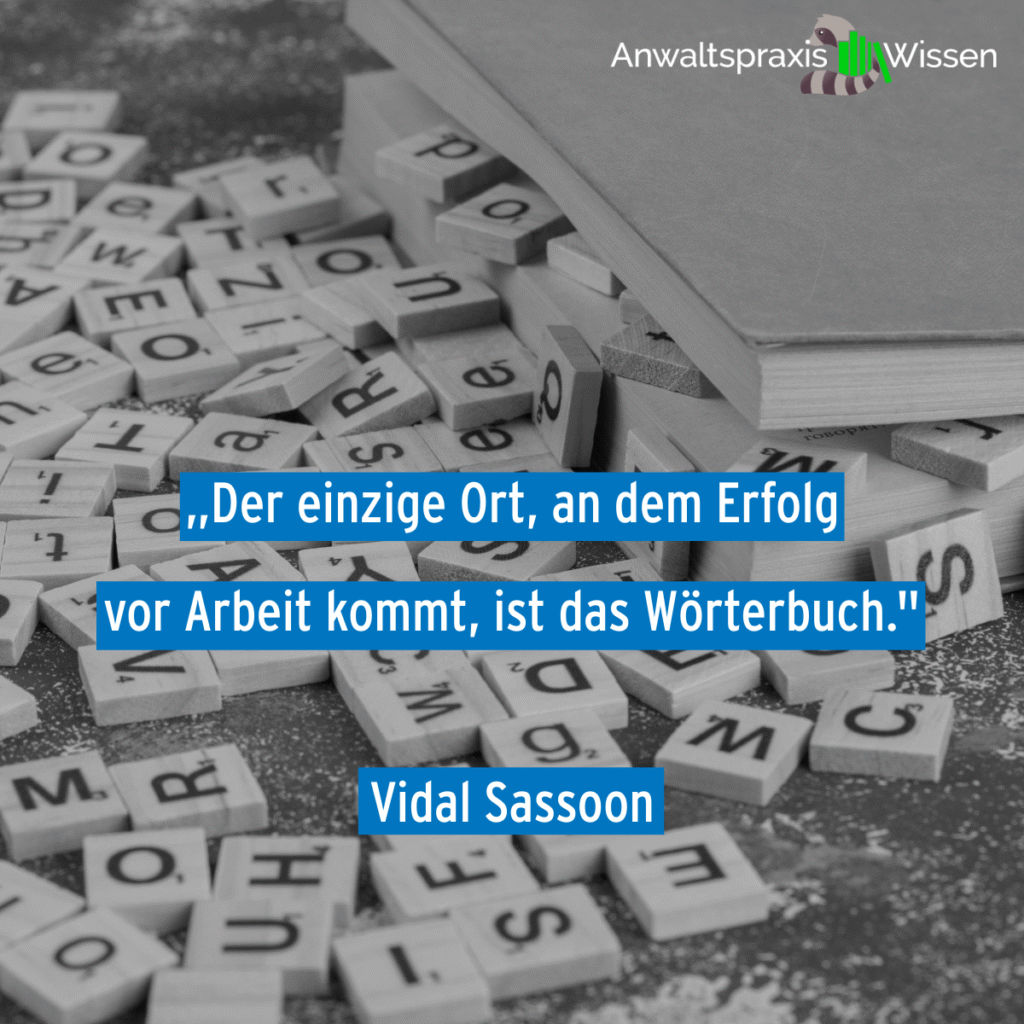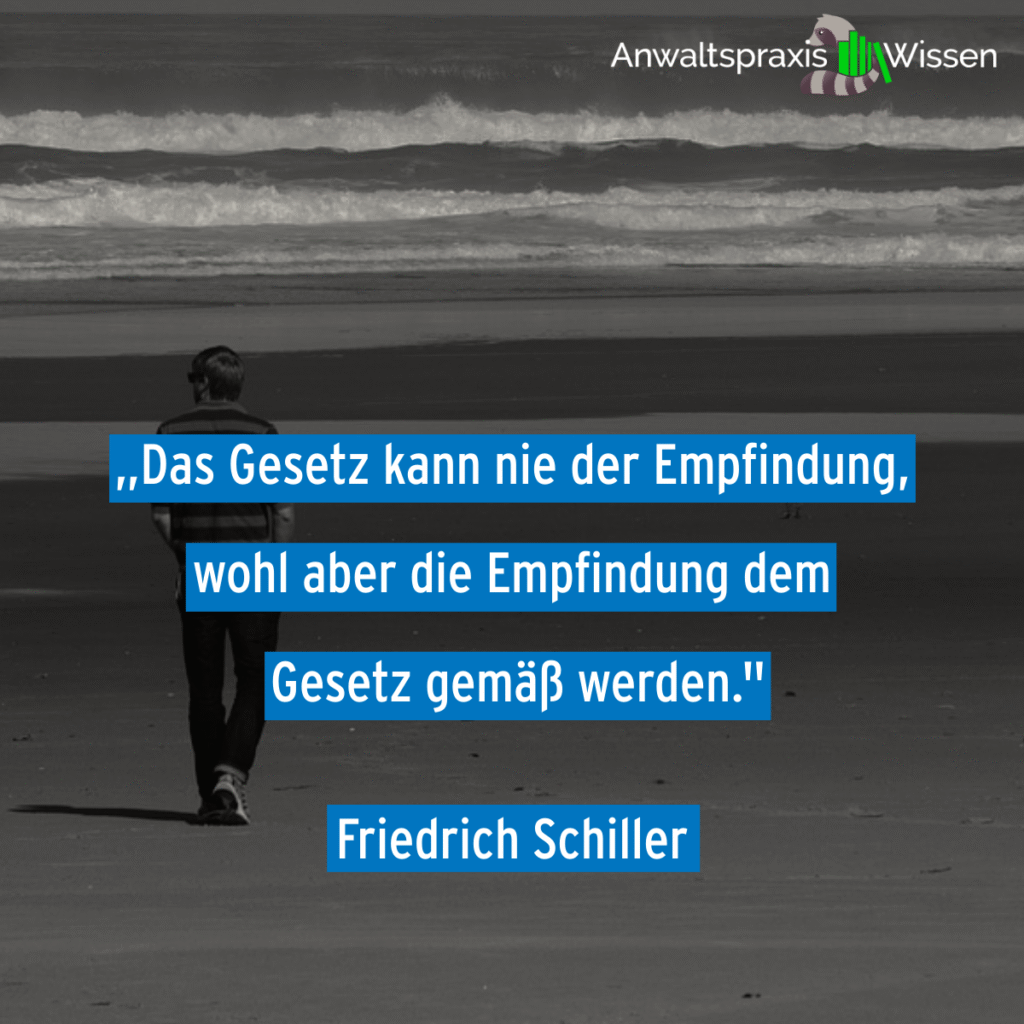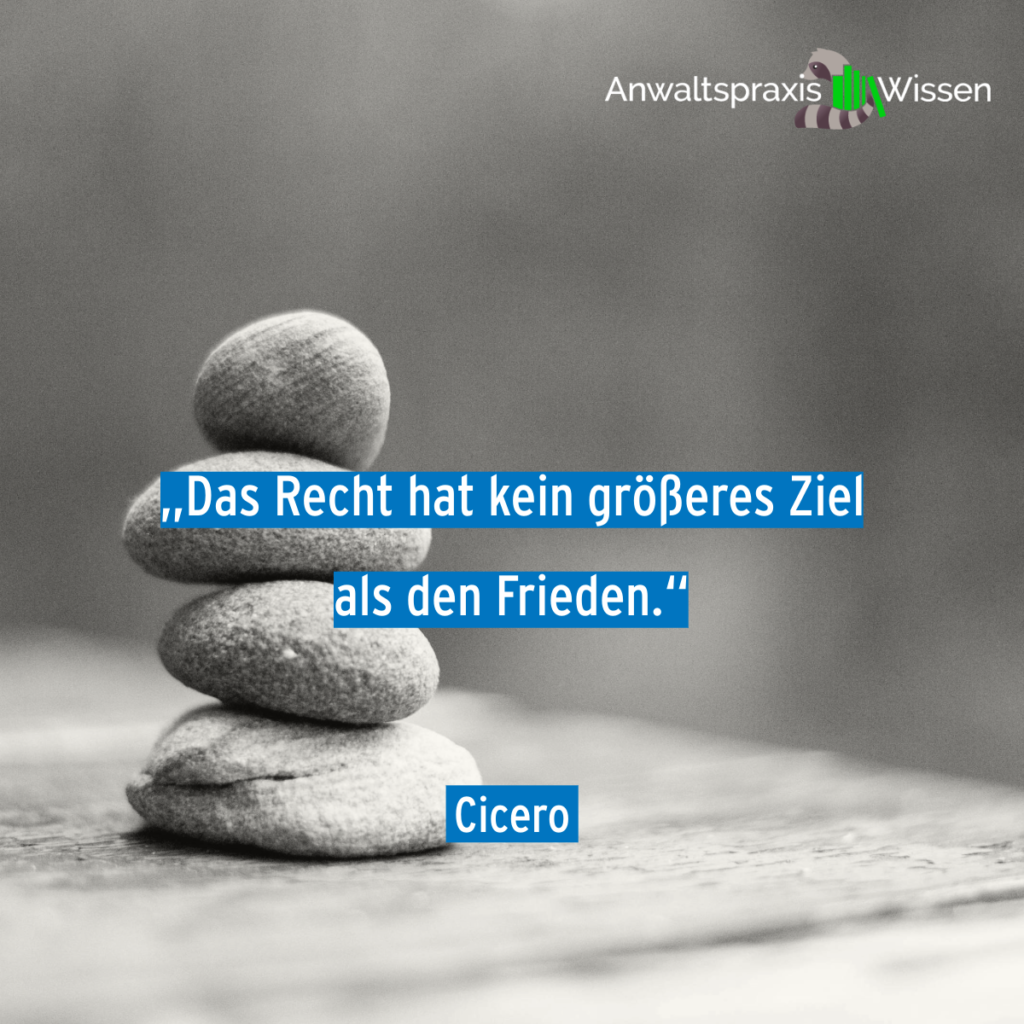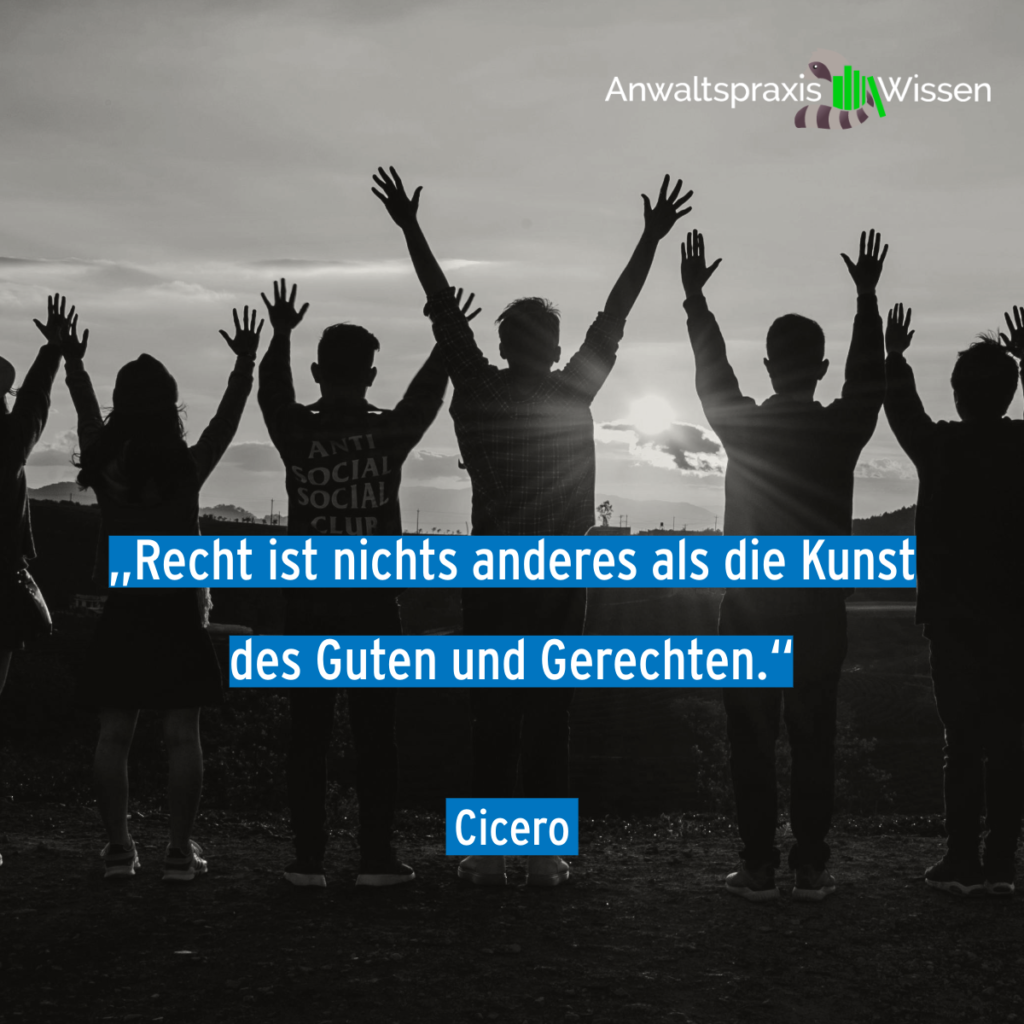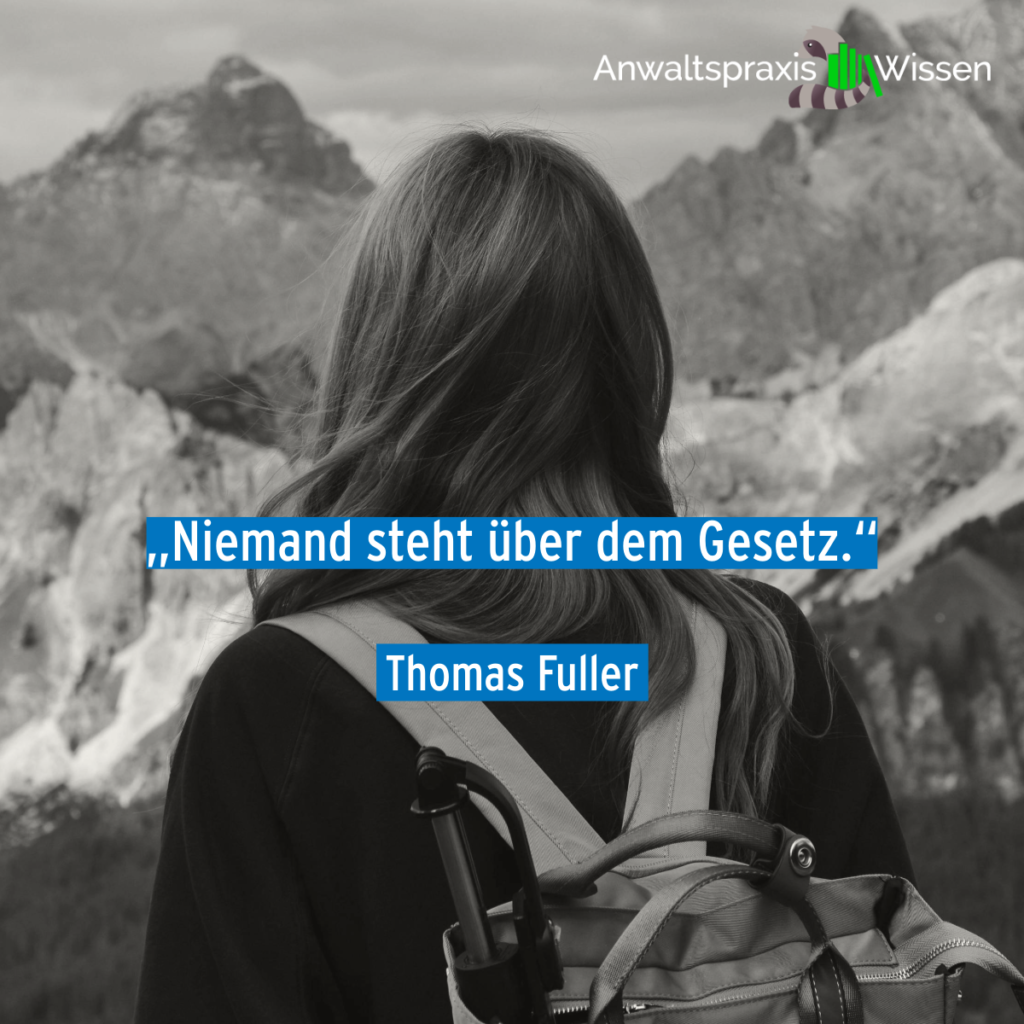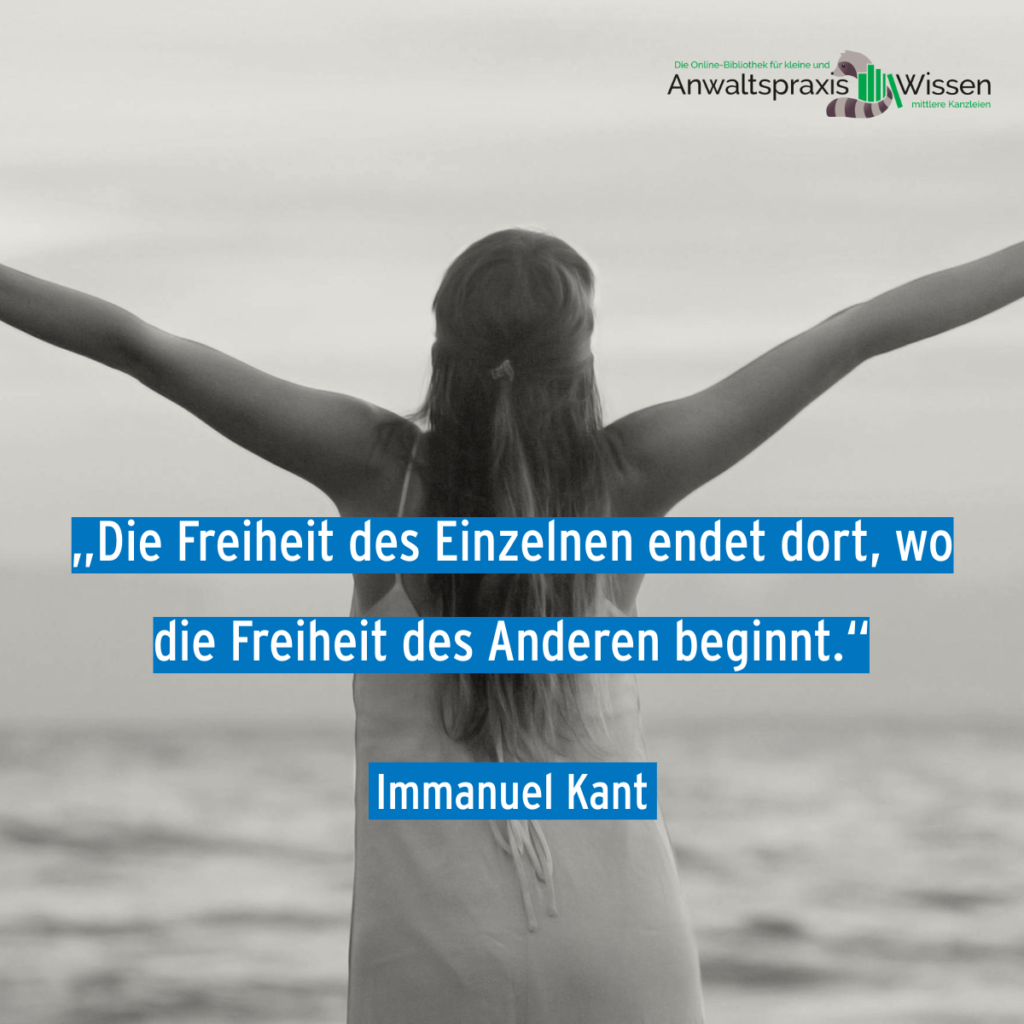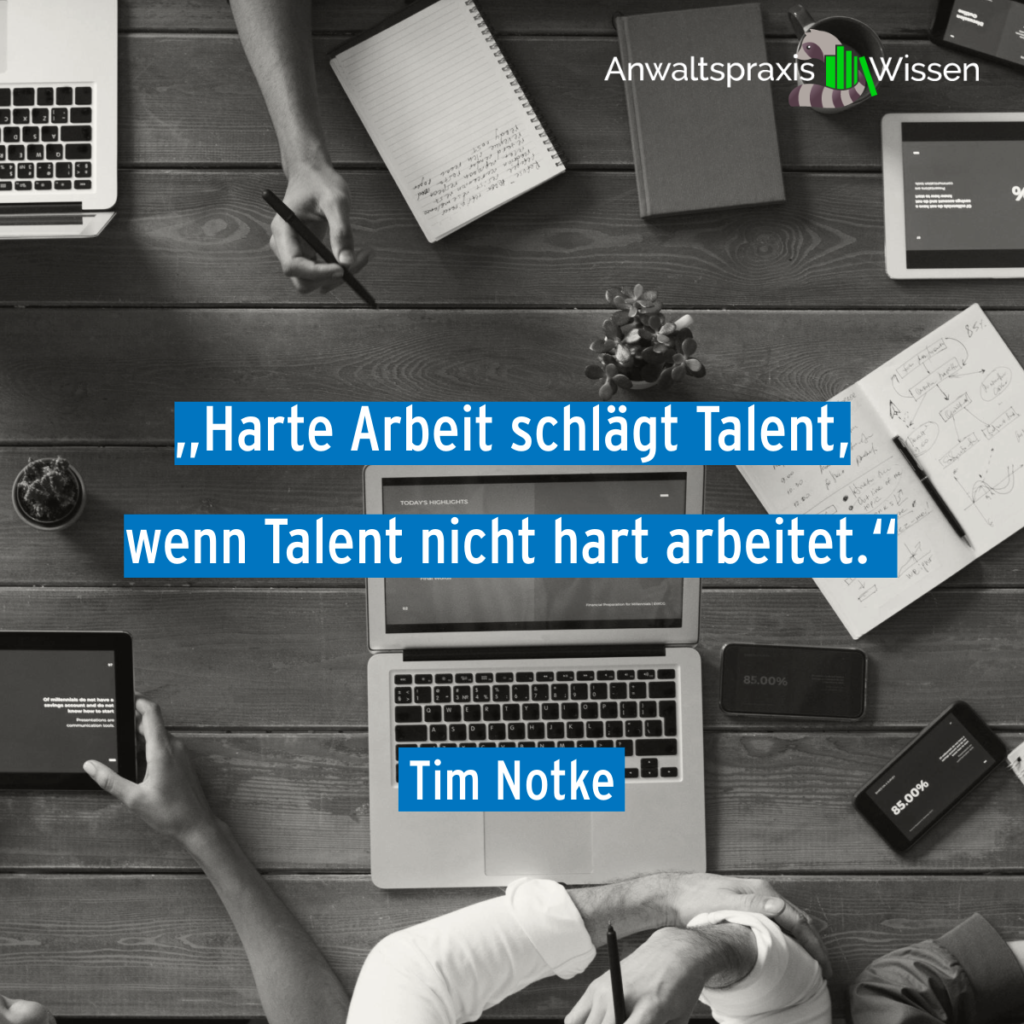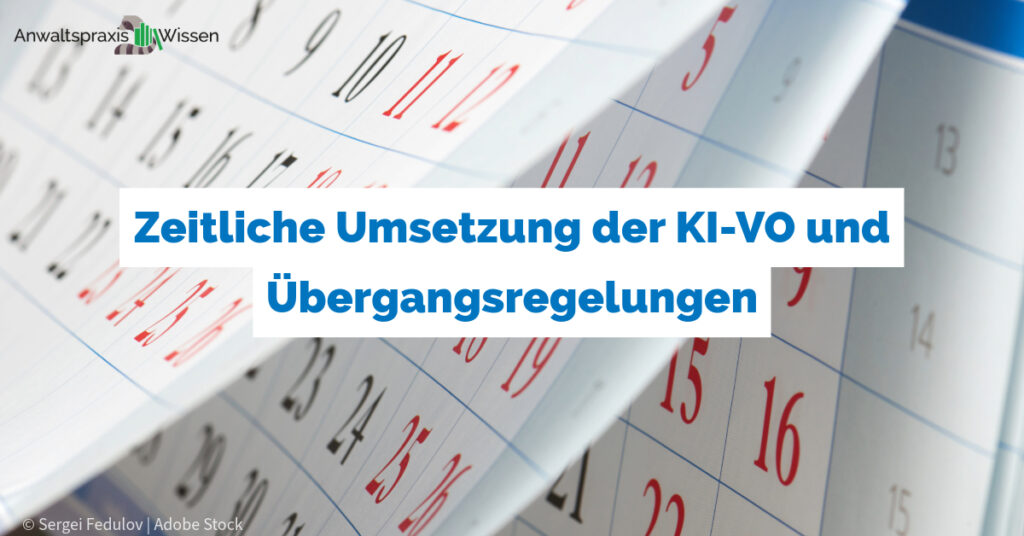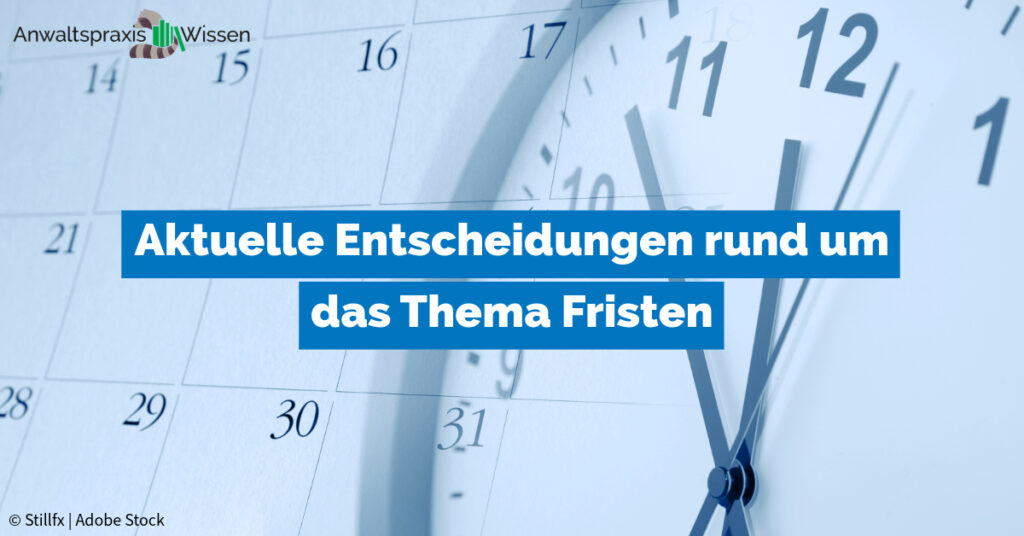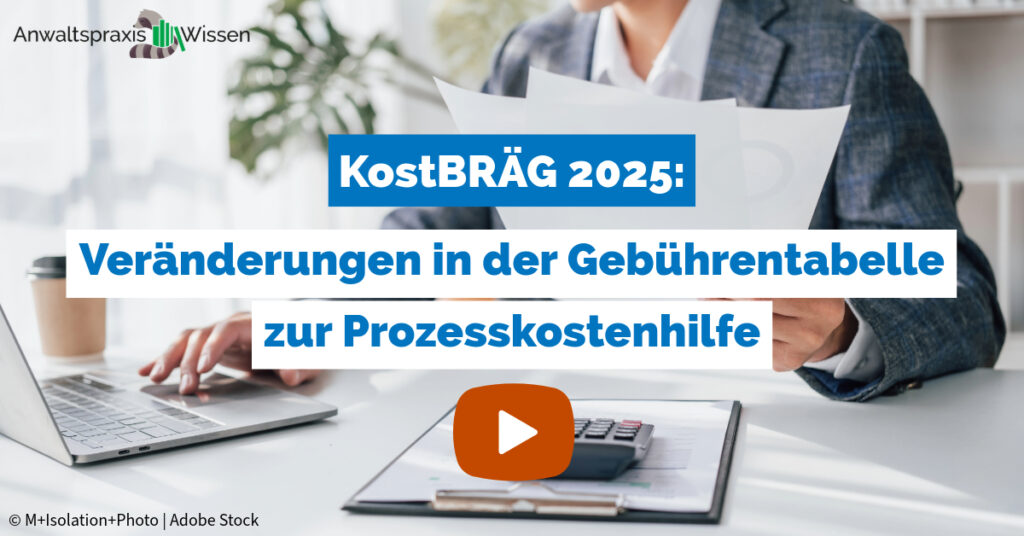1. Ein von einem Rechtsanwalt mit einfacher Signatur versehener und über das besondere elektronische Anwaltspostfach (beA) eingereichter Antrag auf Verlängerung der Beschwerdebegründungsfrist erfüllt auch dann die nach § 130d Satz 1 ZPO erforderliche elektronische Form, wenn er beim unzuständigen Ausgangsgericht eingegangen ist. Für die fristwahrende Wirkung kommt es hingegen darauf an, wann das Dokument beim zuständigen Gericht eingegangen ist.
2. Die postalische Weiterleitung eines beim unzuständigen Gericht ordnungsgemäß in elektronischer Form eingereichten Fristverlängerungsantrags führt nicht zur Formunwirksamkeit des Antrags. (Leitsatz des Gerichts)
I. Sachverhalt
Falsch adressierter Fristverlängerungsantrag
Die Rechtsanwältin beantragte in einem (familienrechtlichen) Verfahren für ihre Mandantin sechs Tage vor Fristablauf per beA, die Frist zur Beschwerdebegründung erstmals um einen Monat zu verlängern. Diesen Schriftsatz sandte sie nicht an das zuständige Beschwerdegericht, sondern an die erste Instanz. Die Geschäftsstelle druckte den Antrag aus und leitete ihn per Post an das OLG weiter. Dort kam er neun Tage später, drei Tage nach Ablauf der Begründungsfrist, an.
OLG verwirft die Beschwerde als verfristet
Das OLG hat die Beschwerde als verfristet als unzulässig verworfen. Der Wiedereinsetzungsantrag der Rechtsanwältin wurde wegen Anwaltsverschulden zurückgewiesen. Begründung: Selbst, wenn der Verlängerungsantrag noch rechtzeitig beim OLG eingegangen wäre, wäre er in jedem Fall nicht formgerecht – per beA – eingereicht worden, da er – unstreitig – in Papierform beim OLG eingegangen war. Die Rechtsanwältin habe auch nicht darauf vertrauen dürfen, dass das AG ihn elektronisch weiterleiten würde.
BGH gewährt Wiedereinsetzung
Der BGH hat im Rechtsbeschwerdeverfahren Wiedereinsetzung in den vorigen Stand gewährt.
II. Entscheidung
Postalische Weiterleitung hätte noch rechtzeitig eingehen müssen
Entgegen der Auffassung des OLG werde die Kausalität des – auch vom BGH bejahten – Anwaltsverschuldens für die Fristversäumung dadurch ausgeschlossen, dass bei im ordentlichen Geschäftsgang erfolgender postalischer Weiterleitung des beim AG als elektronisches Dokument per beA eingegangenen Fristverlängerungsantrags dieser noch vor Ablauf der Beschwerdebegründungsfrist beim OLG eingehen hätte müssen. Gehe ein fristgebundener Schriftsatz statt beim Rechtsmittelgericht bei dem erstinstanzlichen Gericht ein, sei dieses nach ständiger Rechtsprechung des BGH grundsätzlich verpflichtet, den Schriftsatz im ordentlichen Geschäftsgang an das Rechtsmittelgericht weiterzuleiten. Gehe der Schriftsatz so zeitig ein, dass die fristgerechte Weiterleitung an das Rechtsmittelgericht im ordentlichen Geschäftsgang ohne weiteres erwartet werden kann, darf der Beteiligte darauf vertrauen, dass der Schriftsatz noch rechtzeitig beim Rechtsmittelgericht eingeht. Geschieht dies tatsächlich nicht, wirkt sich das Verschulden des Beteiligten oder seines Verfahrensbevollmächtigten nicht mehr aus, so dass ihm Wiedereinsetzung in den vorigen Stand zu gewähren ist (vgl. BGH, Beschl. 27.7.2016 – XII ZB 203/15, FamRZ 2016, 1762 Rn 12 m.w.N.; Beschl. v. 20.4.2023 – I ZB 83/22 – MDR 2023, 932 Rn 14 m.w.N.). Gemessen daran habe die Rechtsanwältin darauf vertrauen dürfen, dass ihr Fristverlängerungsantrag bei einer Weiterleitung im ordentlichen Geschäftsgang innerhalb der Beschwerdebegründungsfrist beim OLG eingehe. Dahinstehen könne dabei, ob die Annahme des OLG zutreffe, dass die Antragstellerin eine elektronische Weiterleitung ihres Fristverlängerungsantrags nicht erwarten durfte. Denn nach den Feststellungen des OLG wäre im Rahmen eines ordentlichen Geschäftsgangs zu erwarten gewesen, dass bei postalischer Weiterleitung des am 13.6.2023 beim AG als elektronisches Dokument per beA eingegangenen Fristverlängerungsantrags dieser am 19.6.2023 und damit noch vor Ablauf der Beschwerdebegründungsfrist beim OLG eingegangen wäre. Damit entfalle die Kausalität des anwaltlichen Verschuldens für die Fristversäumnis.
Wahrt bloße postalische Weiterleitung die Frist?
Ob die postalische Weiterleitung eines als elektronisches Dokument eingegangenen Schriftsatzes zu einem fristwahrenden Eingang des Fristverlängerungsantrags beim OLG führen kann, sei allerdings umstritten (s. einerseits verneinend OLG Bamberg FamRZ 2022, 1382, 1384; VGH Baden-Württemberg, Beschl. v. 6.9.2022 – 12 S 1365/22 zu § 55d VwGO; so wohl auch jurisPK-ERV/Jansen, 2. Aufl. § 233 ZPO Rn 87; Anders/Gehle/Göertz, ZPO 82. Aufl. § 519 Rn 5; Musielak/Borth/Frank/Borth, FamFG 7. Aufl. § 14 Rn 2; andererseits bejahend Bacher, MDR 2022, 1441, 1443; so wohl auch Müller, NVwZ 2022, 1150 f. bei elektronischer Weiterleitung). Der BGH hat sich der letztgenannten Auffassung als zutreffend angeschlossen. Das begründet der BGH umfassend mit dem Sinn und Zweck der gesetzlichen Regelungen. Es sei irrelevant, in welcher Form ein Schriftsatz von Gericht zu Gericht weitergereicht werde Es genüge den Anforderungen des § 130d Satz 1 ZPO, wenn der Schriftsatz per beA bei einem unzuständigen Gericht eingehe. Aus dem Wortlaut der §§ 130a und 130d ZPO ergebe sich nicht hervor, dass der Schriftsatz in elektronischer Form beim zuständigen Gericht eingehen müsse. Sinn und Zweck der Regelungen sei es nur, dass der Schriftsatz als elektronisches Dokument versendet werde. Es gehe um die aktive Nutzungspflicht der Beteiligten, sie sollten eine sichere Übermittlungsverbindung nutzen. Der Gesetzgeber habe auf die hinter den Erwartungen zurückgebliebene Nutzung des elektronischen Rechtsverkehrs mit den Gerichten reagieren wollen. Ziel sei es gewesen war, den elektronischen Rechtsverkehr auf prozessualem Gebiet zu verbessern, die Zugangshürden für die elektronische Kommunikation mit der Justiz zu senken und das Nutzervertrauen im Umgang mit dem neuen Kommunikationsweg zu stärken (vgl. BT-Drucks 17/12634 S. 20). Diesem Gesetzeszweck würde es widersprechen, wenn durch die Verpflichtung zur aktiven Nutzung der elektronischen Kommunikation gegenüber dem bisherigen Recht der Zugang zu den Gerichten erschwert und die bis dahin bestehenden Verfahrensrechte der Beteiligten eingeschränkt würden.
III. Bedeutung für die Praxis
Überzeugend begründet
M.E. ist die Entscheidung, die auch in anderen Verfahrensarten Bedeutung haben kann, zu begrüßen. Der BGH hat seine Auffassung überzeugend begründet, denn die Neuregelungen hatten nicht das Ziel, den Zugang zu den Gerichten (noch) weiter einzuschränken. Die Rechtsanwältin durfte also davon ausgehen, dass der Fristverlängerungsantrag trotz der Einreichung beim unzuständigen AG rechtzeitig beim OLG eingeht. Dieses hätte dem Antrag auch stattgeben müssen. Handelt es sich – wie hier – um einen ersten Fristverlängerungsantrag, der auf erhebliche Gründe gestützt ist, darf der Antragsteller auf die Bewilligung der Fristverlängerung vertrauen. Insoweit reicht ein – vorliegend erfolgter bloßer – Hinweis auf eine Arbeitsüberlastung aus, ohne dass es einer weiteren Substantiierung bedarf (vgl. BGH, Beschl. v. 31.1.2018 – XII ZB 565/16, FamRZ 2018, 841 Rn 19 m.w.N.).