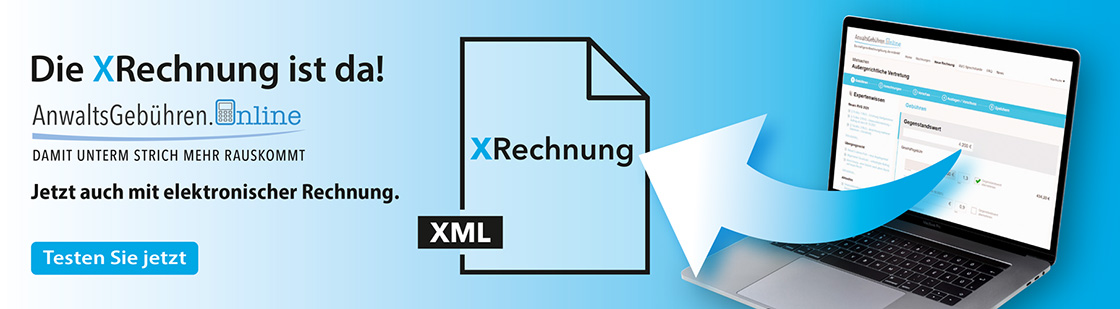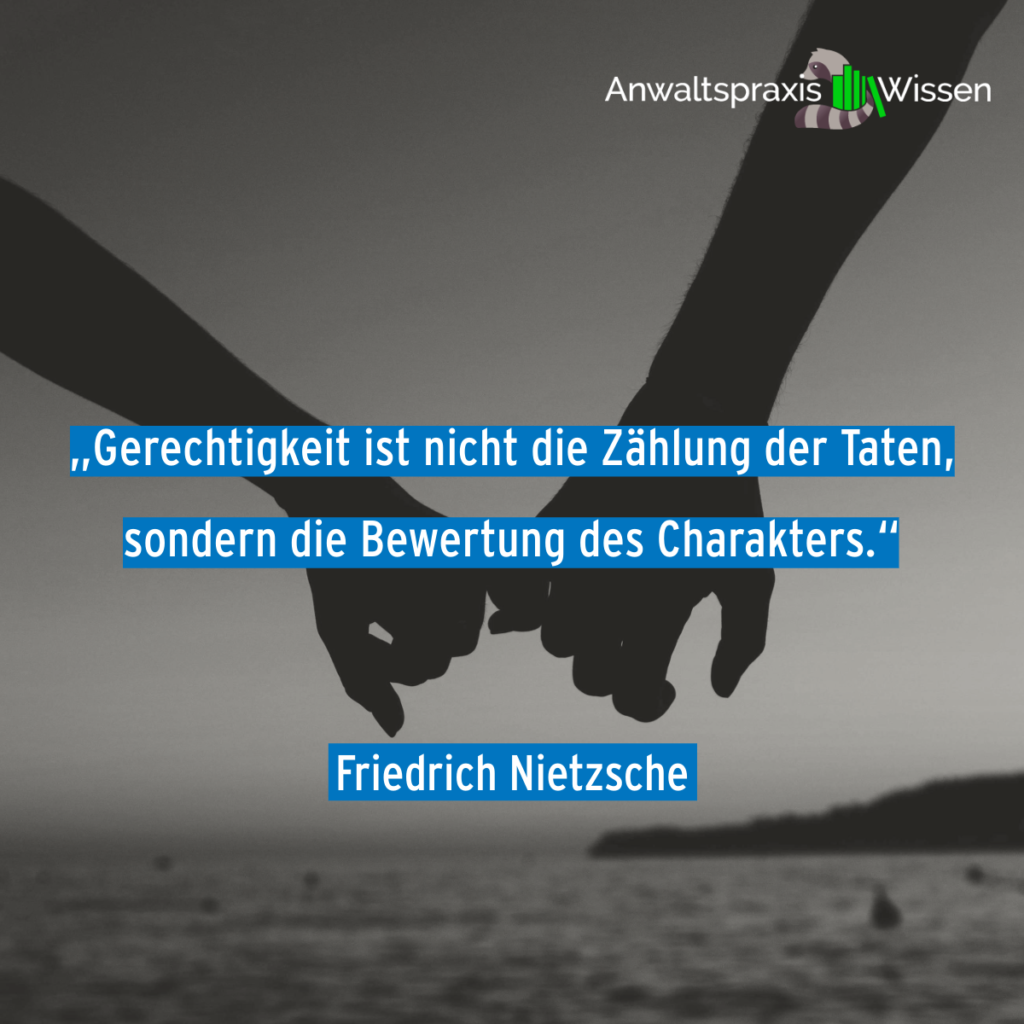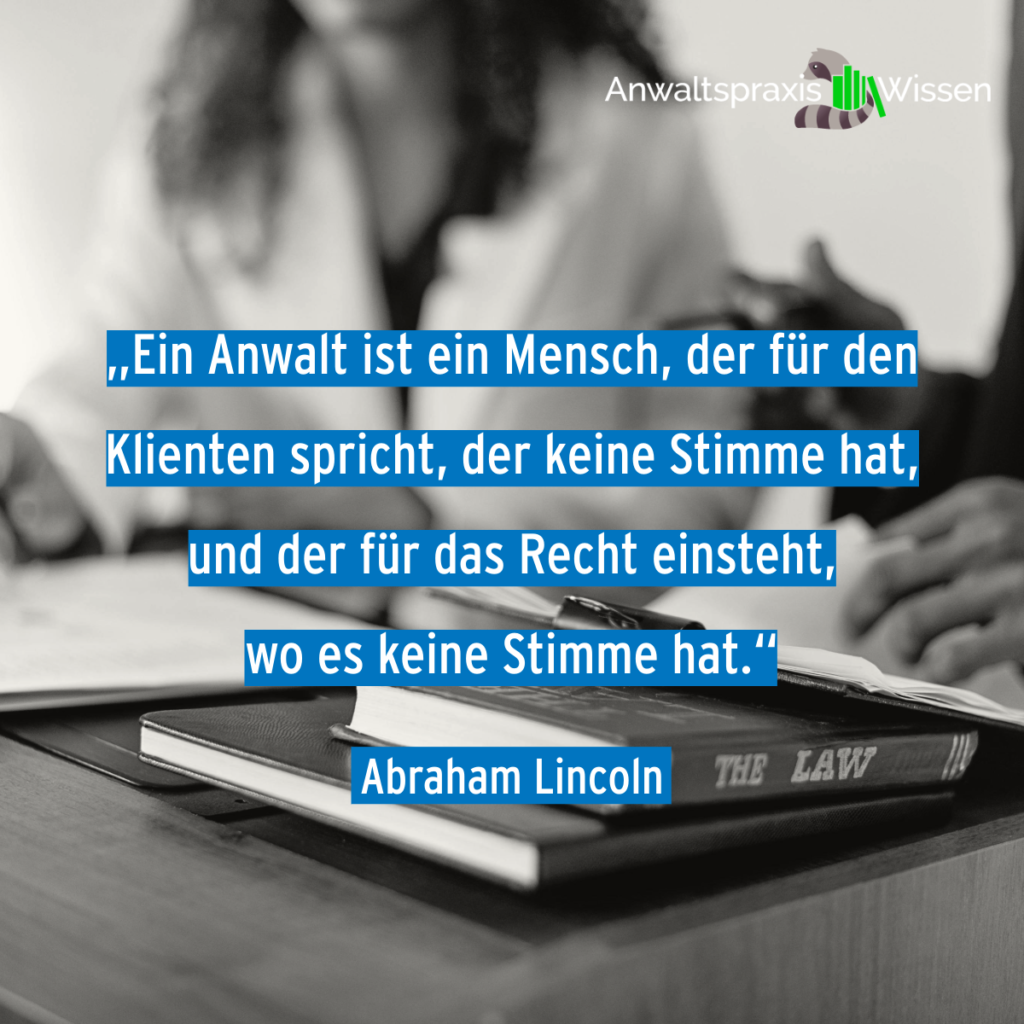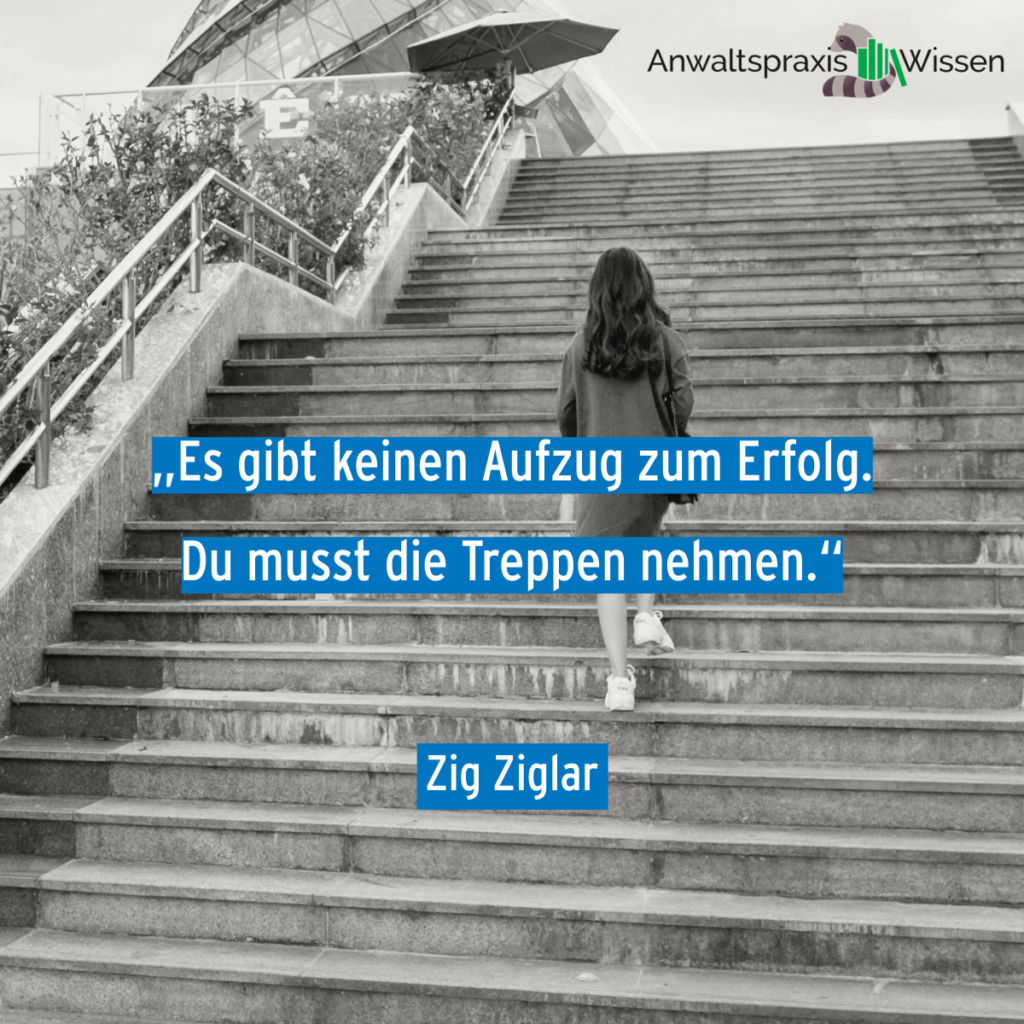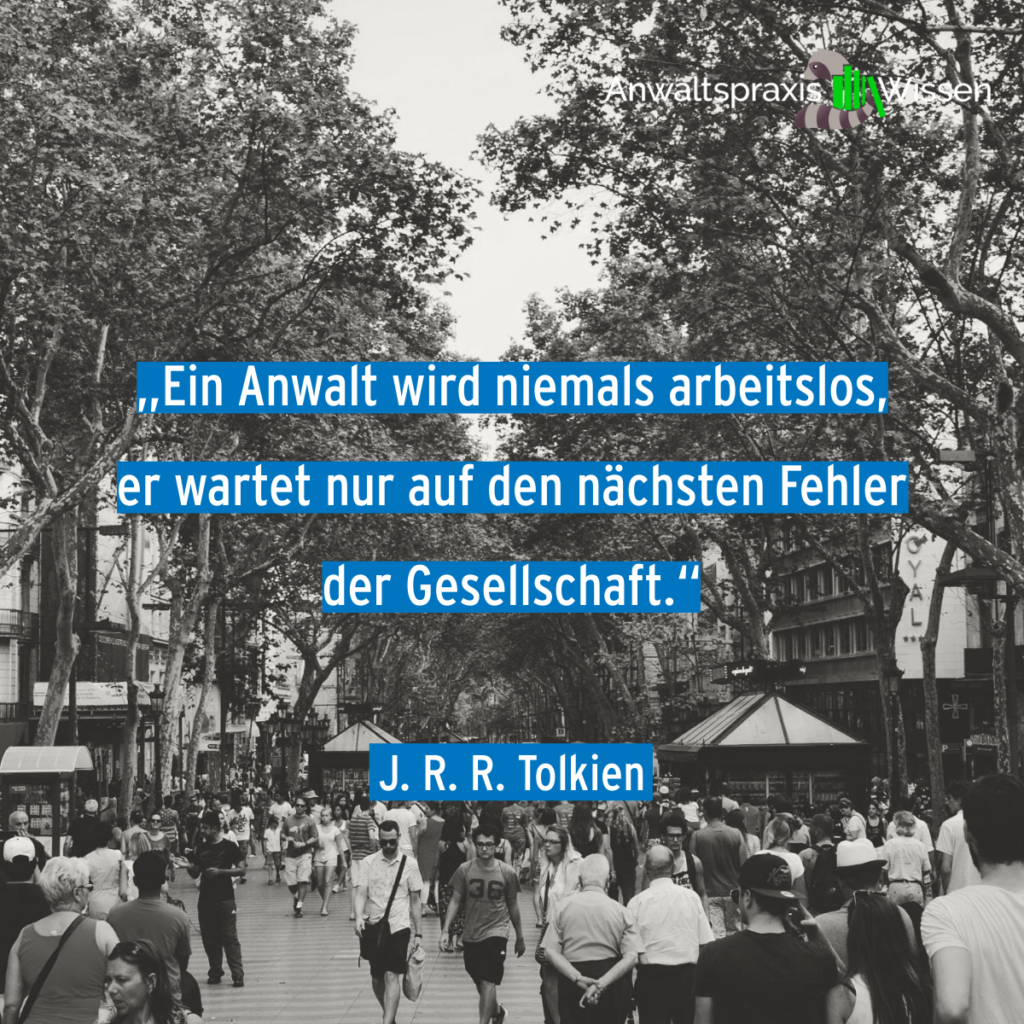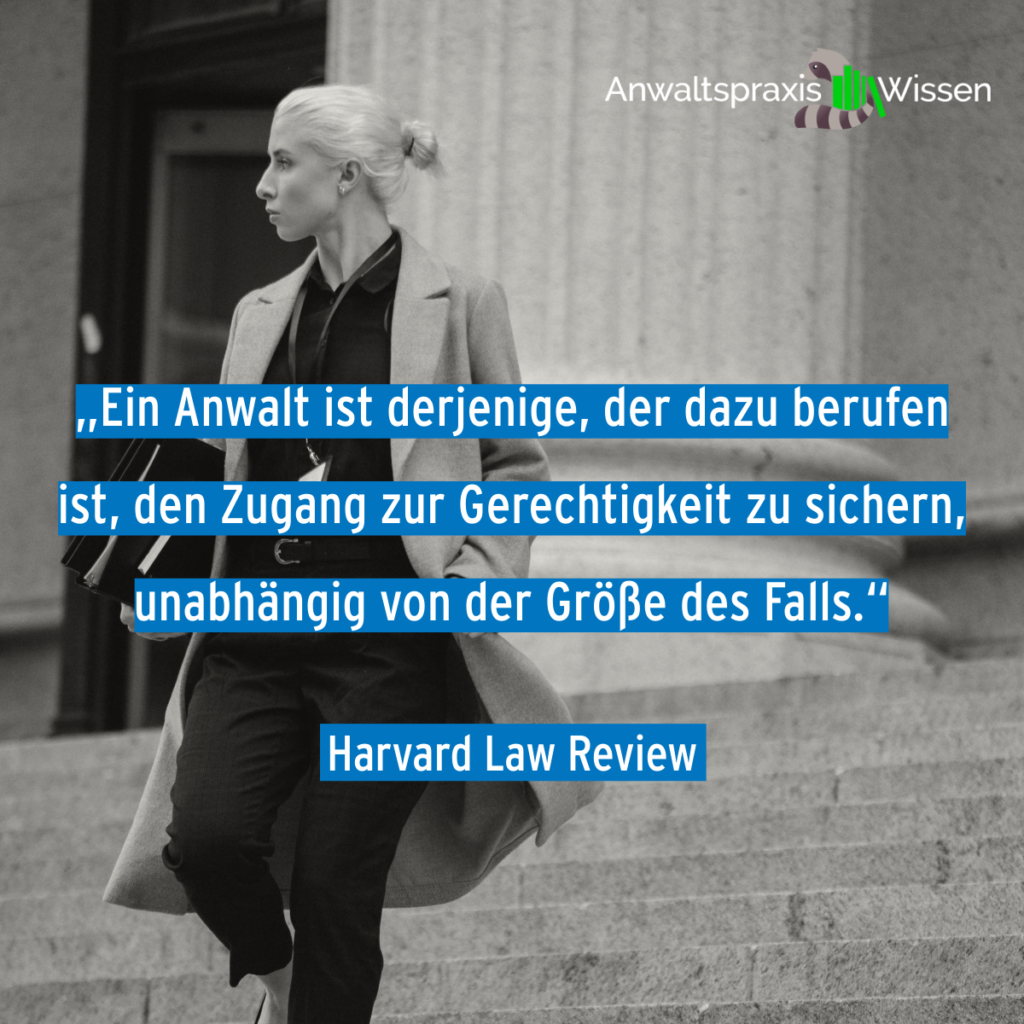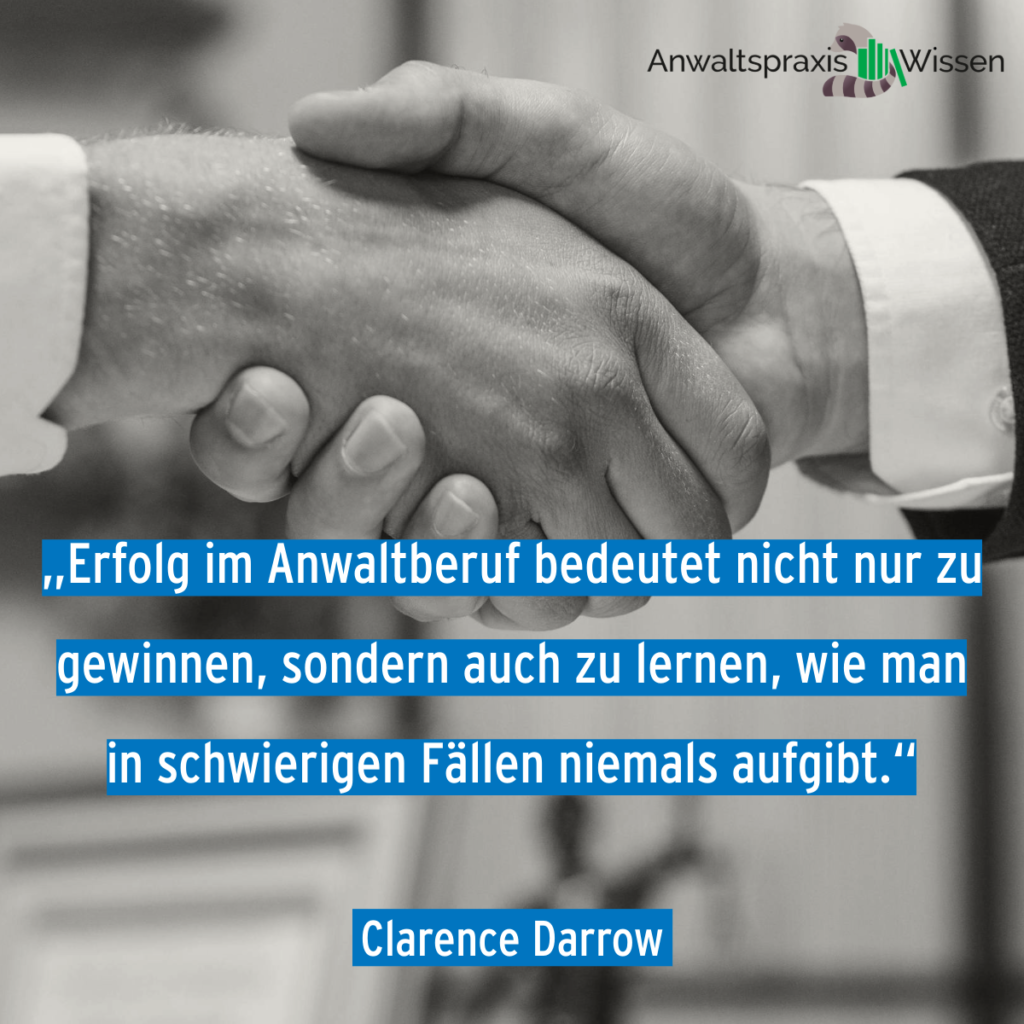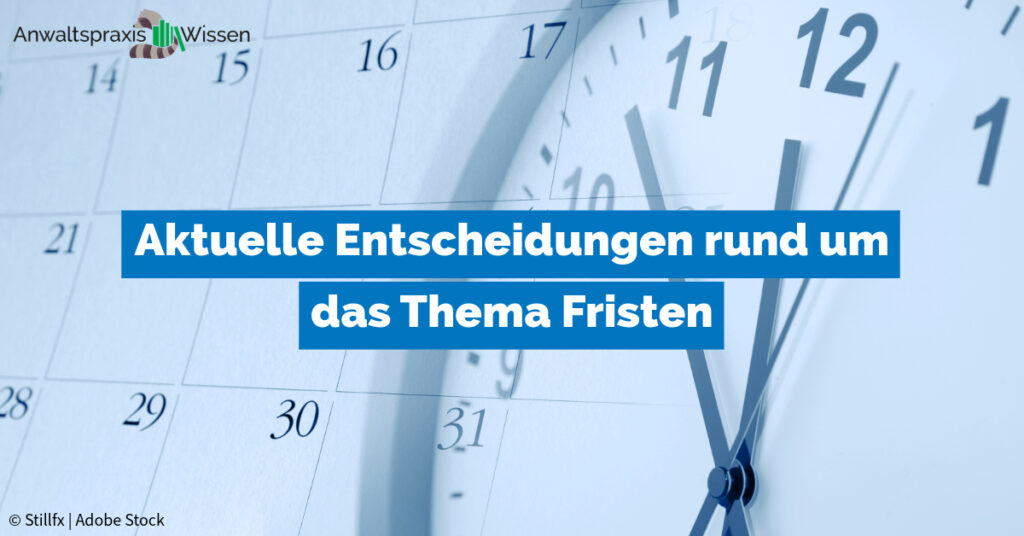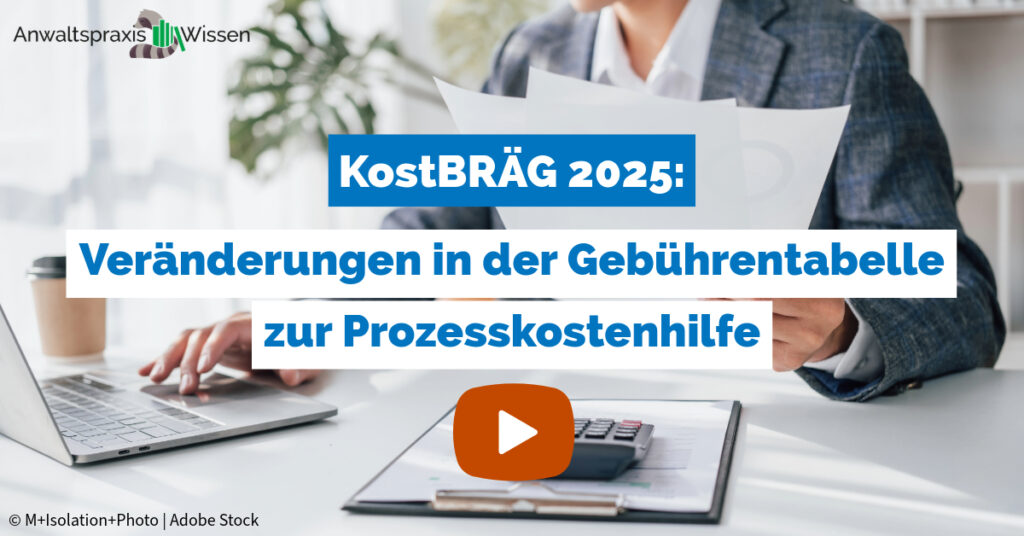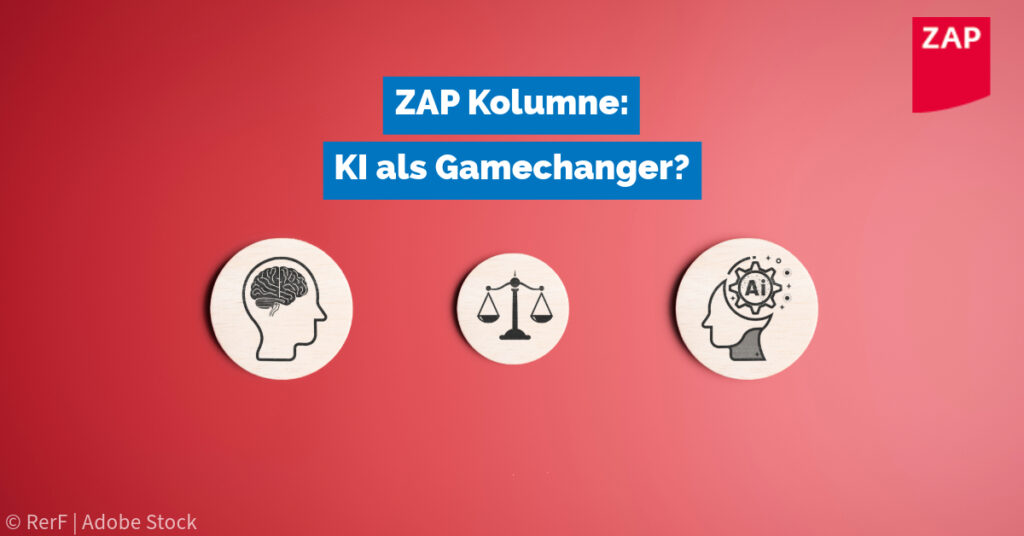Ein verständigungsbasiertes Geständnis ist zwingend durch Beweiserhebung in der Hauptverhandlung auf seine Richtigkeit zu überprüfen.
(Leitsatz des Verfassers)
I. Sachverhalt
Verurteilung auf der Grundlage eines verständigungsbasierten Geständnisses
Das AG hat den Angeklagten wegen Vorenthaltens und Veruntreuens von Arbeitsentgelt zu einer Gesamtfreiheitsstrafe verurteilt. Vorausgegangen war eine Verständigung zwischen dem Gericht und den Verfahrensbeteiligten gem. § 257c Abs. 1 S. 2 StPO. Der Vorsitzende hatte für den Fall einer geständigen Einlassung dem Angeklagten eine Gesamtfreiheitsstrafe zwischen einem Jahr und einem Jahr und drei Monaten zugesichert, die zur Bewährung ausgesetzt werden solle. Der Angeklagte und der Vertreter der Staatsanwaltschaft stimmten der Verständigung zu. Der Pflichtverteidiger gab für den Angeklagten dann folgende Erklärung ab: „Herr D bestätigt die Tatvorwürfe aus der Anklage … Herr D war Geschäftsführer der Firma und beschäftigte viele Arbeitnehmer aus Osteuropa. Ob dieser Personenkreis unternehmerisch tätig war oder nicht, war ihm nicht wichtig … Ihn hat nicht interessiert, ob die Arbeitnehmer anzumelden sind oder dies bereits geschah. Er hat sich um die Dinge nicht gekümmert, er nahm die Konsequenzen in Kauf … Der Tatvorwurf wird als bestätigt eingeräumt …“. Der Angeklagte erklärte: „Das ist richtig so.“ Eine Beweisaufnahme zur Überprüfung der Einlassung fand dann nicht mehr statt. Die vom Angeklagten gegen das Urteil des AG eingelegte Sprungrevision hat das OLG als unbegründet verworfen. Die Verfassungsbeschwerde des Angeklagten hatte Erfolg.
II. Entscheidung
Verstoß gegen faires Verfahren
Die Entscheidungen des AG und des OLG verletzen nach Auffassung des BVerfG den Angeklagten in seinem Recht auf ein faires Verfahren aus Art. 2 Abs. 1 i.V.m. mit Art. 20 Abs. 3 GG. § 257c Abs. 1 S. 2 StPO schließe jede Disposition über Gegenstand und Umfang der dem Gericht von Amts wegen obliegenden Pflicht zur Aufklärung des mit der Anklage vorgeworfenen Geschehens aus. Eine Verständigung kann niemals als solche die Grundlage eines Urteils bilden. Weiterhin maßgeblich bleibe allein und ausschließlich die – ausreichend fundierte – Überzeugung des Gerichts von dem von ihm festzustellenden Sachverhalt.
Mindestanforderungen an die Wahrheitserforschung verkannt
Das AG habe bei der Sachverhaltsaufklärung und der Beweiswürdigung die verfassungsrechtlichen Mindestanforderungen an die Wahrheitserforschung verkannt. Die Verurteilung des Beschwerdeführers beruhe auf einer unzureichenden Erforschung der materiellen Wahrheit. Das Geständnis des Beschwerdeführers hätte nicht als alleinige Grundlage zu seiner Verurteilung herangezogen werden dürfen. Dem AG hätte sich zwingend die Notwendigkeit einer ergänzenden Beweiserhebung zur Überprüfung des Geständnisses und der Feststellung seiner Schuld aufdrängen müssen. Das Verfahren im Zusammenhang mit § 266a StGB sei als komplex einzustufen. Der Tatvorwurf habe sich auf 26 Taten erstreckt, die die Beschäftigung von mindestens 36 Personen in einem Zeitraum von fast drei Jahren betrafen und einen Schaden von mutmaßlich nahezu einer halben Million EUR umfassten.
Qualität des Geständnisses insgesamt gering
Die Qualität des verständigungsbasierten Geständnisses des Angeklagten sei insgesamt als gering einzuschätzen und gehe kaum über ein Formalgeständnis hinaus. Die oberflächlichen und teilweise mehrdeutigen Ausführungen des Angeklagten lassen es nach Auffassung des BVerfG als äußerst zweifelhaft erscheinen, dass sich der Tatrichter allein auf dieser Basis vom Vorliegen der objektiven und subjektiven Tatbestandsmerkmale des Straftatbestandes überzeugen konnte. Es sei insbesondere nicht erkennbar, dass das AG bei Würdigung der Aussagekraft der geständigen Einlassung berücksichtigt hätte, dass der Angeklagte das Geständnis nicht persönlich vorgetragen habe, sondern es habe durch seinen Verteidiger verlesen lassen.
Keine ausreichend fundierte Überzeugung
Das amtsgerichtliche Urteil lasse zudem besorgen, dass sich der Tatrichter keine ausreichend fundierte Überzeugung von der Schadenshöhe verschafft habe. Diese stelle einen wesentlichen Faktor der Strafzumessung bei § 266a StGB dar. Das AG habe wohl allein anhand der Einlassung des Angeklagten, die Anklage als richtig zu bestätigen, darauf geschlossen, dass der sozialversicherungsrechtliche Schaden 494.793,19 EUR betragen haben müsse.
Weitere Aufklärung drängte sich auf
Nach alledem hätte sich dem AG die Erforderlichkeit einer weiteren Aufklärung des Sachverhalts aufdrängen müssen. Das verständigungsbasierte Geständnis sei zwingend durch Beweiserhebung in der Hauptverhandlung auf seine Richtigkeit zu überprüfen. Gleichwohl habe das AG das Geständnis des Angeklagten in den Urteilsgründen weder hinreichend erläutert noch es einer erforderlichen Prüfung durch formelle Beweiserhebung oder auf andere Weise unterzogen. So erscheine es zweifelhaft, ob sich das AG der Bedeutung der trotz des Geständnisses fortbestehenden Aufklärungspflicht nach §§ 257c Abs. 1 S. 2, 244 Abs. 2 StPO tatsächlich bewusst gewesen sei. Es lasse sich keinesfalls von vornherein sicher ausschließen, dass eine weitere Beweiserhebung zur Überprüfung des verständigungsbasierten Geständnisses vorliegend einen weiteren Erkenntnisgewinn versprochen hätte.
III. Bedeutung für die Praxis
Klassischer Fall eines No-Go
Zur Abspracheregelung in § 257 StPO hat es in letzter Zeit weniger Rechtsprechung gegeben, nachdem die Praxis sich in den ersten Jahren nach Inkrafttreten der Neuregelung recht häufig mit den sich daraus ergebenden Fragen befasst hat. Umso erstaunter ist man dann über diesen Beschluss. Nicht wegen der Entscheidung an sich, sondern wegen des zugrunde liegenden Sachverhalts. Das ist nämlich einer der klassischen Fälle, die die Rechtsprechung des BVerfG und auch die des BGH vermeiden wollte: Der „Deal“ geringe Strafe gegen schnellen Abschluss des Verfahrens bzw. Einräumen des zur Last gelegten Sachverhalts, ohne dass dieser und die geständige Einlassung des Angeklagten vom Tatgericht überprüft wird. Denn das BVerfG hat in seiner Rechtsprechung von Anfang an darauf hingewiesen, dass auch bei einer Verständigung die Pflicht des Gerichts zur Aufklärung des Sachverhalts davon nicht betroffen sein soll. Das verständigungsbasierte Geständnis soll nicht allein Grundlage des Urteils sein. Vielmehr soll auch weiterhin die Überzeugung des Gerichts von dem von ihm im Urteil später festgestellten Sachverhalt erforderlich sein (vgl. BT-Drucks 16/12310, S. 13), so ausdrücklich im Verständigungsurteil vom 19.3.2013 auch das BVerfG (NJW 2013, 1058, 1063). Allein ein verständigungsbasiertes Geständnis könne eine Verurteilung nicht rechtfertigen (s.a. BGH NStZ 2014, 53). Vielmehr sei es zwingend erforderlich, die geständige Einlassung des Angeklagten im Zuge einer förmlichen Beweisaufnahme auf ihre Richtigkeit zu überprüfen (BVerfG a.a.O., m.w.N.; wegen weiterer Nachw. Burhoff (Hrsg.), Handbuch für das strafrechtliche Ermittlungsverfahren, 9. Aufl. 2022, Rn 176). Das Gericht darf also nicht vorschnell auf eine Urteilsabsprache bzw. eine Verständigung ausweichen, ohne zuvor pflichtgemäß die Anklage tatsächlich anhand der Akten und insbesondere auch rechtlich überprüft zu haben (vgl. u.a. BGH NStZ 2014, 53). Es darf also nicht etwa ohne nähere Überprüfung des Tatgeschehens eine bestimmte Sanktion zusagen (vgl. a. Meyer-Goßner/Schmitt, StPO, 66. Aufl. 2023, § 257c Rn 4). Das hat das AG übersehen und – was auch erstaunt – das OLG Naumburg im Revisionsverfahren ebenfalls. Das Ergebnis ist dann, dass jetzt noch einmal verhandelt werden muss. Schnelligkeit bei einer Entscheidung ist eben nicht immer gut.