1. Ein Fahrzeug, das ohne jede Fortbewegungs- und Transportfunktion als Anker für die Winde und ein Seil im Rahmen eines Bergungsvorgangs dient, ist nicht im Betrieb im Sinne des § 7 Abs. 1 StVG.
2. Dieses Kfz kommt jedoch in Betrieb, wenn es sodann seine Fahrt mittels eigener Motorkraft fortsetzt und Fahrer und Halter haften für die Verletzung eines danebenstehenden Helfers.
3. Zu dessen Lasten findet gerade kein Haftungsausschluss wegen des Handelns auf eigene Gefahr statt, da vorliegend eine Deckung über eine Kraftfahrzeughaftpflichtversicherung bei einer Gefährdungshaftung besteht.
4. Ein Mitverschulden des Helfers nach § 9 StVG i.V.m. § 254 Abs. 1 BGB muss der Kfz-Führer dagegen beweisen. (Leitsätze des Verfassers)
I. Sachverhalt
Verletzung durch Winde bei Bergung eines Kfz
Der Kläger und der Beklagte hatten beide einen sogenannten „Offroad-Park“ besucht, bei dem das Fahrzeug des Beklagten zu 1) sich allerdings festgefahren hatte. Der Kläger konnte jedoch das Fahrzeug mit Hilfe seiner Seilwinde und seinem Pkw aus der Senke herausziehen. Sein Geländewagen hatte während dieses Bergungsvorgangs aber nur als Anker für eine Winde im Rahmen des Bergungsvorganges gedient. Sodann gelang es allerdings nicht, die Seilwinde von dem Fahrzeug des Beklagten zu lösen. Dessen ungeachtet ist der Beklagte ohne weitere Ansprache nach ca. 2 Minuten wieder angefahren ist. Dadurch wurde die Winde angespannt und dabei der Kläger verletzt.
II. Entscheidung
Betriebsgefahr setzt mit Bewegung eines Kfz wieder ein
Seitens des OLG ist hierfür eine Eintrittspflicht des Beklagten zu 1) und seiner Kraftfahrzeughaftpflichtversicherung aus der Betriebsgefahr des Fahrzeuges der Beklagtenseite bejaht worden. Zwar wäre während des Bergungsvorganges das stillstehende Fahrzeug, bei dem die Fortbewegungs- und Transportfunktion keine Rolle gespielt hat, nicht geeignet, eine Haftung aus Betriebsgefahr auszulösen. Dies habe sich allerdings in dem Moment geändert, wo der Bergungsvorgang beendet gewesen sei – denn dann habe das Fahrzeug im Anfahrvorgang die Ursache dafür gesetzt, dass der Kläger verletzt wurde.
Keine Haftungsbeschränkung bei Deckung aus der Kfz-Haftpflichtversicherung
Unter dem Gesichtspunkt des Handels auf eine eigene Gefahr wäre auch keine Haftungsbeschränkung auf eine grobe Fahrlässigkeit oder gar ein umfassender Haftungsausschluss zu Lasten des Klägers vorzunehmen. Vielmehr wäre zu beachten, dass ein solcher Sonderfall bei einer Gefährdungshaftung so sehr restriktiv zur Anwendung anzuwenden ist. Vorliegend sind aus Sicht des Senats keine Gründe ersichtlich, um zur Vermeidung eines unbilligen Ergebnisses bei der Deckung aus der Kraftfahrzeughaftpflichtversicherung ein Handeln auf eigene Gefahr anzunehmen. Vielmehr würde es der Beklagtenseite obliegen, dem Kläger ein entsprechendes Mitverschulden im Sinne des § 254 Abs. 1 BGB i.V.m. § 9 StVG nachzuweisen, wofür es vorliegend allerdings keine ausreichenden Anhaltspunkte gegeben hätte: Denn das Anfahren des Fahrzeuges der Beklagtenseite wäre ohne nachgewiesene Absprache und für den Kläger vollkommen überraschend erfolgt.
III. Bedeutung für die Praxis
Im Einzelfall zu prüfen: Wird Kfz als Arbeitsmaschine oder zur Fortbewegung einsetzt?
Die Entscheidung des OLG Hamm zeigt anschaulich noch einmal die Grundsätze auf, unter denen eine Haftung aus Betriebsgefahr je nachdem bejaht werden kann, ob es sich um eine einzelne Arbeitsmaschine oder ein Fahrzeug handelt. Wenn wie hier während der ersten Phase ein Fahrzeug ohne jede Fortbewegungs- oder Transportfunktion wie ein Baum oder ein Fels als Anker für eine Winde und ein Seil im Rahmen des Bergungsvorgangs dient, ist das Kfz lediglich als Arbeitsmaschine zu bewerten, ohne dass der Anwendungsbereich des § 7 StVG eröffnet ist. Dies ändert sich allerdings dann, wenn die Transport- und Fortbewegungsfunktion des Fahrzeuges eine Rolle spielt und dies ist konsequent zu bejahen, wenn das Fahrzeug sich aus eigener Kraft nach Abschluss des Bergungsvorgangs wieder in Bewegung setzt (vgl. zum Einsatz als Arbeitsmaschine auch BGH, Urt. v. 21.9.2021 – VI ZR 726/20).
Wie immer bei derartigen „Helfer“-Unfällen stellt sich die Frage, ob ein Haftungsausschluss wegen des Handels auf eigene Gefahr bejaht werden kann. Dieser kommt jedoch bei einer Gefährdungshaftung nur in einem besonderen Ausnahmefall zur Anwendung (vgl. OLG Hamm, Urt. v. 22.4.2015 – 14 O 19/14). Ein solcher Ausnahmefall war vorliegend weder vorgetragen noch bewiesen, zumal eine Deckung aus der Kraftfahrzeughaftpflichtversicherung bestanden hat.
Kein Verschulden zu Lasten des Geschädigten nach § 254 BGB nachweisbar
Da es sich nicht um einen Unfall von zwei Kraftfahrzeugen mit der jeweiligen Haftung ihrer Halter handelt, scheidet eine Haftungsabwägung nach § 17 Abs. 2 StVG aus und es kann auch nicht Unabwendbarkeitsnachweis nach § 17 Abs. 3 StVG geführt werden. Vielmehr kann den Kläger nur eine Mithaftung unter dem Gesichtspunkt eines Mitverschuldens nach § 254 Abs. 1 BGB i.V.m. § 9 StVG treffen. Die Beweislast dafür liegt allerdings immer auf Seiten des Kfz-Führers/Halters des anderen unfallbeteiligten Fahrzeuges. In dem hier vorliegenden Fall konnte ein solcher Nachweis gerade nicht erbracht werden, da augenscheinlich das Anfahren nach dem erfolgten Abschleppen nicht abgesprochen gewesen ist, sondern davon ausgegangen wurde, dass die Seilwinde schon abgekoppelt gewesen wäre, als das Fahrzeug sich wieder in Bewegung gesetzt hat.
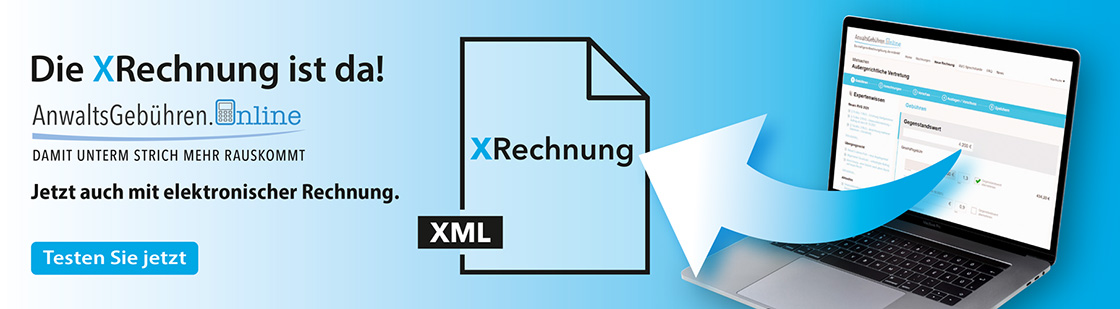

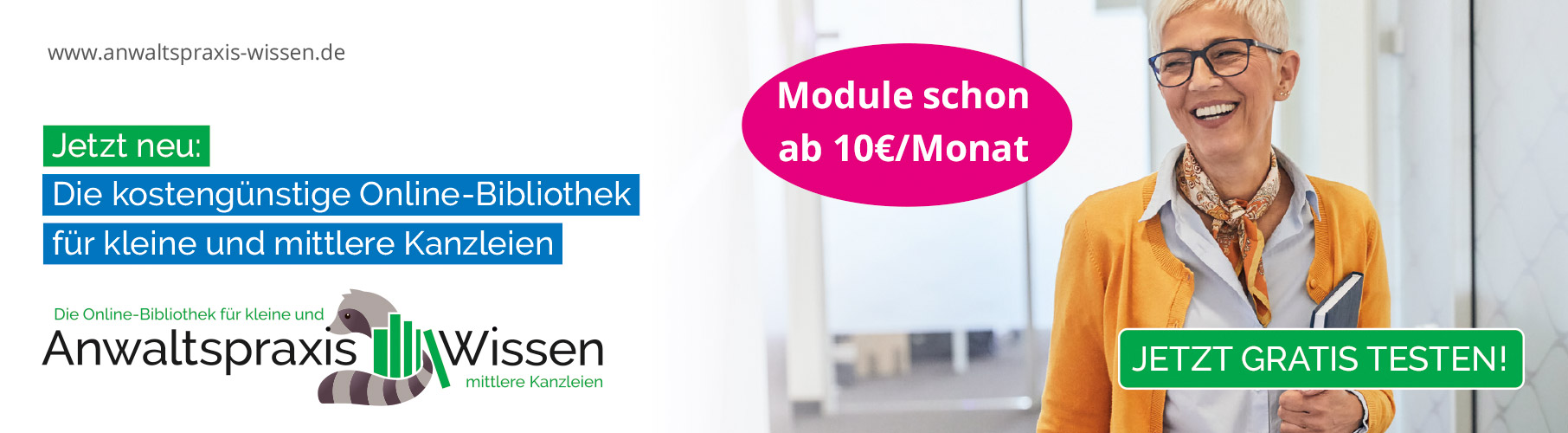

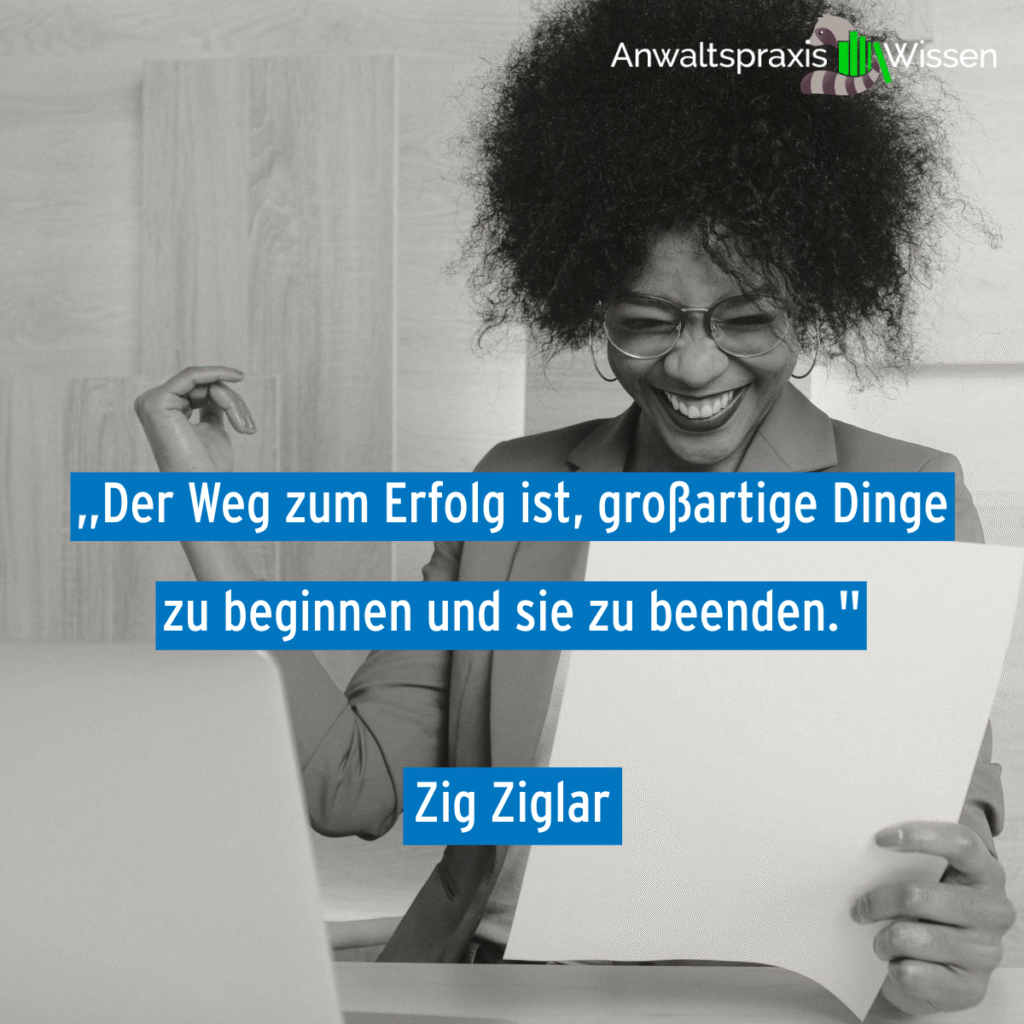

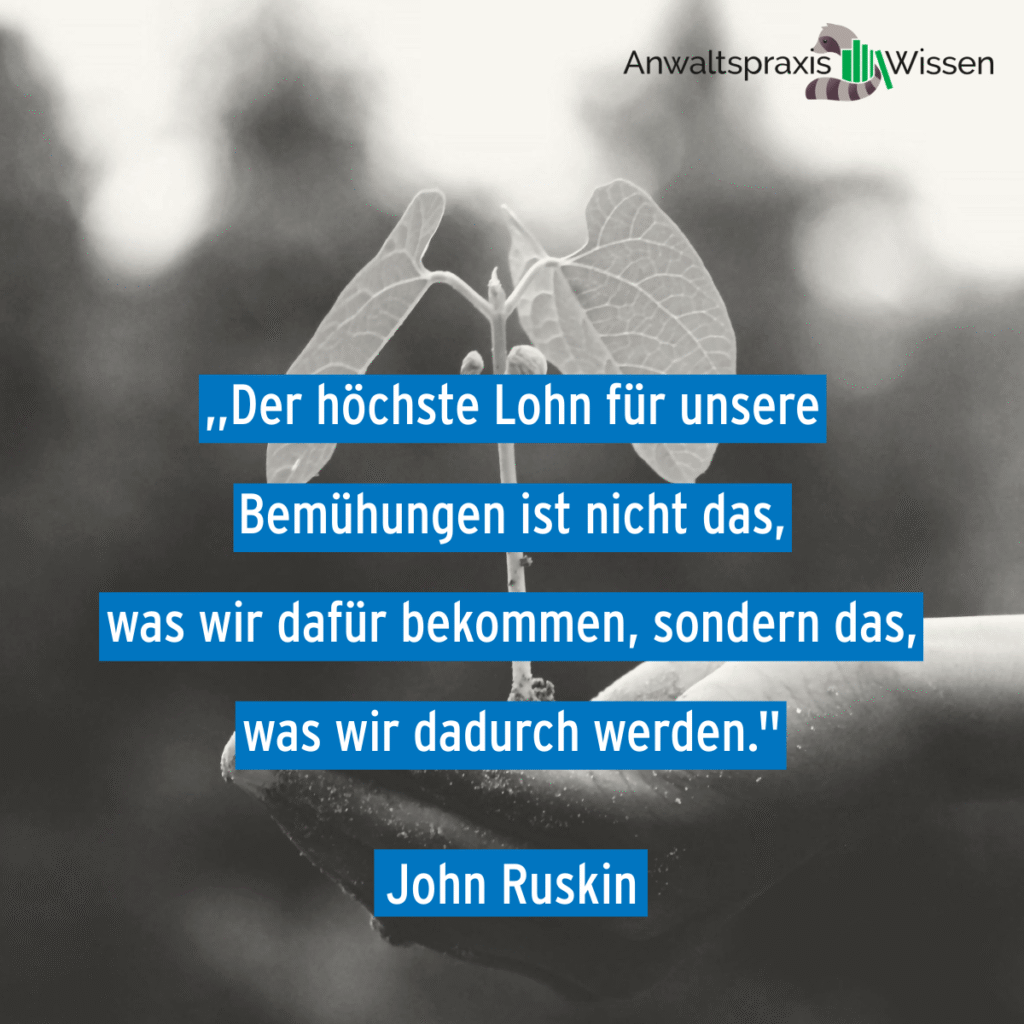

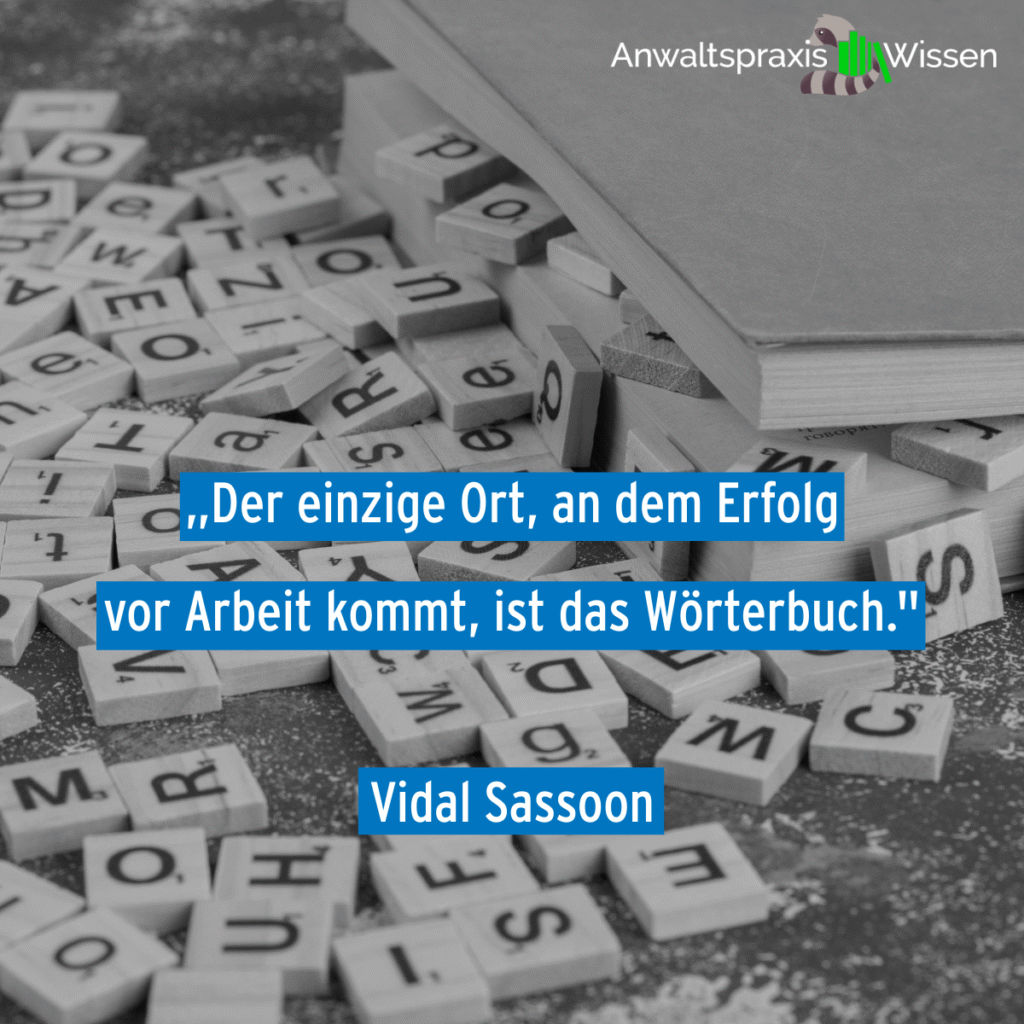
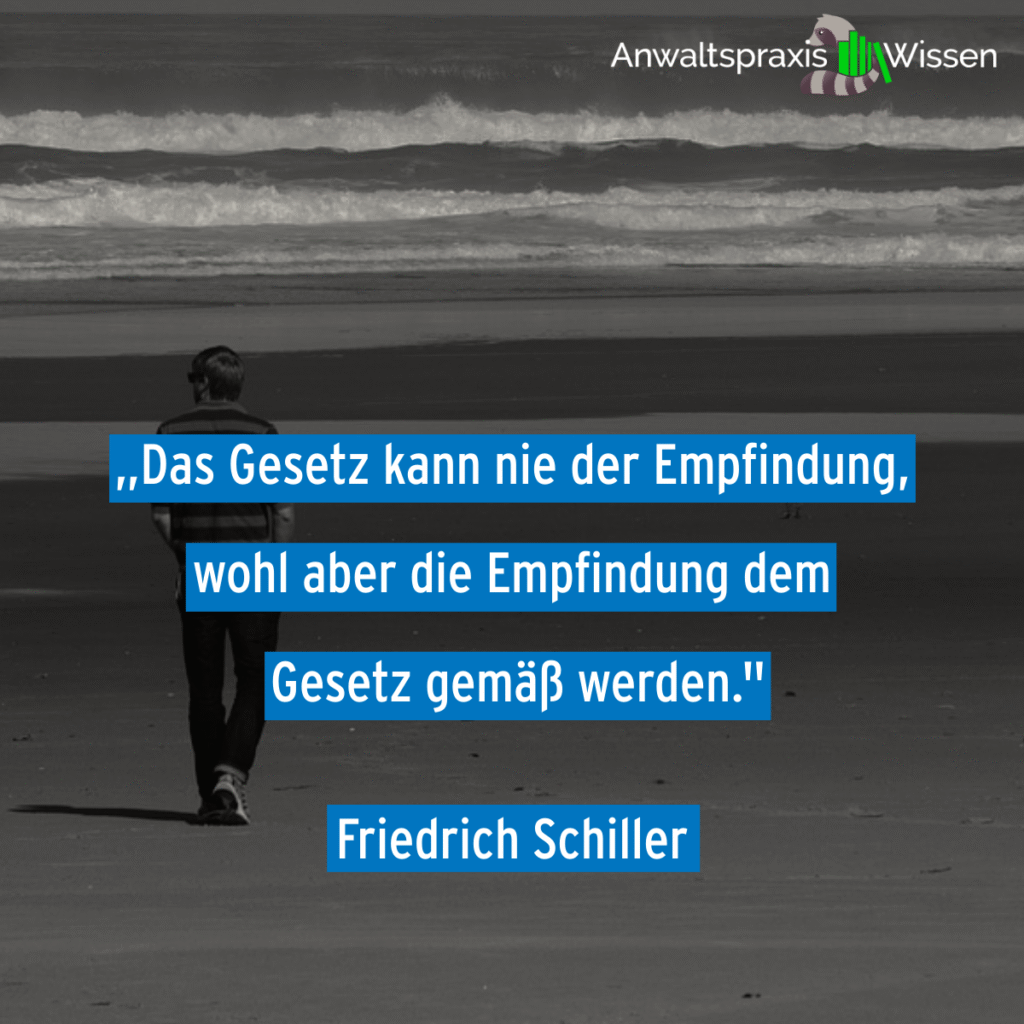
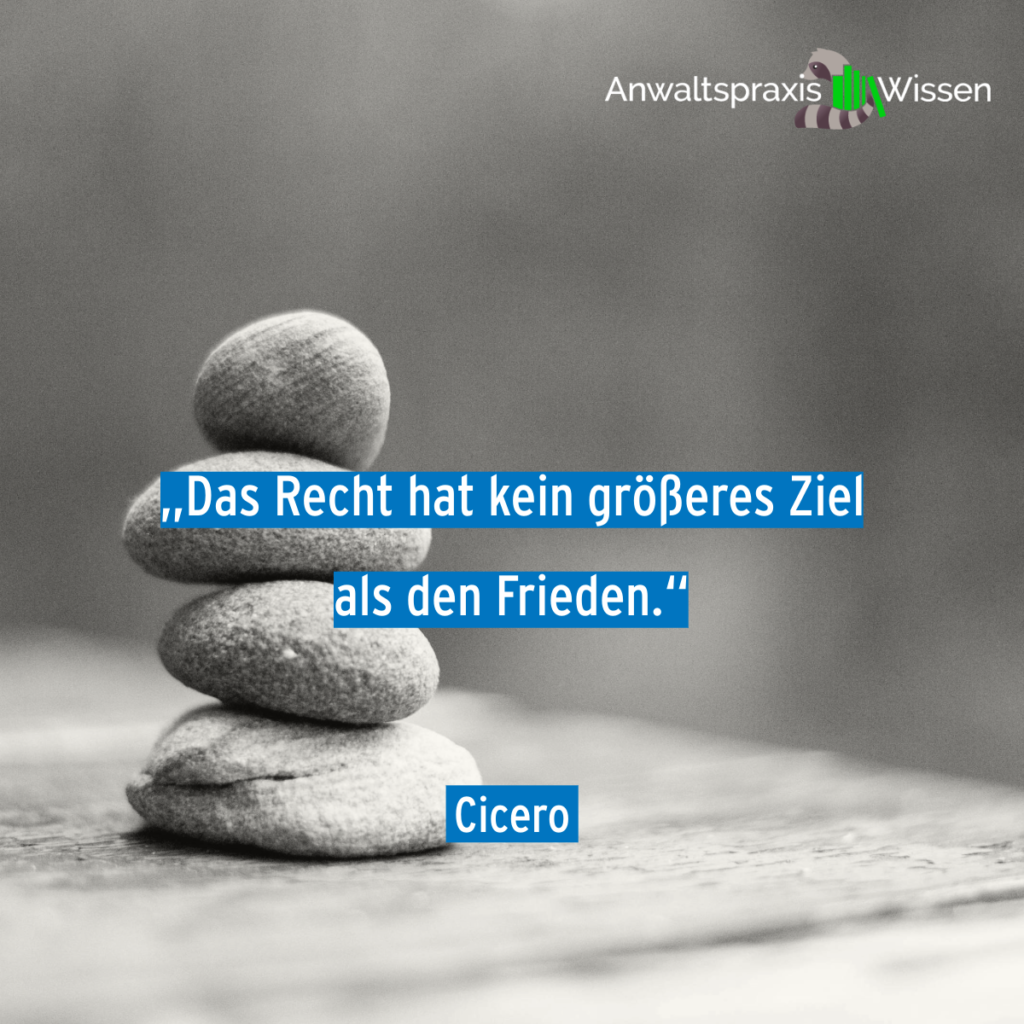

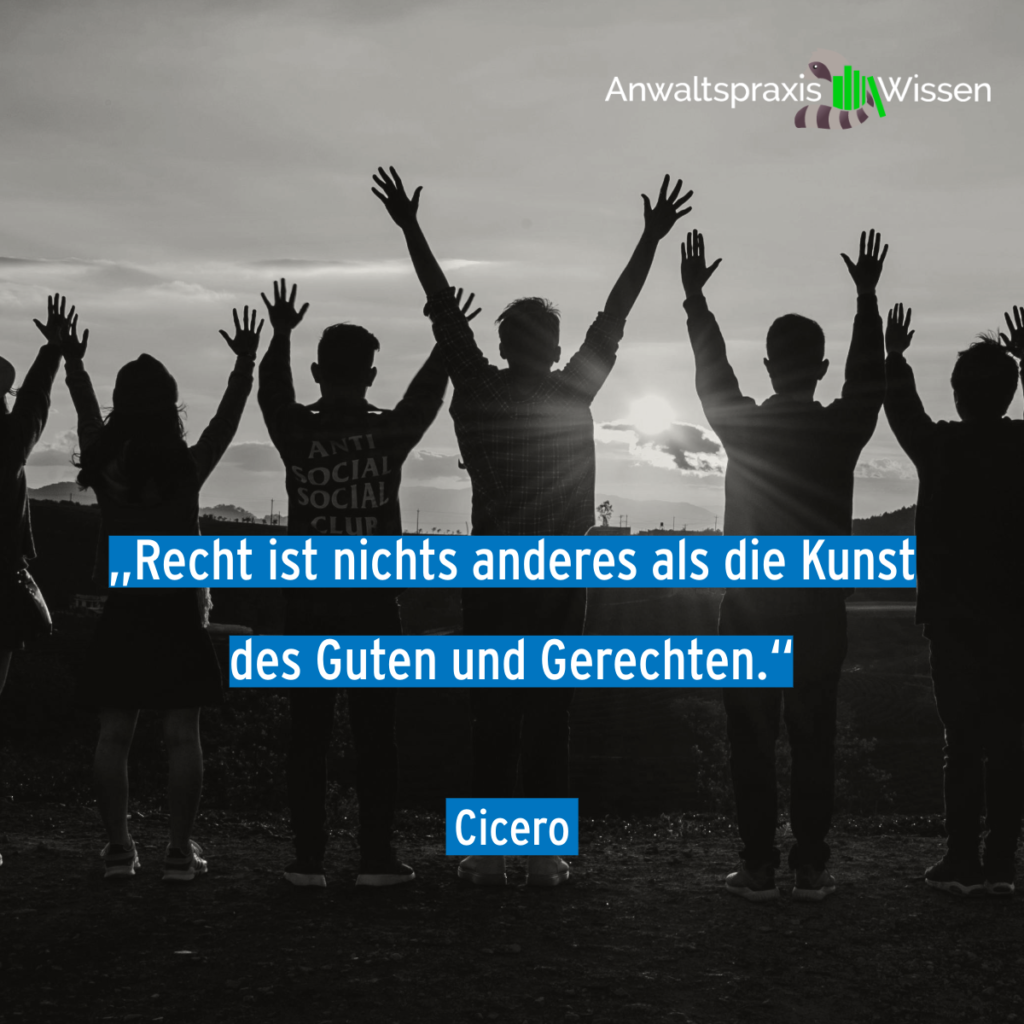
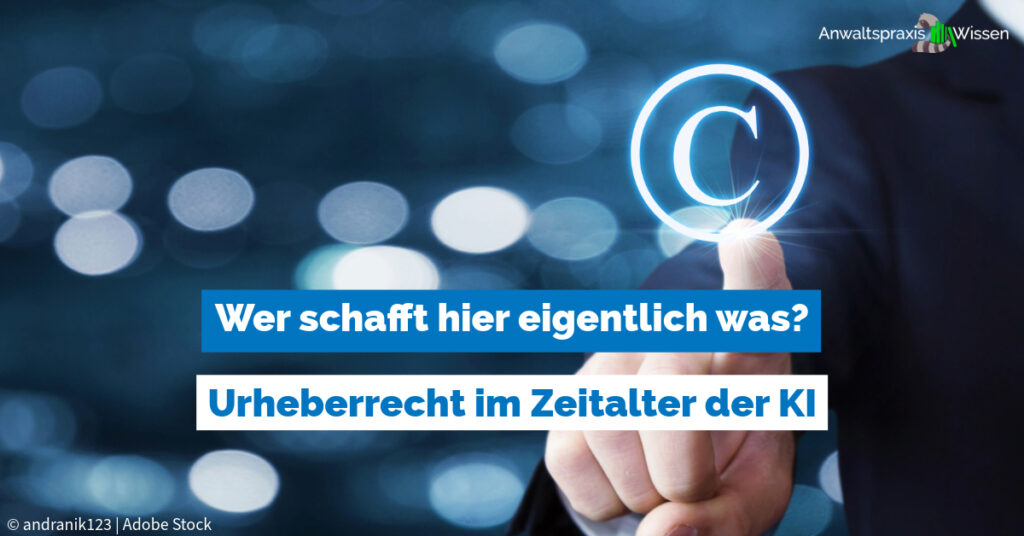

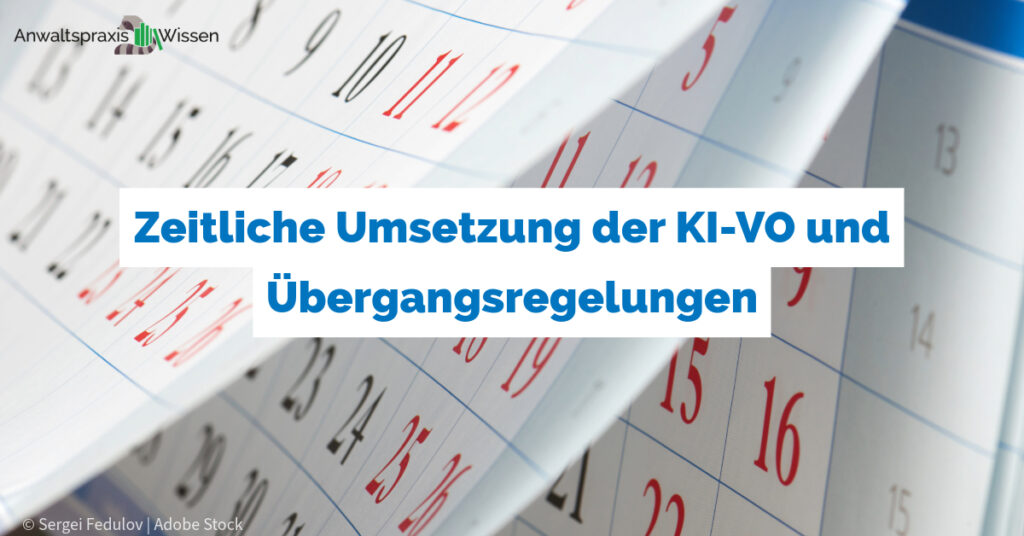




![Erbrecht im Gespräch: Kurze[s] Update: #15 Die Rechte des Erben vor dem Erbfall – mit Walter Krug](https://anwaltspraxis-magazin.de/wp-content/uploads/2025/05/Erbrecht-im-Gespraech-15-1024x536.jpeg)

