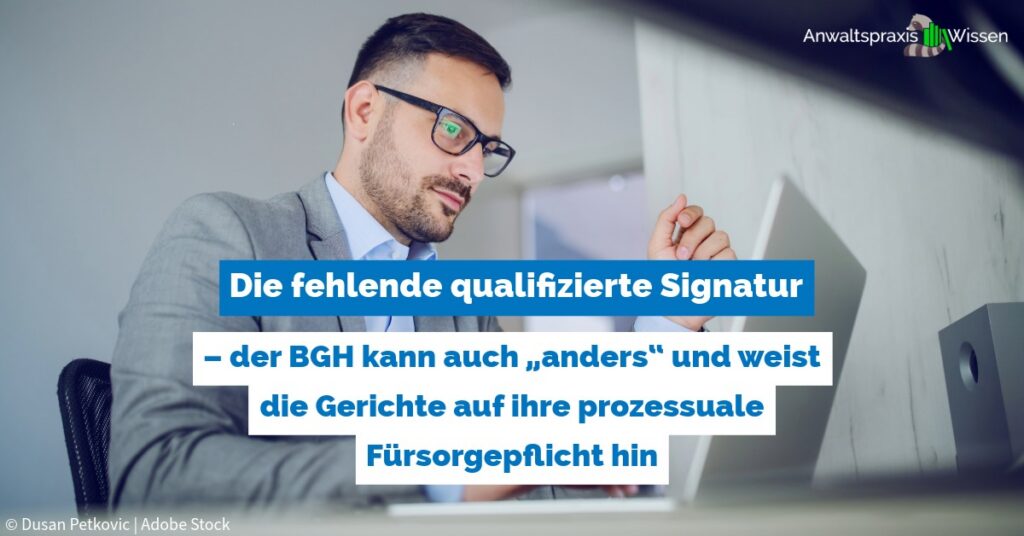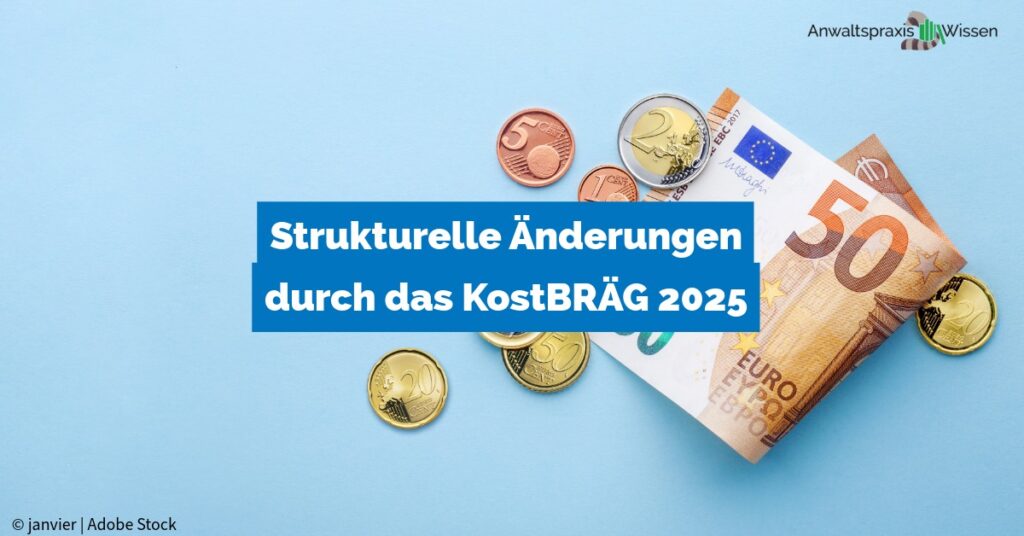Ausgangspunkt
Die vom Bundesgesetzgeber für notwendig und sinnvoll erachtete Teillegalisierung des Besitzes und Konsums von Cannabis zum 1.4.2024 hat zu einer Neubewertung der rechtlichen Folgen des Führens eines Fahrzeugs unter dem Einfluss von Cannabis geführt.
Hinweis
Zum CanG Hillenbrand, StRR 5/24, 5; Sobota, NJW 2024, 1217; zu den Auswirkungen auf den Straßenverkehr Burhoff, VRR 5/2024, 8. Die Verteidigung in straf- und bußgeldrechtlichen Verfahren und die Vertretung im Fahrerlaubnisrecht unter den neuen Vorgaben behandeln Staub/Dronkovic, DAR 2024, 410.
§ 44 KCanG sieht vor, dass eine vom Bundesverkehrsminister eingesetzte Arbeitsgruppe bis zum 31.3.2024 (also noch vor dem Inkrafttreten des Gesetzes) den Wert einer Konzentration von THC im Blut vorzuschlagen habe, bei dessen Erreichen nach dem Stand der Wissenschaft das sichere Führen eines Kfz im Straßenverkehr regelmäßig nicht mehr gewährleistet ist. Diese Expertenkommission hat einen gesetzlichen Wirkungsgrenzwert von 3,5 ng/ml THC im Blutserum vorgeschlagen. Nach dem aktuellen Stand der Wissenschaft seien bei diesem Wert verkehrssicherheitsrelevante Wirkungen auf das Führen eines Kfz nicht fernliegend, aber deutlich unterhalb der Schwelle, ab welcher ein allgemeines Unfallrisiko beginnt. Dieser Grenzwert sei vergleichbar mit einer Blutalkoholkonzentration von 0,2 Promille.
Hinweis
Das Gutachten ist zu finden unter https://bmdv.bund.de/SharedDocs/DE/Anlage/K/cannabis-expertengruppe-langfassung.pdf?__blob=publicationFile, die Zusammenfassung unter https://bmdv.bund.de/SharedDocs/DE/Anlage/K/cannabis-expertengruppe-kurzfassung.pdf?__blob=publicationFile. Die Mitglieder der Arbeitsgruppe und deren Qualifikation sind genannt bei https://bmdv.bund.de/SharedDocs/DE/Pressemitteilungen/2024/018-expertengruppe-thc-grenzwert-im-strassenverkehr.html
Durch das Sechste Gesetz zur Änderung des Straßenverkehrsgesetzes und weiterer straßenverkehrsrechtlicher Vorschriften vom 16.8.2024 (BGBl I Nr. 266; BT-Drucks 20/11370) wird dieser vorgeschlagene Grenzwert gesetzlich umgesetzt. Im Folgenden werden die wesentlichen materiellen Änderungen dargestellt.
§ 24a StVG (Drogenfahrt)
1. Bisherige Fassung
a) Tatbestand (Cannabis)
Nach § 24a Abs. 2 StVG in der bisherigen Fassung handelt ordnungswidrig, wer unter der Wirkung eines der in der Anlage zu der Vorschrift genannten berauschenden Mittel im Straßenverkehr ein Kfz führt, wobei eine solche Wirkung vorliegt, wenn eine in dieser Anlage genannte Substanz im Blut nachgewiesen wird (näher Deutscher, VRR 2011, 8). Anders als bei den Straftatbeständen der §§ 315c Abs. 1 Ziff. 1a, 316 StGB genügt nicht jedes berauschende Mittel zur Erfüllung des Tatbestands, sondern nur die in der Anlage zu der Vorschrift aufgeführten Mittel bzw. Wirkstoffsubstanzen, zu denen auch Cannabis bzw. Tetrahydrocannabinol (THC) zählte. Grenzwerte werden anders als bei der Alkoholfahrt nach § 24a Abs. 1 StVG nicht vorgegeben. Die hiernach vom Tatbestand her geltende Nullwertgrenze hat das BVerfG (NJW 2005, 349 = VRR 2005, 34 [Lorenz]) relativiert. Die Vorschrift sei im Wege der verfassungskonformen Auslegung dahin zu verstehen, dass nicht jeder Nachweis eines berauschenden Mittels (hier THC) im Blut des Betroffenen für die Tatbestandserfüllung ausreicht. Es müsse vielmehr eine Konzentration festgestellt werden, die es als möglich erscheinen lässt, dass der Verkehrsteilnehmer in seiner Fahrtüchtigkeit eingeschränkt war. Dies setze eine THC-Konzentration von deutlich oberhalb des Nullwerts voraus. Die OLG haben diese Entscheidung des BVerfG umgesetzt und dabei auf die sog. analytischen Grenzwerte abgestellt, die von der Grenzwertekommission empfohlen werden. Bei Cannabis wurde dieser Wert auf 1 ng/ml festgelegt (etwa OLG Hamm NJW 2005, 3298 = VRR 2005, 196 [Lorenz]; OLG Karlsruhe NZV 2007, 248 = VRR 2007, 273 [Böhm]; OLG Celle NZV 2009, 89). Mehrheitlich haben die OLG dies allerdings nicht als zwingenden Grenzwert, sondern lediglich als Richtwert verstanden, der nicht ausschließt, auch bei einer geringeren Konzentration eine „Wirkung“ im Sinne einer eingeschränkten Fahrtüchtigkeit etwa bei drogenbedingten Ausfallerscheinungen anzunehmen (OLG Hamm NZV 2007, 248; OLG Bamberg DAR 2007, 272, 274 m. Anm. Krause = VRR 2007, 270 [Gieg]).
b) Auffangfunktion
Der Drogenfahrt nach § 24a Abs. 2 StVG kommt eine besondere Auffangfunktion (§ 21 Abs. 1 S. 1 OWiG) gegenüber den Straftatbeständen der §§ 315c Abs. 1 Ziff. 1a, 316 StGB zu. Seit BGHSt 44, 219 (= NJW 1999, 226) ist anerkannt, dass gegenwärtig bei Drogenfahrten eine absolute Fahruntüchtigkeit im Sinne dieser Strafnormen mangels entsprechender, wissenschaftlich abgesicherter Wirkstoffgrenzwerte anders als beim Alkoholkonsum nicht bestimmbar ist. Für die hiernach als einzig möglich verbleibende relative Fahrtuntüchtigkeit bedarf es neben der Feststellung des Drogenkonsums zusätzlich des Vorliegens drogenbedingter Ausfallerscheinungen. Dies können zum einen drogenbedingte Fahrfehler sein, zum anderen psycho-physische Auswirkungen des Drogenkonsums, sofern sie unmittelbar zur Fahrunsicherheit führen und nicht lediglich allgemeine Merkmale der Wirkung des Drogenkonsums sind. Der Nachweis einer drogenbedingten Fahrunsicherheit i.S.v. § 316 StGB kann nicht allein durch einen bestimmten Blutwirkstoffbefund geführt werden. Es bedarf weiterer aussagekräftiger Beweisanzeichen, die im konkreten Einzelfall belegen, dass die Gesamtleistungsfähigkeit des Kfz-Führers so weit herabgesetzt war, dass er nicht mehr fähig gewesen ist, sein Fahrzeug im Straßenverkehr eine längere Strecke, auch bei Eintritt schwieriger Verkehrslagen, zu steuern. Das können etwa sein:
-
glasige, gerötete Augen,
-
die Notwendigkeit, Anordnungen mehrfach zu wiederholen,
-
Unsicherheiten beim Finger-Finger-Test.
Dies hat das Tatgericht anhand einer Gesamtwürdigung aller relevanten Umstände zu beurteilen Die Anforderungen an Art und Ausmaß drogenbedingter Ausfallerscheinungen können umso geringer sein, je höher die im Blut festgestellte Wirkstoffkonzentration ist (BGH NStZ 2022, 741 = NZV 2022, 572 m. Anm. Ternig = DAR 2022, 643 = VRR 10/2022. 14 = StRR 12/2022, 20 [jew. Burhoff], aktuell Beschl. v. 24.4.2024 – 4 StR 90/24). Eingedenk dieser Anforderungen bei den Straftatbeständen kommt der bußgeldrechtlichen Ahndung von Drogenfahrten eine gesteigerte Bedeutung zu.
c) Rechtsfolge
Als Rechtsfolge der Drogenfahrt droht nach Ziff. 241 bis 242.2 BKat eine Geldbuße bei Fahrlässigkeit bis 1.500 EUR, bei Vorsatz (§ 24a Abs. 4 StVG a.F., § 1 Abs. 2 BKatV) bis zu 3.000 EUR, gestaffelt nach der Anzahl von einschlägigen Vorbelastungen oder solcher nach §§ 315c Abs. 1 Nr. 1a, 316 StGB. Wird eine solche Geldbuße verhängt, so ist nach § 25 Abs. 1 S. 2 StVG in der Regel auch ein Fahrverbot anzuordnen. Dessen Dauer beträgt nach § 4 Abs. 3 BKatV i.V.m. Nr. 241–241.2 BKat einen Monat beim Ersttäter und drei Monate beim Wiederholungstäter.
2. Der neue THC-Grenzwert (§ 24a Abs. 1a StVG)
a) Tatbestand
Durch die Reform wird die Auflistung von Cannabis bzw. Tetrahydrocannabinol (THC) in der Anlage gestrichen. In Umsetzung der Vorschläge der Expertengruppe wird der neue Tatbestand des § 24a Abs. 1a StVG eingefügt:
„Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig im Straßenverkehr ein Kraftfahrzeug führt, obwohl er 3,5 ng/ml oder mehr Tetrahydrocannabinol im Blutserum hat.“
Damit wird die Drogenfahrt unter Wirkung von Cannabis aus dem Anwendungsbericht des § 24a Abs. 2 StVG entnommen und diesem neuen Tatbestand unterworfen. Ziel der Grenzwertfestlegung in dieser Höhe ist, dass der Konsum von Cannabis und das Führen eines Kfz im Straßenverkehr getrennt werden. Der Grenzwert setzt sich hiernach wie folgt zusammen
-
Basiswert von 3,5 ng/ml als mittlere Konzentration, bei der Gelegenheitskonsumenten eine mit 0,2-Promille Blutalkoholkonzentration vergleichbare Beeinträchtigung aufweisen können,
-
Ausgleich der durch die Verzögerung zwischen Ereignis (Unfall, Verkehrskontrolle) und Blutentnahme möglichen THC-Konzentrationsabnahme mittels Abzugs von 1ng/ml,
-
pauschaler, durch mögliche Messfehler bedingter Sicherheitszuschlag von 1 ng/ml (40 % von 2,5 ng/ml, BT-Drucks 20/11370, S. 11; Gutachten der Expertengruppe, S. 6).
b) Rechtsfolgen
Nach dem neuen § 24a Abs. 3 StVG kann die Ordnungswidrigkeit in den Fällen der Abs. 1, 1a und 2 S. 1 mit einer Geldbuße bis zu 3.000 EUR geahndet werden. Die BKatV wurde redaktionell angepasst und der BKat inhaltlich geändert. Die Rechtsfolgen für Drogenfahrten mit anderen berauschenden Mitteln als Cannabis sind unverändert geblieben, wurden aber von Nrn. 242–242.2 in Nrn. 243–243.2 unbenannt. Die Rechtsfolgen für den neuen Verstoß gegen den THC-Grenzwert nach § 24a Abs. 2a StVG werden nunmehr in Nrn. 242–242.2 BKat aufgeführt, entsprechen allerdings inhaltlich auch in der Abstufung denjenigen für Drogenfahrten mit anderen berauschenden Mitteln als Cannabis.
3. Mischkonsum von Cannabis und Alkohol (§ 24a Abs. 2a StVG)
a) Tatbestand
Um der besonderen Gefährdung durch den Mischkonsum von Cannabis und Alkohol gerecht zu werden, hat die Expertenarbeitsgruppe außerdem empfohlen, für Cannabiskonsumenten ein absolutes Alkoholverbot am Steuer entsprechend der Regelung des § 24c StVG für Fahranfänger vorzusehen. In Umsetzung dessen wird flankierend der neue Tatbestand des § 24a Abs. 2a StVG eingeführt:
„Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig eine in Abs. 1a genannte Handlung begeht und
1. ein alkoholisches Getränk zu sich nimmt oder
2. die Fahrt antritt, obwohl er unter der Wirkung eines alkoholischen Getränks steht.“
Das entspricht dem Alkoholverbot für Fahranfänger in § 24c Abs. 1 StVG. Allerdings handelt es sich nicht um eine Nullwertgrenze. Um Messungenauigkeiten und die Wirkung endogenen Alkohols auszuschließen, ist von einer „Alkoholwirkung“ i.S.d. § 24a Abs, 2a StVG erst ab einem Wert von 0,2 Promille Alkohol im Blut oder 0,1 mg/l Alkohol in der Atemluft auszugehen (BT-Drucks 20/11370, S. 11; zu § 24c StVG KG DAR 2016, 278; König, in: Hentschel/König/Dauer, StVR, 47. Aufl. 2023, § 24c StVG Rn 11; enger OLG Stuttgart NJW 2013, 2296 = VRR 2013. 273 = StRR 2013, 499 [jew. Deutscher]: 0,15 Promille). § 24a Abs. 2a ist lex specialis gegenüber § 24a Abs. 1a StVG (so BT-Drucks 20/11370, S. 11).
b) Rechtsfolgen
Die Rechtsfolgen werden in den neuen Nrn. 243a–243a.2 BKat auf der Grundlage des § 24a Abs. 3 StVG erfasst, der für Verstöße eine erhöhte Geldbuße bis zu 5.000 EUR vorsieht. Die Regelgeldbuße beim Ersttäter beträgt 1.000 EUR, bei einer Voreintragung nach § 24a StVG, §§ 316 oder 315c Abs. 1 Nr. 1a StGB 1.500 EUR und bei mehreren solcher Voreintragungen 2.000 EUR. Beim Ersttäter ist ein Regelfahrverbot von einem Monat vorgesehen, beim Wiederholungstäter eines von drei Monaten. Die höhere Regelgeldbuße des Mischkonsums durch § 24a Abs. 3 StVG, Nrn. 243a–243a.2 BKat ist nach der Auffassung des Gesetzgebers aufgrund der besonderen Gefährlichkeit des Mischkonsums gerechtfertigt und zulässig (BT-Drucks 20/11370, S. 12).
Cannabisfahrten von Fahranfängern (§ 24c Abs. 1 StVG)
1. Tatbestand
Bislang wurde von § 24c Abs. 1 StVG nur ein Alkoholverbot von Fahranfängern erfasst. Durch die Neufassung wird auch ein Cannabisverbot eingeführt:
„Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig in der Probezeit nach § 2a oder vor Vollendung des 21. Lebensjahres als Führer eines Kraftfahrzeugs im Straßenverkehr
1. ein alkoholisches Getränk oder die Substanz Tetrahydrocannabinol zu sich nimmt oder
2. die Fahrt antritt, obwohl er unter der Wirkung eines alkoholischen Getränks oder der Substanz Tetrahydrocannabinol steht.“
Wie schon bei Alkohol wird auch bei Cannabis nicht auf einen bestimmten im Gesetz ausdrücklich genannten Grenzwert abgestellt. Hierfür sind dieselben Erwägungen maßgeblich wie auch schon bei dem Alkoholverbot für Fahranfänger: Die Normierung eines ausdrücklichen THC-Grenzwerts im Gesetz ist mit der Gefahr verbunden, die Normadressaten könnten diese THC-Grenze fälschlicherweise so verstehen, dass sie sich an einen solchen THC-Grenzwert herantasten können, obwohl bei THC anders als bei Alkohol ein „Herantrinken“ schon aufgrund der unterschiedlichen Wirkungsweisen im Körper ausscheidet. Die Einführung einer absoluten Null-Nanogramm-THC-Grenze ist vor allem aus messtechnischen Gründen problematisch. „Unter der Wirkung“ von THC steht eine Person nicht erst dann, wenn eine verkehrssicherheitsrelevante Wirkung nicht fernliegend ist, sondern schon dann, wenn eine verkehrssicherheitsrelevante Wirkung nicht vollkommen ausgeschlossen ist. Dabei ist nach den bisherigen wissenschaftlichen Erkenntnissen der analytische Grenzwert von 1 ng/ml THC im Blutserum zugrunde zu legen (BT-Drucks 20/11370, S. 12). Unter der Einnahme von THC ist jeder Konsum von THC-haltigen Cannabisprodukten zu verstehen. Darunter fällt nicht nur das Inhalieren von Marihuana oder Haschisch in Reinform oder vermischt mit Tabak, sondern auch die Einnahme von THC-haltigen Esswaren oder Getränken sowie das Inhalieren von THC-haltigen Ölen und Extrakten durch Verdampfer (Vaping; BT-Drucks 20/11370, S. 12).
2. Rechtsfolgen
Bislang konnte ein Verstoß gegen das Alkoholverbot bei Fahranfängern nach § 24c Abs. 3 StVG (jetzt § 24c Abs. 2 StVG) mit einer Geldbuße belegt werden. Der bisher in Nr. 243 BKat vorgesehene Regelsatz von 250 EUR, wandert aber aufgrund der vorgenannten Änderungen nach Nr. 243b BKat und erfasst nunmehr unterschiedslos auch Verstöße gegen das Cannabisverbot bei Fahranfängern. Eine Regelfahrverbot ist weiterhin nicht vorgesehen und kann sich daher nur aus § 25 StVG im Einzelfall ergeben.
Die sog. Medikamentenklausel (§ 24a Abs. 4 StVG)
Die sog. Medikamentenklausel des § 24a Abs. 2 S. 3 StVG a.F. wird in § 24a Abs. 4 StVG überführt und erfasst auch die Fälle der Cannabisfahrt nach Abs. 1a und 2a. Hiernach sind diese Tatbestände nicht anwendbar, wenn ein berauschendes Mittel (hier Cannabis) aus der bestimmungsgemäßen Einnahme eines für einen konkreten Krankheitsfall verschriebenen Arzneimittels herrührt. Dies betrifft auch das sog. Medizinalcannabis, welches seit 1.4.2024 den Regelungen des MedCanG unterfällt (OLG Zweibrücken NStZ 2024, 371 = zfs 2024, 114; OLG Oldenburg DAR 2023, 584 = zfs 2023, 591; zum Medizinalcannabis Deutscher, VRR 3/2024, 5; auch Ternig, NZV 2024, 257, 262).
Vorsatz oder Fahrlässigkeit
In den § 24a Abs. 1, 1a, 2 und 2a StVG sowie in § 24c Abs. 1 StVG wird nunmehr ausdrücklich normiert, dass die Delikte vorsätzlich oder fahrlässig begangen werden können. Es handelt sich dabei nur um eine redaktionelle Klarstellung der schon bestehenden Rechtslage. In der Praxis dürfte wie bisher eine fahrlässige Begehung einschlägig sein. Insbesondere zum neuen THC-Grenzwert von 3,5 ng/ml hat sich der Gesetzgeber nicht dazu geäußert, wie insofern die Fahrlässigkeit zu bestimmen ist. Bezugspunkt ist nicht mehr das Führen des Kfz im Straßenverkehr unter Wirkung von Cannabis, sondern die Überschreitung des Grenzwerts beim Führen des Kfz. In Teilen der Rechtsprechung wurde bei geringen Wirkstoffkonzentrationen insbesondere bei einem länger zurückliegenden Konsum die Annahme von Fahrlässigkeit abgelehnt (OLG Hamm NJW 2005, 3298 = VRR 2005, 196 [Lorenz], THC: 6,9, ng/ml Konsum: 2 bis 3 Tage zuvor; OLG Frankfurt/Main NZV 2010, 530 = VRR 2010, 432 [Leichthammer]: THC: 4,6 ng/ml; Konsum: keine Feststellungen, zust. damals Deutscher, VRR 2011, 8, 13). Diese Rechtsprechung war allerdings umstritten (abl. König, DAR 2007, 626; 2007, 277; NZV 2009, 425; ders. in: Hentschel/König/Dauer, 47. Aufl. 2023, § 24a StVG Rn 25b): Es entlaste den Betroffenen nicht vom Fahrlässigkeitsvorwurf, wenn er wegen Zeitablaufs nicht mehr mit dem Vorhandensein der Wirkstoffkonzentration gerechnet habe, da er dann eine Pflicht zur Selbstprüfung bei Fahrtantritt verletzt habe. Die Ansicht der Rechtsprechung laufe auf eine „Stundenarithmetik“ hinaus. Unabhängig davon wird aber mit der Einführung des festen gesetzlichen THC-Grenzwerts an der früheren Rechtsprechung nicht mehr festzuhalten sein. Hier gelten nunmehr die Grundsätze zur Fahrlässigkeit beim Verstoß gegen die 0,5-Promille-Grenze in § 24a Abs. 1 StVG (hierzu König, in: Hentschel/König/Dauer, § 24a StVG Rn 25a). Wer wissentlich in nicht unerheblicher Menge Cannabis konsumiert, muss beim Führen eines Kfz mit einer Überschreitung des Grenzwertes rechnen. Angesichts der unterschiedlichen individuellen Abbauzeiten von Cannabis trägt der Fahrer das Risiko einer unbewussten Fahrlässigkeit. Verteidigungsmöglichkeiten ergeben sich dabei aber in folgenden Konstellationen:
-
unbewusster Konsum (etwa durch „verdeckte Haschkekse“, beim Rauchen kaum denkbar),
-
stark verzögerter Abbau von THC durch körperliche Besonderheiten bei langem Zeitablauf zwischen Konsum und Fahrt.
In ersten Fall ist aber eine strenge Prüfung angezeigt, ob die entsprechende Einlassung überhaupt glaubhaft oder eine bloße Schutzbehauptung ist. Bei der zweiten Konstellation ist die Heranziehung eines Sachverständigen zwingend. Auch ist zu prüfen, ob trotz Vorliegens der genannten Umstände gleichwohl sich aufgrund anderer Tatsachen (etwa Ausfallerscheinungen) eine Überschreitung des Grenzwertes aufgedrängt hat (zum Alkohol Koehl, SVR 2024, 132, 136).
Altfälle
Unmittelbar nach der Veröffentlichung der Ergebnisse der Expertenarbeitsgruppe, aber noch vor der Gesetzesänderung hat das AG Dortmund (NZV 2024, 280 m. zust. Bespr. Staub = DAR 2024, 409 = VRR 5/20254, 24 = StRR 5/2024, 32 [jew. Burhoff]) in vorauseilendem Gehorsam den Grenzwert für Cannabis im Rahmen des § 24a Abs. 2 StVG nach der Cannabis-Teillegalisierung auf 3,5 ng/ml THC angehoben Es handele sich insoweit um ein antizipiertes Sachverständigengutachten. Das ist weder materiellrechtlich noch prozessual vertretbar (treffend Burhoff, a.a.O. und die beißende Kritik von König, DAR 2024, 362, 369). Umgekehrt hat das BayObLG noch im Mai 2024 keine Veranlassung gesehen, vom analytischen Grenzwert von 1 ng/ml abzurücken (NZV 2024, 277 m. Anm. Ropertz = DAR 2024, 401 = VRR 6/2024, 22 = StRR 5/2024, 37 [jew. Burhoff]). Diese Entscheidung ist durch die Gesetzesänderung gegenstandslos. Für Altfälle vor der Reform gilt nach Inkrafttreten § 4 Abs. 3 OWiG (OLG Oldenburg, Beschl. v. 29.8.2024 – 2 ORbs 95/24). Wird in solchen Fällen der neue THC-Grenzwert von 3,5 ng/ml nicht erreichbar, ist das Verhalten nach dem neuen § 24a Abs. 1a StVG nicht mehr ordnungswidrig. Die Vorschrift des § 24a Abs. 2 StVG (sonstige berauschende Mittel) ist nicht mehr anwendbar (zur Verteidigung in Altfällen Fromm, DAR 2024, 352; Staub/Dronkovic, DAR 2024. 410, 411). Die nunmehr eingeführten Tatbestände des Mischkonsums (§ 24a Abs. 2a StVG) und des Verstoßes gegen das Cannabisverbot bei Fahranfängern (§ 24c Abs. 1 StVG) betreffen ohnehin nur Neufälle.
§ 13a FeV, Nr. 9.2.1. Anlage 4 FeV
Bereits durch das CanG vom 27.3.2024 (BGBl I, Nr. 109) wurde infolge der Teillegalisierung des Besitzes und Anbaus von Cannabis die FeV geändert, dies allerdings erst zuletzt durch den Gesundheitsausschuss (Sobota, NJW 2024, 1217, 1221). Die Frage der Klärung von Eignungszweifeln bei Cannabiskonsum wurde aus § 14 Abs. 1 S. 3 FeV entfernt und stattdessen der neue § 13a FeV geschaffen. Hierdurch soll der Komplex „Cannabis“ aus den strengeren Vorgaben der übrigen Betäubungsmittel genommen und den fahreignungsrechtlichen Regelungen bei einer Alkoholproblematik weitestgehend angeglichen werden (BT-Drucks 20/10246, S. 150). Die bislang übliche Unterscheidung zwischen einmaligem, gelegentlichem und regelmäßigem Konsum von Cannabis entfällt. Stattdessen ist jetzt die Abhängigkeit oder der Missbrauch von Cannabis maßgebend. Nunmehr ist die Beibringung eines ärztlichen Gutachtens künftig nur noch dann anzuordnen, wenn Tatsachen die Annahme von Cannabisabhängigkeit begründen. Die Beibringung eines medizinisch-psychologisches Gutachtens ist künftig dann anzuordnen, wenn Tatsachen die Annahme von Cannabismissbrauch begründen, wiederholt Zuwiderhandlungen im Straßenverkehr unter Cannabiseinfluss begangen wurden, die Fahrerlaubnis wegen einer Missbrauchsthematik entzogen worden war oder sonst zu klären ist, ob Cannabismissbrauch oder Cannabisabhängigkeit nicht mehr bestehen. Missbrauch bedeutet dabei, dass das Führen von Fahrzeugen und der die Fahrsicherheit beeinträchtigende Konsum von Cannabis nicht hinreichend sicher getrennt werden können (Fromm, DAR 2024, 352, 353; Staub/Dronkovic, DAR 2024, 410, 412; zur medizinischen Seite Graw/Brenner-Hartmann, DAR 2024, 413). Entsprechend wurde die einschlägige Tabelle in Nr. 9.2. der Anlage 4 zur FeV angepasst. Die aktuelle Neufassung ergänzt die die Formulierung in Nr. 9.2.1 Anlage 4 zur FeV:
„Das Führen von Fahrzeugen und ein Cannabiskonsum mit nicht fernliegender verkehrssicherheitsrelevanter Wirkung beim Führen eines Kraftfahrzeugs können nicht hinreichend sicher getrennt werden.“ (Aktuelle Änderung kursiv)
Damit wird die angepasste Definition von Cannabismissbrauch mit dem gesetzlichen Wirkungsgrenzwert von 3,5 ng/ml THC im Blutserum in § 24a StVG hierhin übertragen. Bei Erreichen dieses THC-Grenzwerts ist nach dem aktuellen Stand der Wissenschaft eine verkehrssicherheitsrelevante Wirkung beim Führen eines Kfz nicht fernliegend, aber deutlich unterhalb der Schwelle, ab welcher ein allgemeines Unfallrisiko beginnt. Der Begriff „nicht fernliegend“ soll dabei einen Wahrscheinlichkeitsgrad für die Verwirklichung des Straßenverkehrssicherheitsrisikos definieren und ist so zu verstehen, dass der Risikoeintritt „möglich“ ist, jedoch nicht wahrscheinlich, aber auch nicht „ganz unwahrscheinlich“ (BT-Drucks 20/11370, S. 13). Ob die Änderung der Begrifflichkeit zur Folge hat, dass sich in der Praxis bei der Beurteilung der Eignung nur wenig ändert (so Koehl, SVR 2024, 153 f), bleibt abzuwarten. Eher das Gegenteil dürfte der Fall sein (Fromm, DAR 2024, 352, 252; Staub/Dronkovic, DAR 2024, 410, 413; Ternig, NZV 2024, 257, 260; in dieser Richtung auch OVG Saarlouis, Beschl. v. 7.8.2024 – 1 B 80/24, StRR 9/2024, 30 [Deutscher], in dieser Ausgabe).
Hinweis
Der BGH (NJW 2024, 1968 = StRR 5 /2024, 24 [Burhoff]; Beschl. v. 23.4.2024 – 5 StR 153/24) hat sich auch nach Inkrafttreten des CanG hinsichtlich des Grenzwertes für die nicht geringe Menge (jetzt § 34 Abs. 3 Nr. 4 KCanG) unbeeindruckt gezeigt und hält an dem Wert von 7,5 mg fest (zur Anrechnung erlaubter Mengen BGH, Beschl. v. 30.4.2024 – 6 StR 536/23). Auch das BVerwG hält für einen Altfall der Fahrerlaubnisentziehung wegen Cannabiskonsums die bisherige Rechtslage für anwendbar, das Inkrafttreten des KCanG ändere hieran nichts (Beschl. v. 14.6.2024 – 3 B 11/23; zu Altfällen näher Fromm, DAR 2024, 352, 353).
Hinweis
Rechtsprechungsübersicht zur verwaltungsrechtlichen Entziehung der Fahrerlaubnis (Alkohol und Drogen) von Deutscher demnächst in VRR.
Punkteregelung
Schließlich wird durch die Reform die Punkteregelung in Anlage 13 der FeV verändert. Durch die eingefügte Nr. 2.2.1.a werden Verstöße gegen den neuen Grenzwert und das Verbot des Mischkonsums mit zwei Punkten belegt.
Vorläufige Bewertung
Die Teillegalisierung des Besitzes und Anbaus von Cannabis hat einen vermeintlichen Zeitgeist bedient und der Strafjustiz mangels Übergangsfristen erhebliche Mehrarbeit bereitet. So ist auf der Homepage des BGH gegenwärtig eine Vielzahl von Entscheidungen aufgeführt, die in der Sache an sich rechtlich zutreffende Entscheidungen der Landgerichte wegen der besagten Änderung abändern oder zumindest teilweise aufheben und zurückverweisen müssen. Ziel der nun erfolgten Festlegung des Grenzwerts auf 3,5 ng/ml ist, dass der Konsum von Cannabis und das Führen von Kfz im Straßenverkehr getrennt werden. Zugleich soll dies nicht mit einer Erhöhung der Sicherheit des Straßenverkehrs einhergehen (BT-Drucks 20/11370, S. 11). Die Auswirkungen der hier vorgestellten Reform auf die Sicherheit des Straßenverkehrs bleiben abzuwarten. Zweifel sind hier angebracht (in dieser Richtung auch Ternig, NZV 2024, 257 und treffend König, DAR 2024, 362, 370: Auf solcher Basis „kann man keine Gesetze machen, die dem Anspruch auf ein Mindestmaß an Seriosität genügen“). Die Auswirkung des Konsums ist individuell unterschiedlich und abhängig von der Konsumfrequenz. Das begünstigt subjektive Fehleinschätzungen der Auswirkungen des Konsums auf die eigene Fahrtüchtigkeit. Zweifelhaft erscheint daher insbesondere die Gleichstellung der Wirkung des Konsums von Alkohol und des Konsums von Cannabis. Anders als beim Alkohol ist die Wirkung von Cannabis bzw. THC im Körper noch nicht abschließend erforscht (Koehl, SVR 2024, 162) und es gibt keine Konsummenge-Wirkungs-Relation. Zwar hat die Expertengruppe in ihrem Gutachten (S. 5) dargelegt, dass ein Wirkstoffgehalt von 2–5 ng/ml THC im Blutserum einer Beeinträchtigung für die Verkehrssicherheit von 0,2 Promille Blutalkohol entspricht. Allerdings haben der legale Konsum und Besitz von Alkohol in Deutschland eine lange Tradition mit der Folge, dass ein gesellschaftliches Bewusstsein dahingehend vorhanden ist, dass die Notwendigkeit der Trennung des Konsums von Alkohol vom Führen von Kfz besteht. Es steht zu befürchten, dass das Bewusstsein, dass der Besitz von Cannabis bis zu einer gewissen Menge erlaubt ist, jedenfalls für längere Zeit bei vielen Konsumenten die Vorstellung erweckt, nunmehr auch unter Einfluss von Cannabis fahren zu dürfen. Dies dürfte insbesondere jüngere Konsumentengruppen betreffen, wobei die Ausweitung des in § 24c StVG bestehenden Alkoholverbots auch auf Cannabis bei Fahranfängern dem zwar entgegenwirken soll, es aber auf einige Zeit fraglich ist, ob diese Vorgabe auch zu diesem Personenkreis durchdringt. Dabei spielt auch eine Rolle, dass über die letzten 20 Jahre nach der Erfahrung des Verfassers eine deutliche Steigerung des Wirkstoffgehalts von Cannabis festzustellen ist. War damals bei Besitz oder Handeltreiben ein Wirkstoffgehalt von 5–10 % üblich, hat sich dieser zwischenzeitlich im Durchschnitt auf 10–20 % erhöht („Haze“). Damit besteht allerdings auch ein erhöhtes Risiko der Selbstüberschätzung bei der Beurteilung der Auswirkungen des Konsums auf die Verkehrstüchtigkeit insbesondere bei Fahrten, die längere Zeit nach dem Konsum durchgeführt werden. Insofern wird sich eine Risikoerhöhung für die Straßenverkehrssicherheit ergeben.
Auch erfordert der neue Grenzwert angepasste Ahndungsmöglichkeiten bei den Verfolgungsbehörden, kombiniert mit einem entsprechenden Verfolgungsdruck. Zwar berechtigt in einer Anhaltesituation das Vorliegen von körperlichen oder fallbezogenen Ausfallerscheinungen zu der Anordnung einer entsprechenden Blutprobe. Sind solche Ausfallerscheinungen allerdings nicht vorhanden, sollen entsprechende Speicheltests mit hoher Empfindlichkeit als Vorscreening die Grundlage für eine mögliche Blutentnahme bilden. Insofern handelt es sich aber um einen Scheck auf die Zukunft, da solche Speicheltests noch nicht flächendeckend vorhanden sind (BT-Drucks 20/11370, S. 11) und die üblichen Urintests nicht geeignet sind (Sobota, NJW 2024, 1217, 1221).


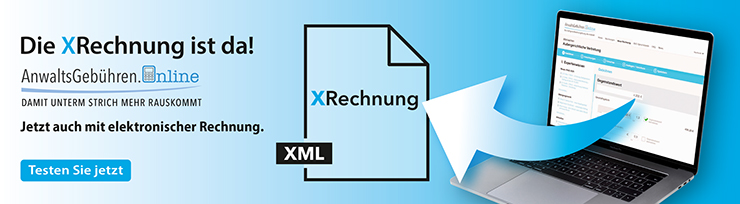

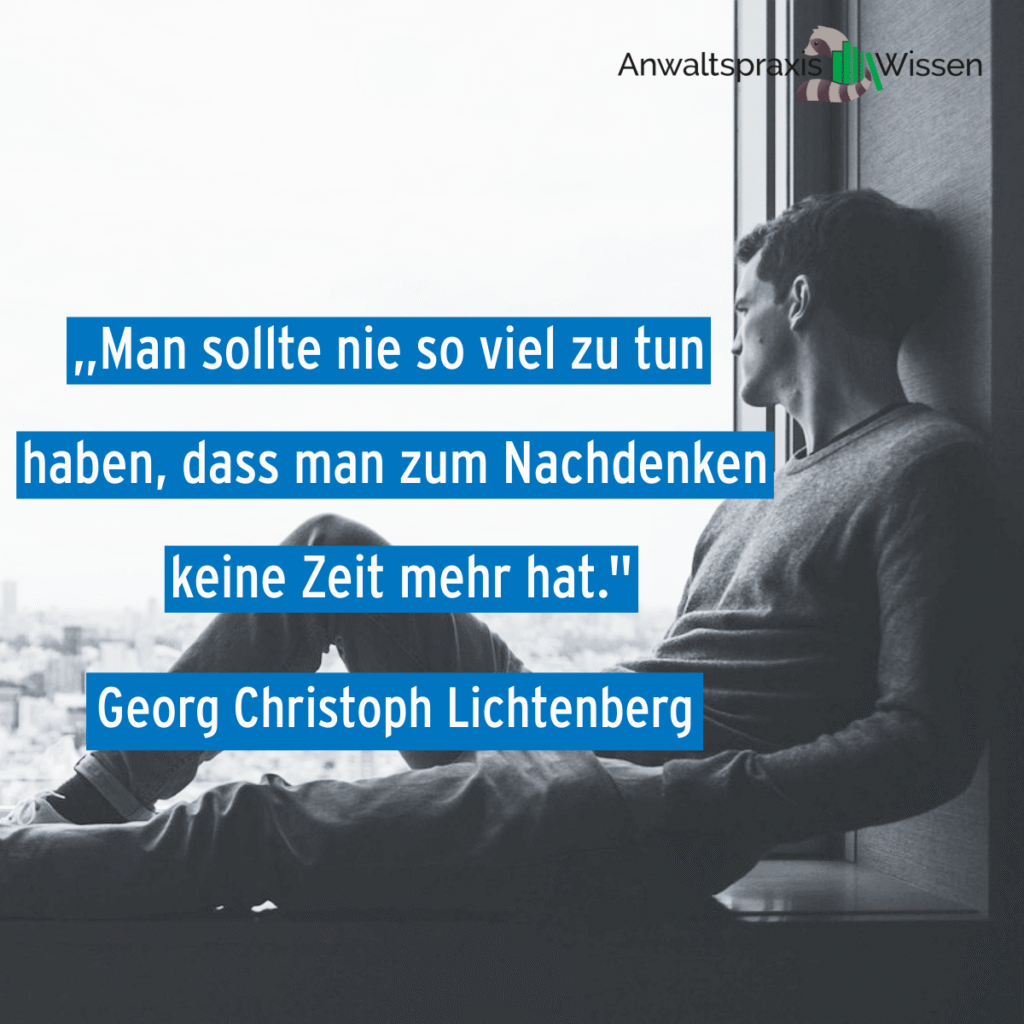
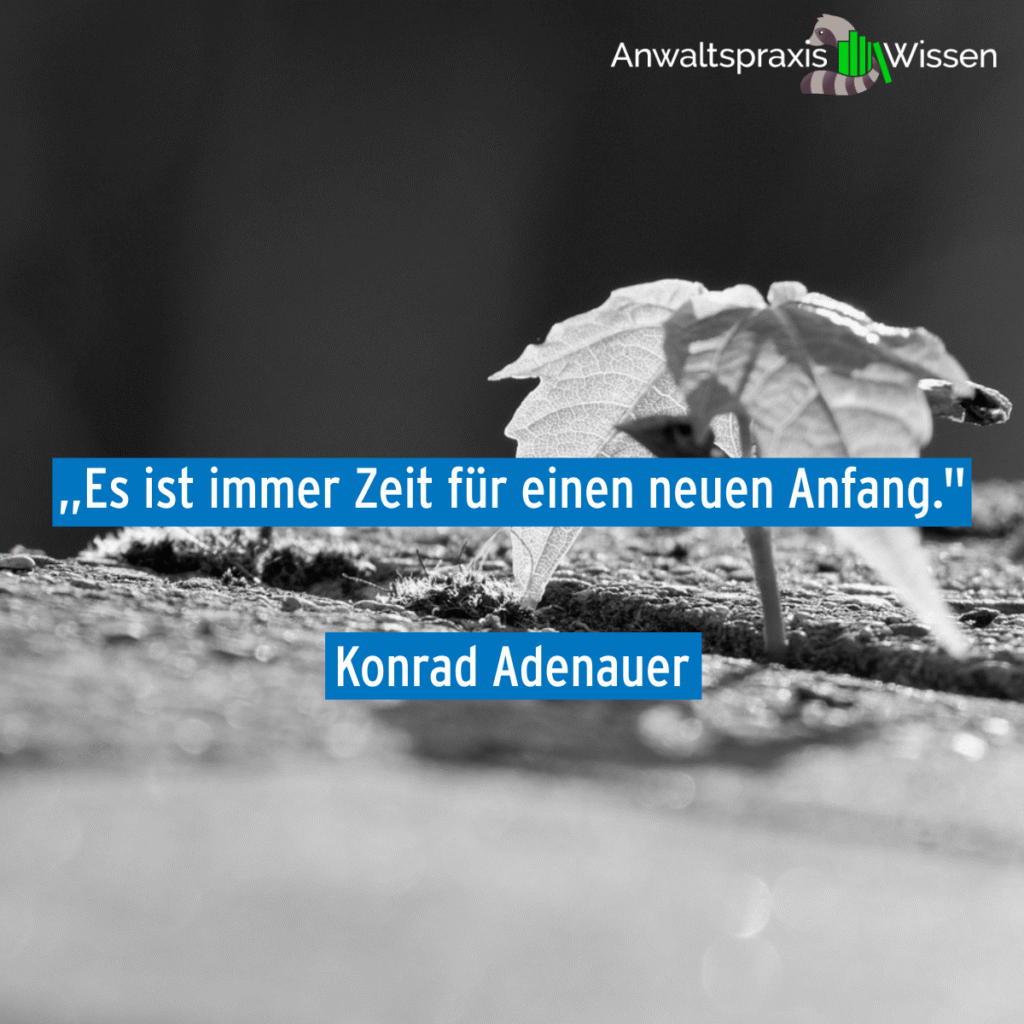

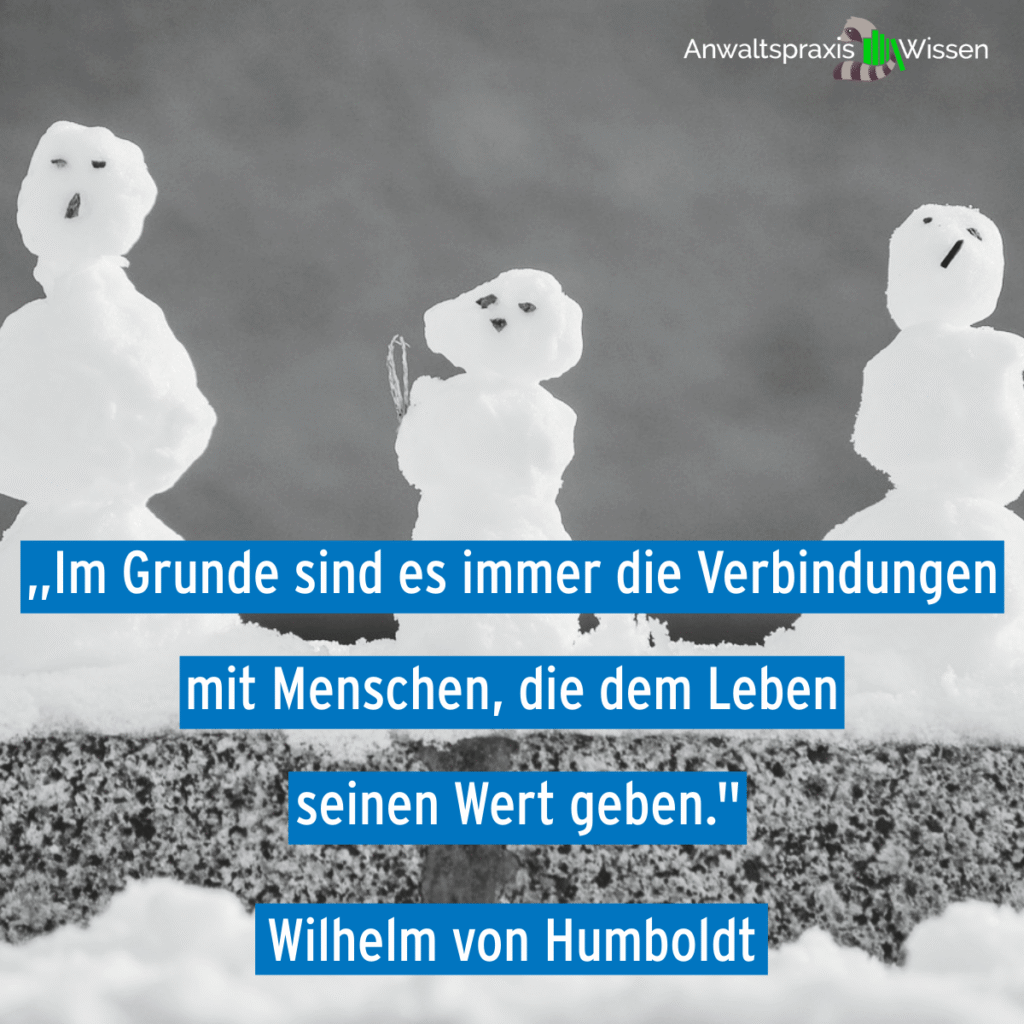
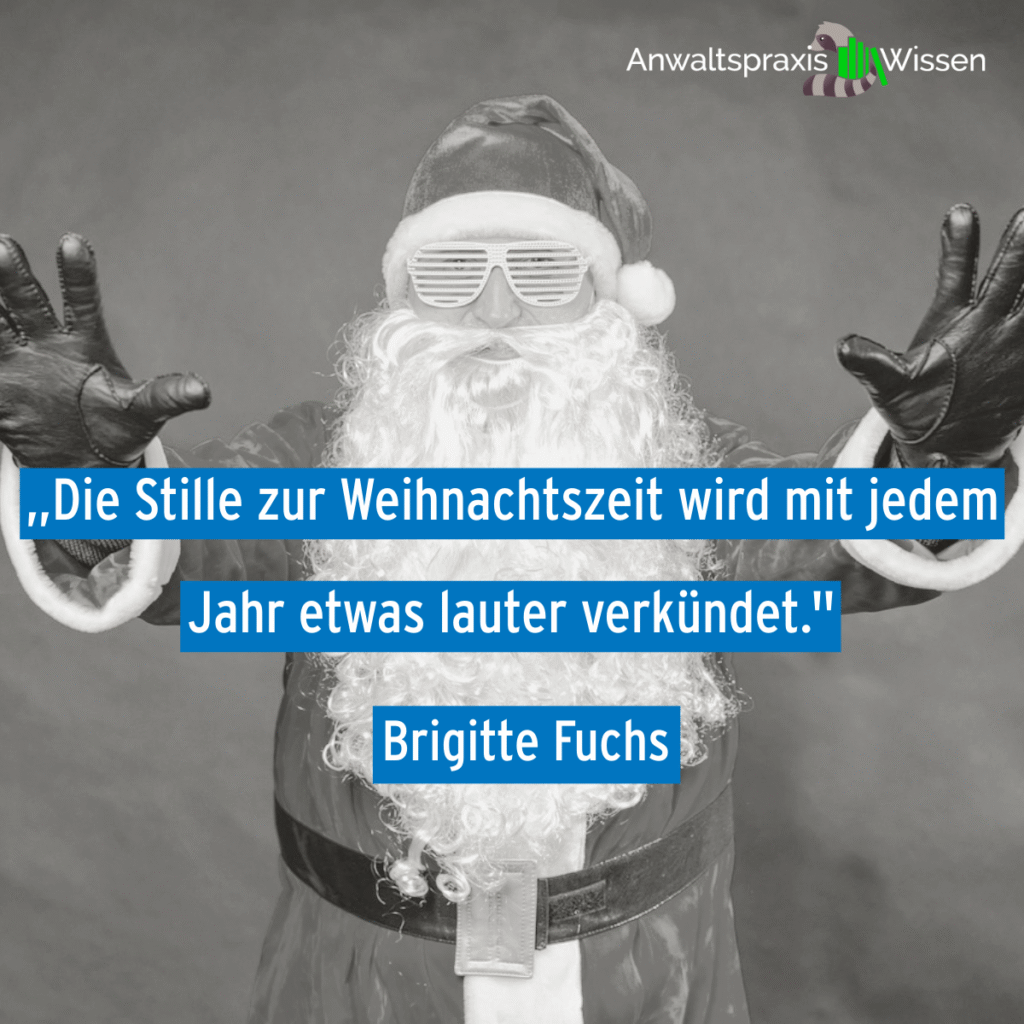
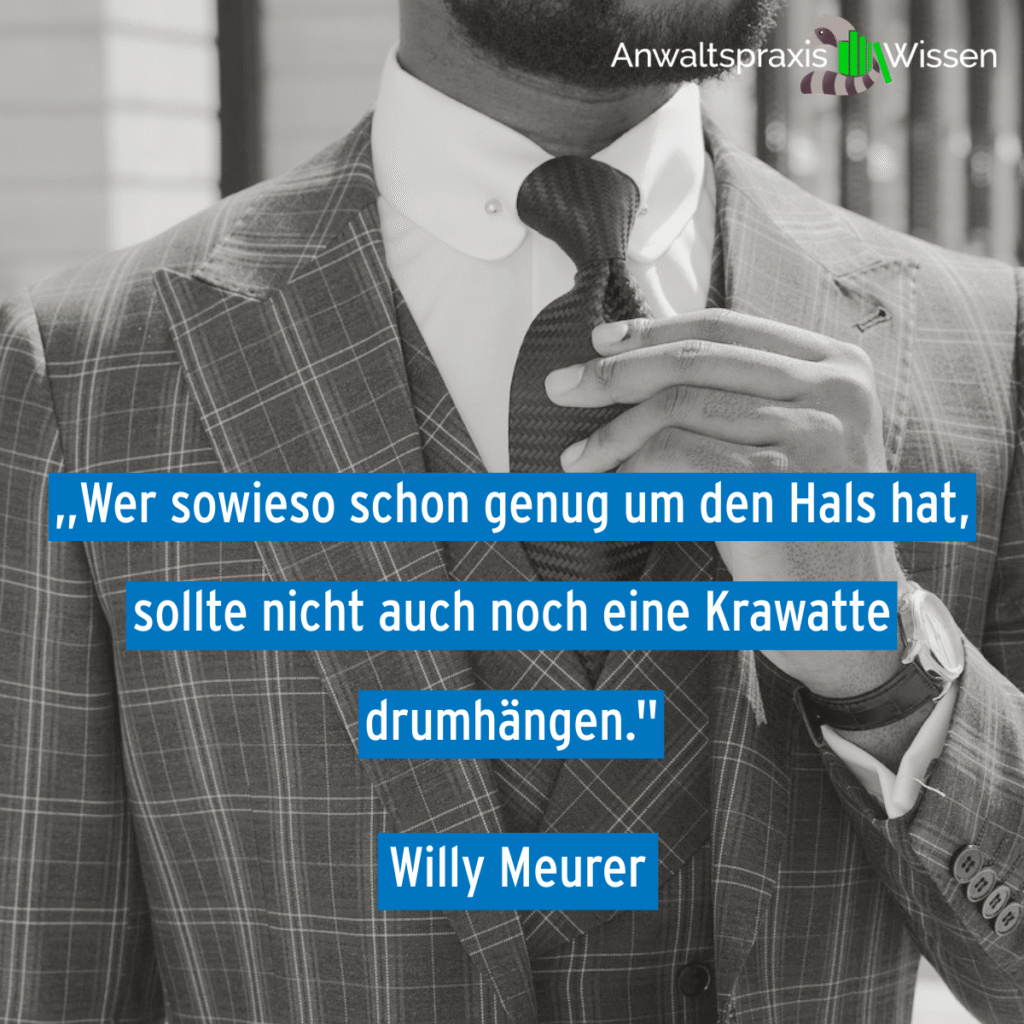



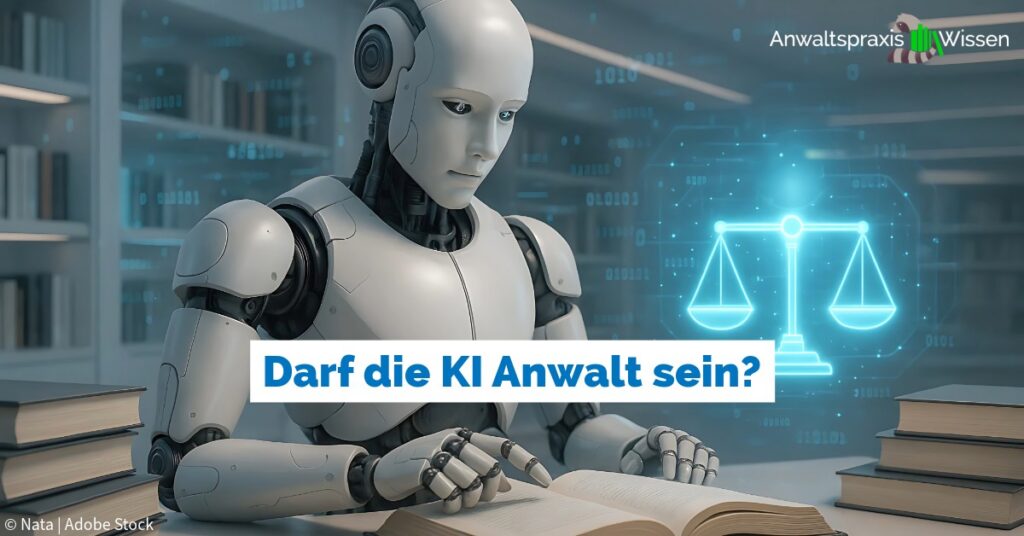

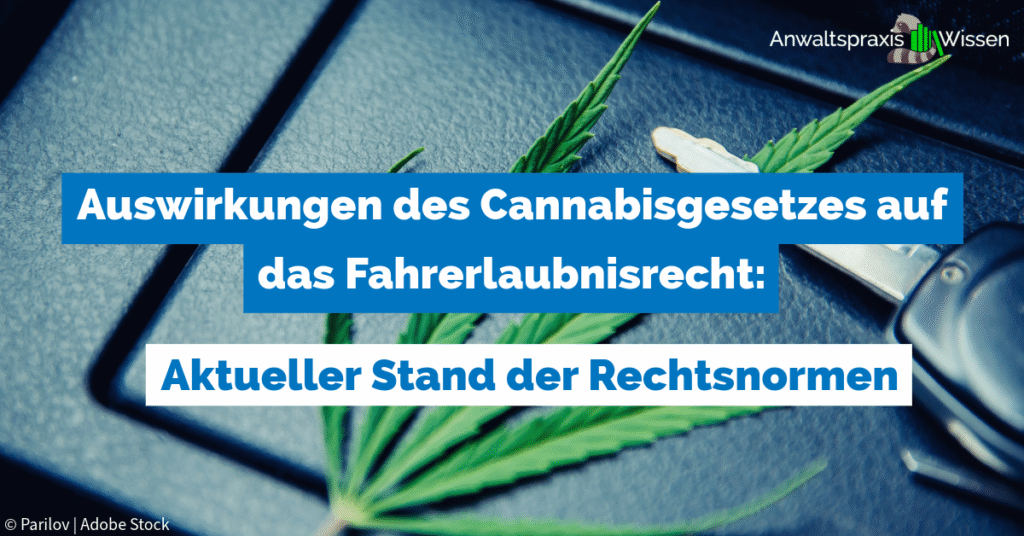

![Erbrecht im Gespräch: Kurze[s] Update: #21 Ehegatten: Testament oder Erbvertrag? – mit Dr. Markus Sikora](https://anwaltspraxis-magazin.de/wp-content/uploads/2025/11/Erbrecht-im-Gespraech-21-1024x536.jpeg)