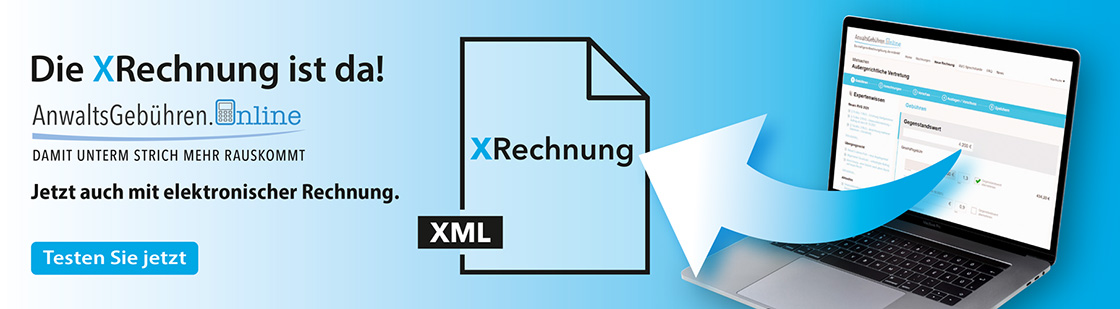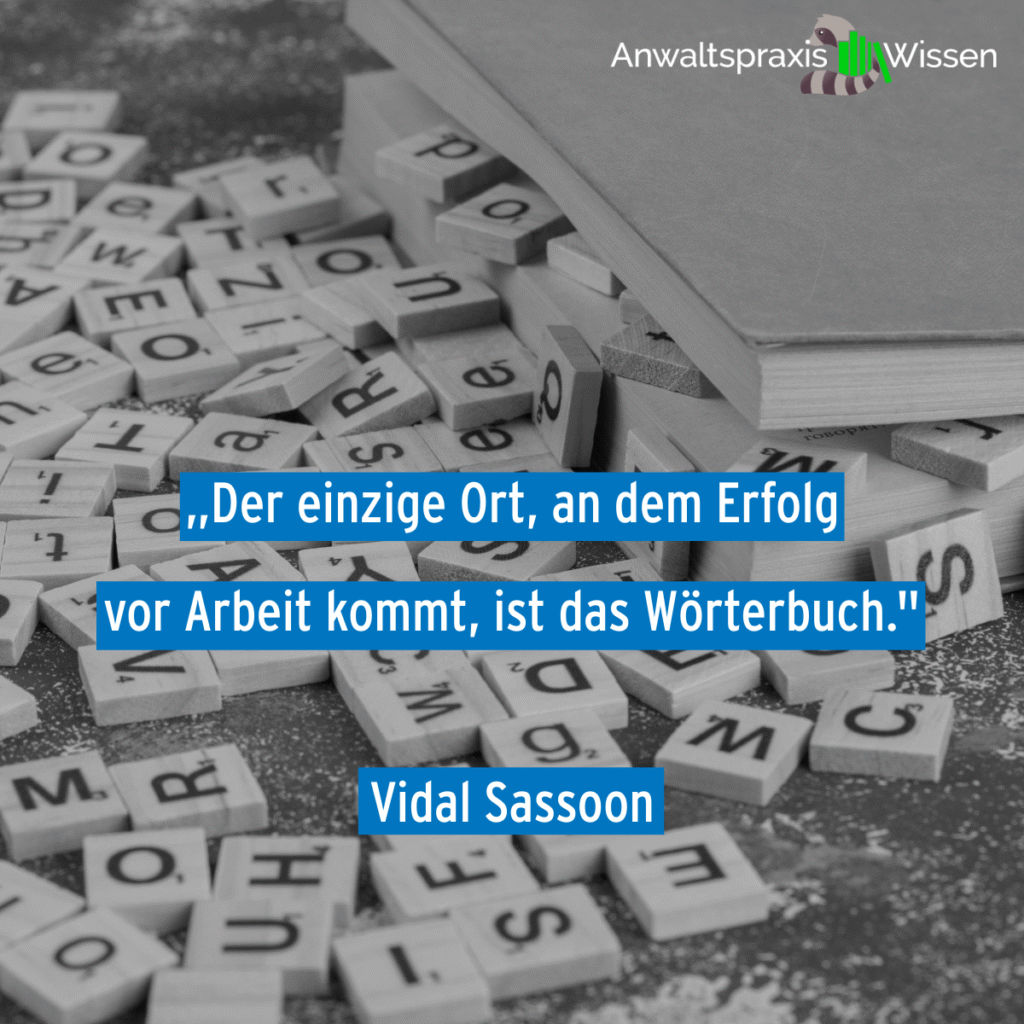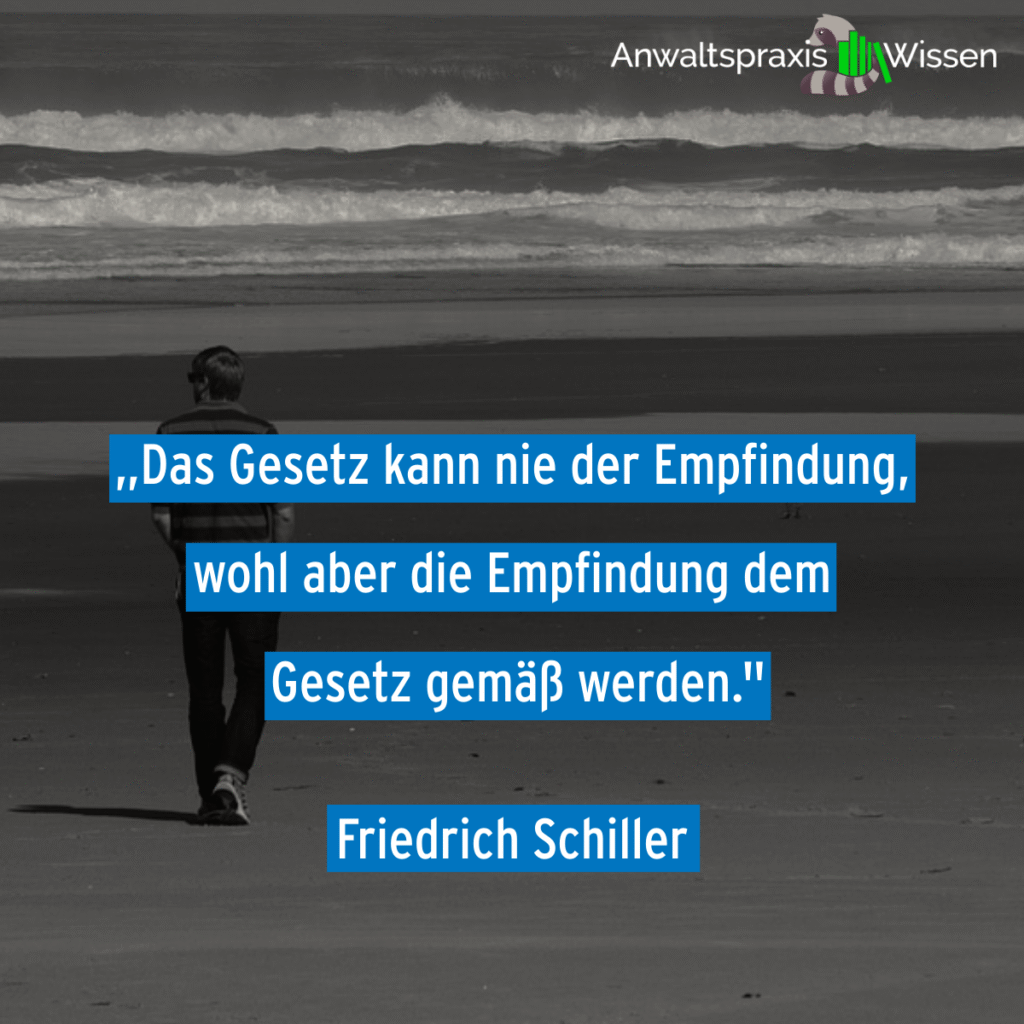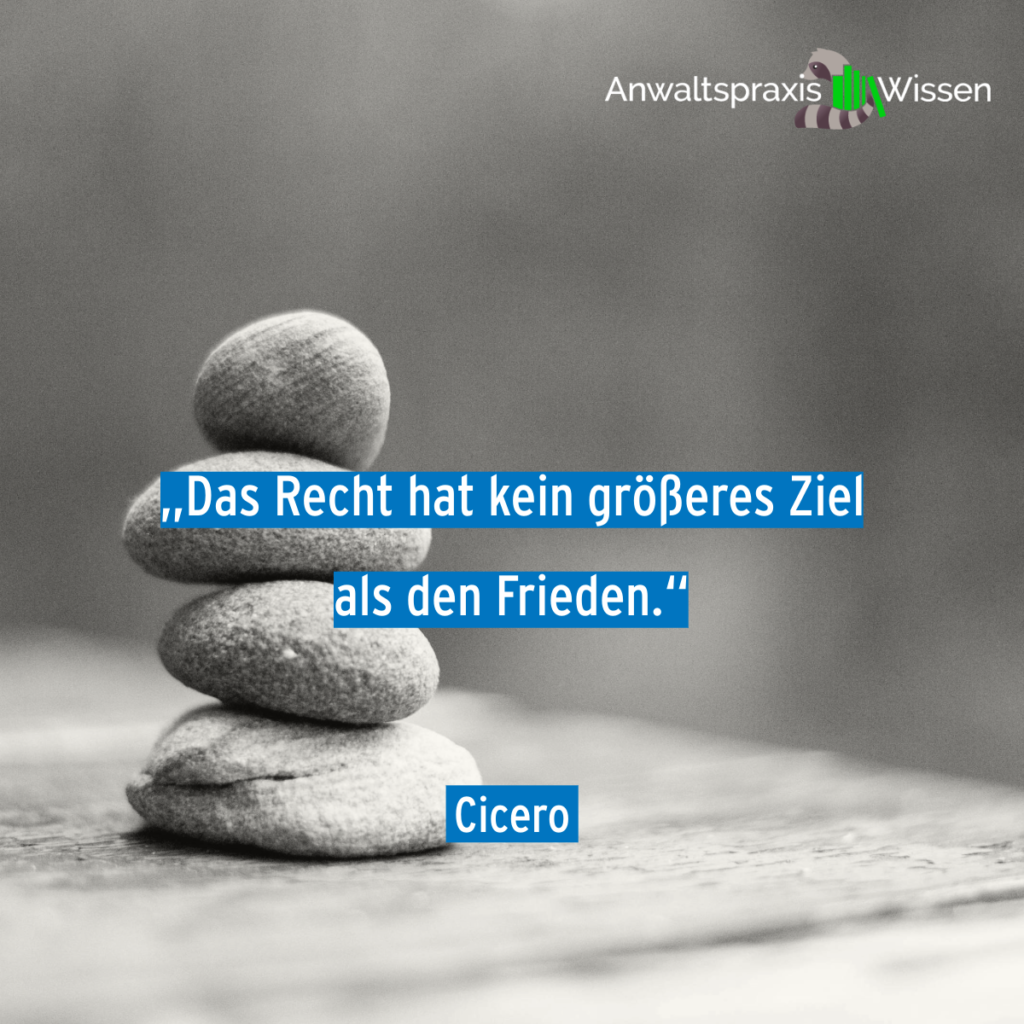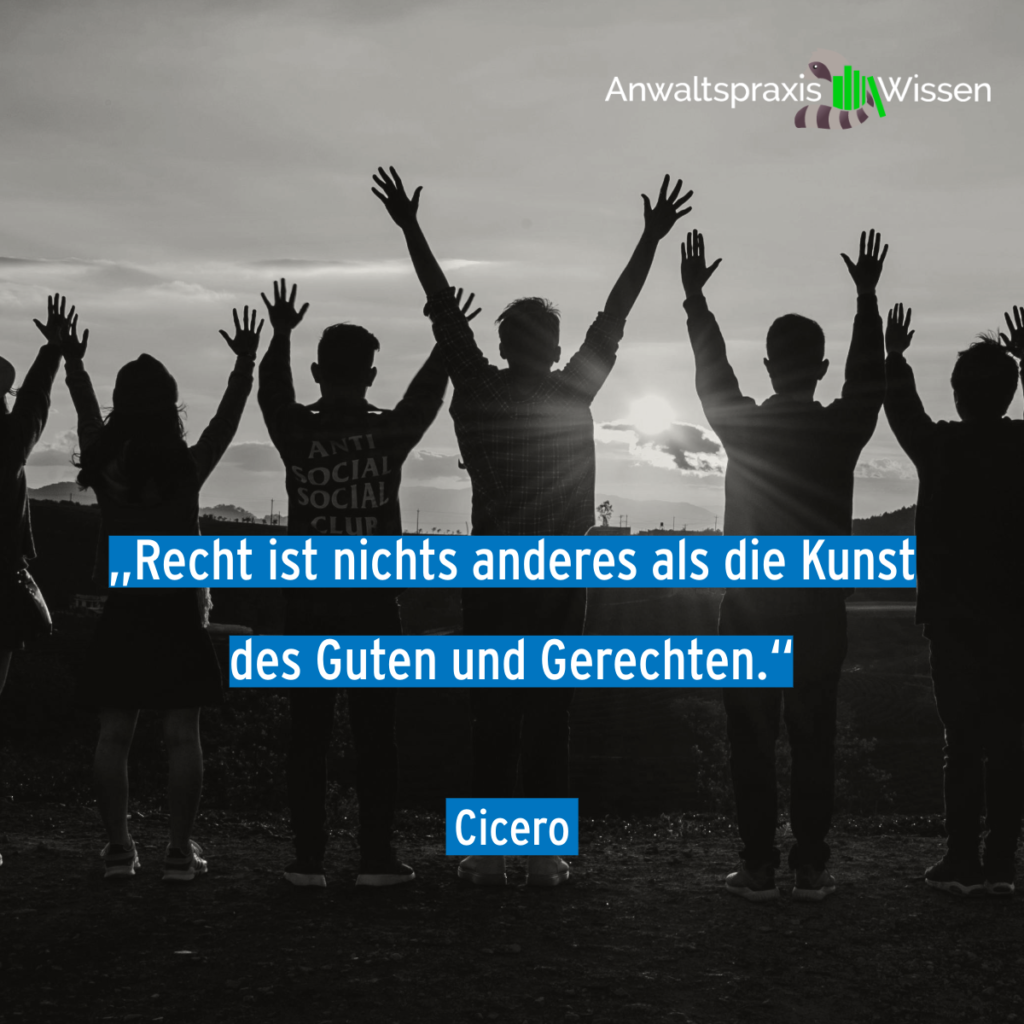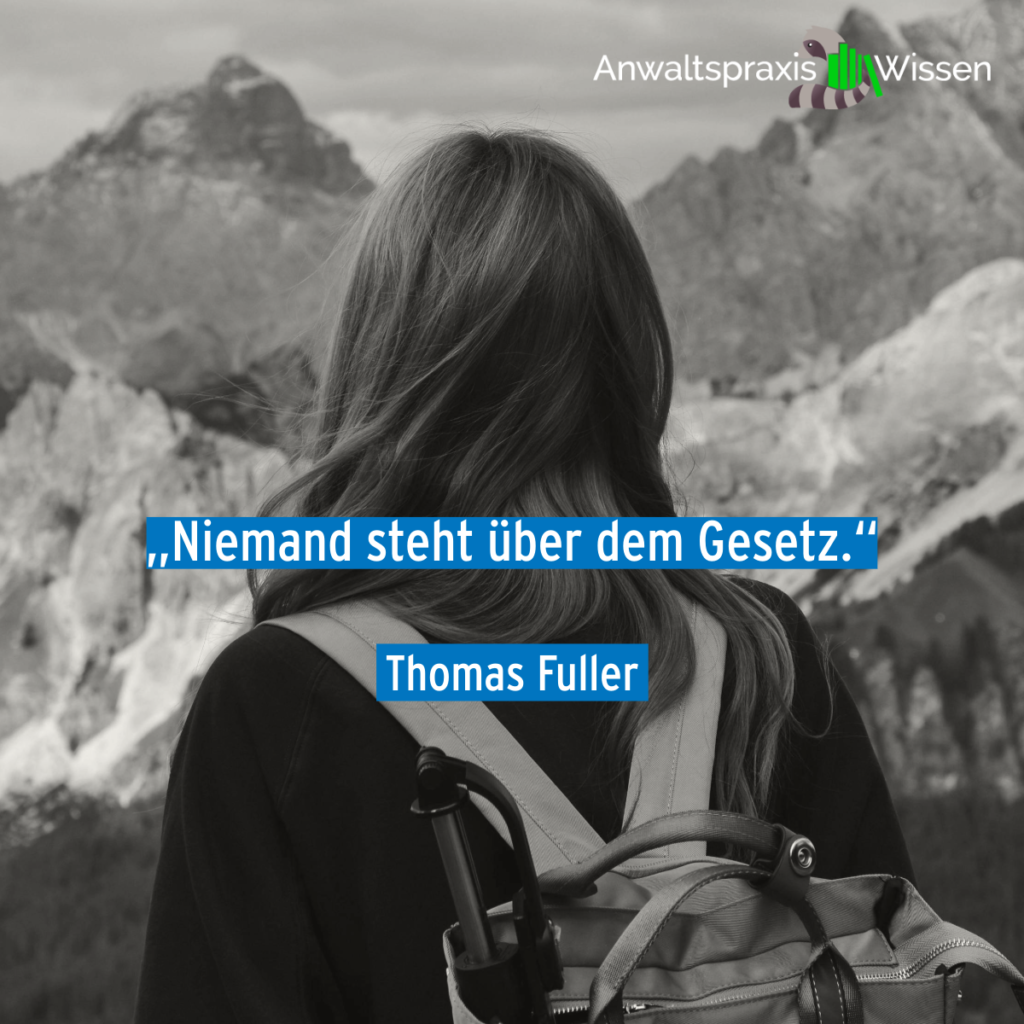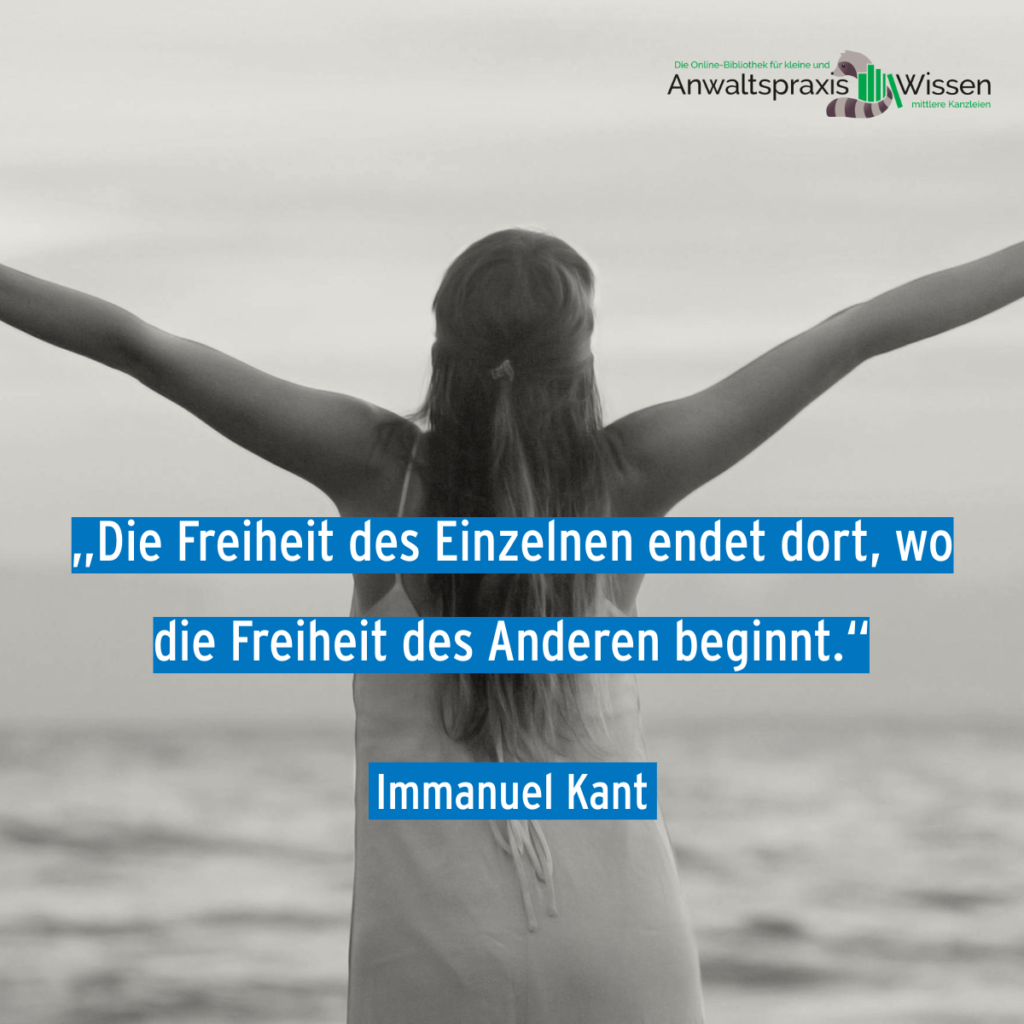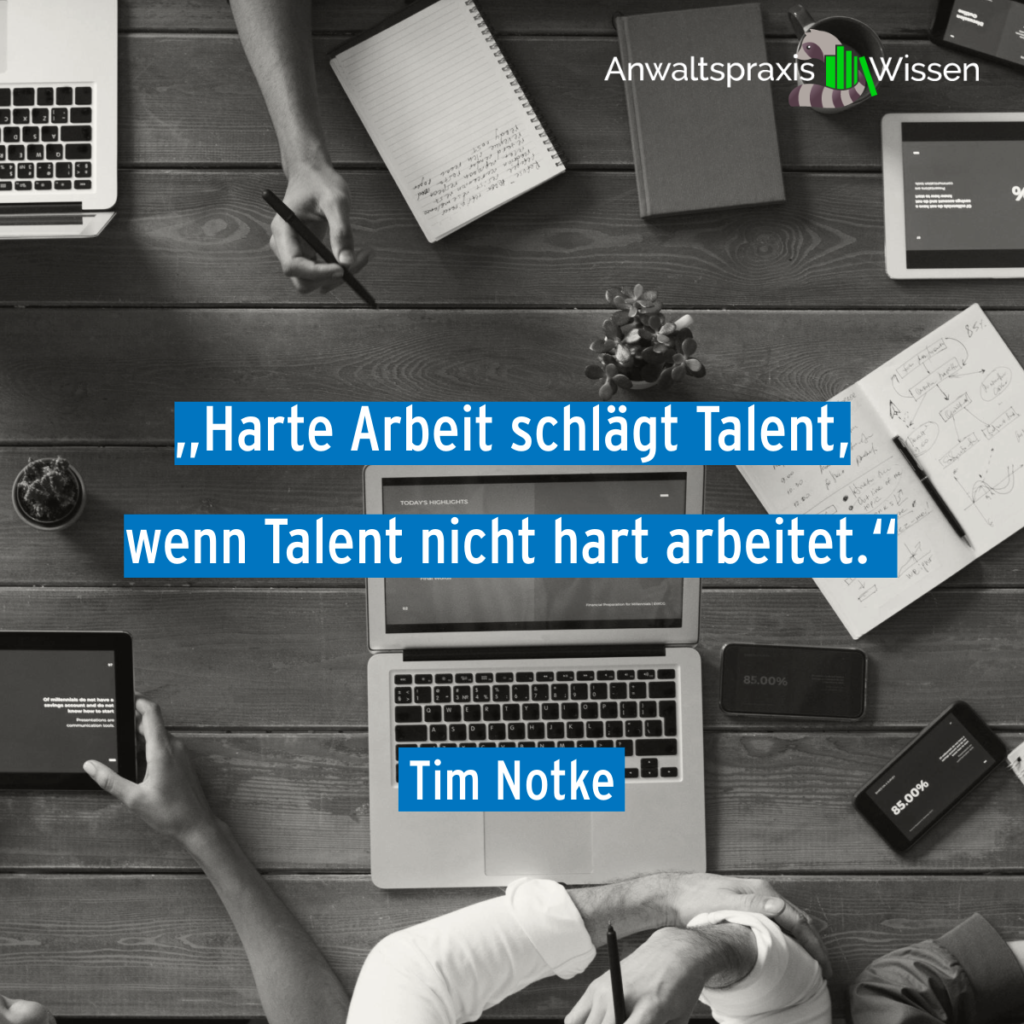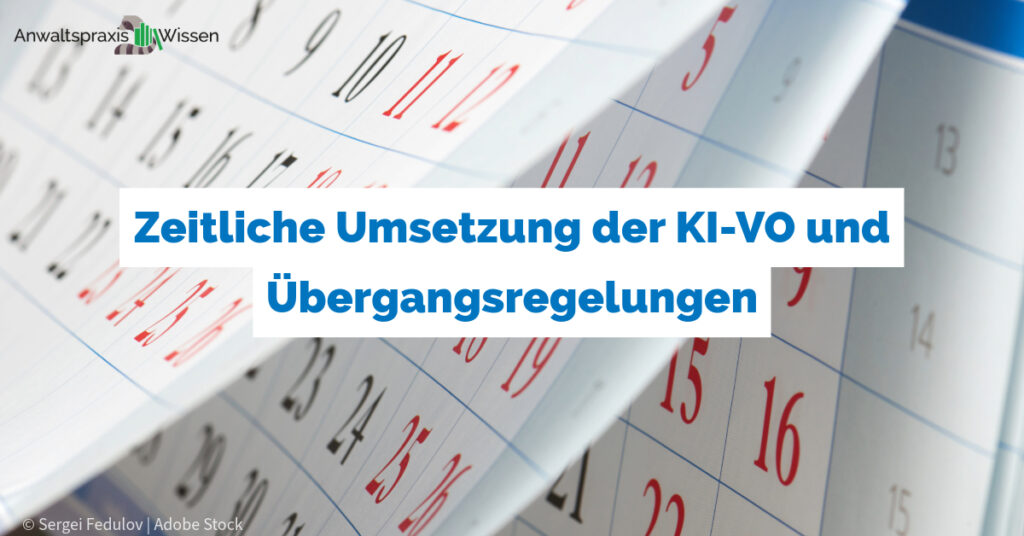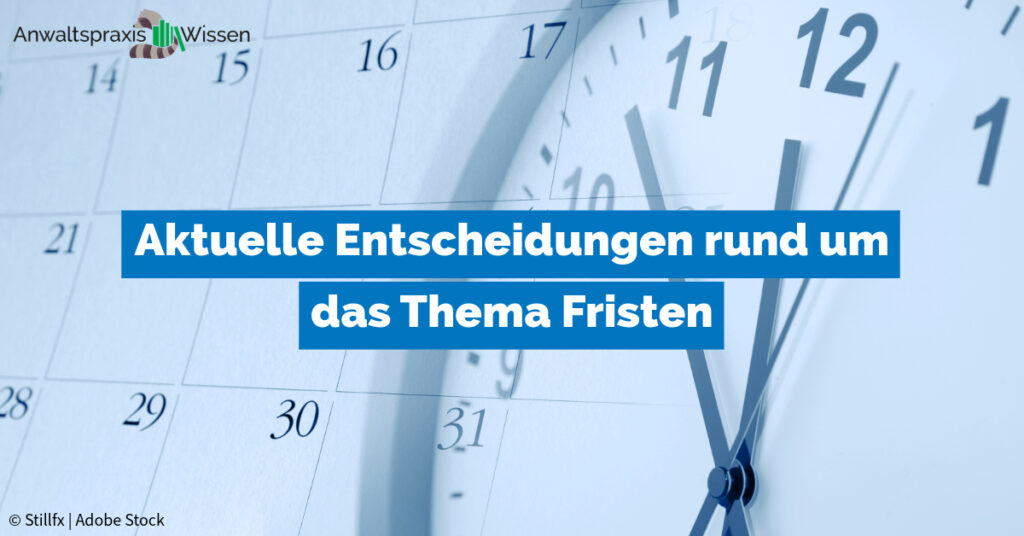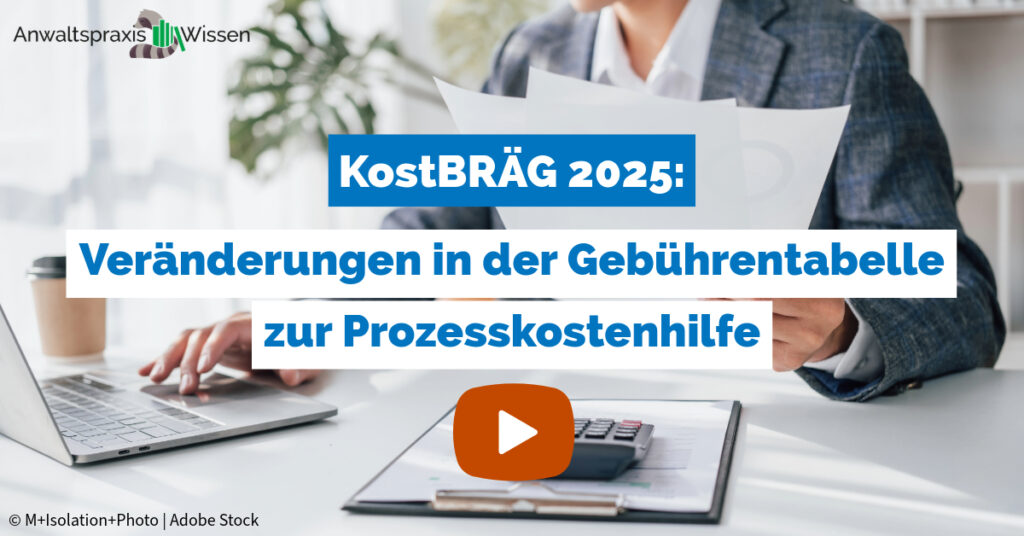Im Jahr 2023 gab es eine Vielzahl von Ereignissen, die das gesellschaftliche und politische Geschehen in Deutschland und weltweit geprägt haben. Abweichend von den vorangegangenen Jahren, die stark von der Corona-Pandemie dominiert waren, rückten in diesem Jahr andere Themen in den Vordergrund. Von der Einführung des Bürgergeldes als Ersatz für Hartz IV über den Start des Deutschland-Tickets bis zu Naturkatastrophen, um nur einige wenige zu nennen. Darüber hinaus ereigneten sich geopolitische Konflikte wie der Überfall der Hamas auf Israel und der fortwährende Krieg in der Ukraine. Die anhaltend hohe Inflation führte zu wirtschaftlichen Herausforderungen und schließlich stürzte ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts die Regierungskoalition in eine ernsthafte Haushaltskrise.
Wir konzentrieren uns auf das Arbeitsrecht und richten den Blick darauf, welche arbeitsrechtlichen Neuerungen im kommenden Jahr zu erwarten sind.
Mindestlohn
Ab dem 1.1.2024 wird der Mindestlohn von 12,– EUR auf 12,41 EUR erhöht. Dies entspricht dem Vorschlag der Mindestlohnkommission.
Der gesetzliche Mindestlohn gilt nicht für Auszubildende. Seit dem 1.1.2020 sind Arbeitgeber, die keinem Tarifvertrag unterliegen, verpflichtet, ihren Auszubildenden einen Mindestlohn zu zahlen. Dieser Mindestlohn erhöht sich jährlich zum Ausbildungsbeginn. Auszubildende, die im Jahr 2024 ihre Berufsausbildung beginnen, erhalten im ersten Lehrjahr nun mindestens 649,– EUR pro Monat.
Gleichzeitig steigt die dynamische Geringfügigkeitsgrenze zum 1.1.2024 von 520,– EUR auf 538,– EUR pro Monat. Diese Anpassung ermöglicht es Minijobbern im kommenden Jahr zusätzlich 18,– EUR pro Monat zu verdienen, ohne dass dabei für sie Abgaben zur Sozialversicherung anfallen.
Anpassung der Vorschriften über die Betriebsratsvergütung
Aufgrund der in der Praxis aufgetretenen rechtlichen Unsicherheiten bei der Festsetzung der Vergütung von Betriebsratsmitgliedern beabsichtigt der Gesetzgeber, die gesetzlichen Vorschriften anzupassen.
Es soll gesetzlich festgelegt werden, dass bei der Bestimmung der vergleichbaren Arbeitnehmer für das Betriebsratsmitglied der Zeitpunkt der Übernahme des Betriebsratsamts maßgeblich ist. Unter Vorliegen eines sachlichen Grundes kann eine Neubestimmung der Vergleichsgruppe erfolgen. Die Betriebspartner können zudem durch eine Betriebsvereinbarung ein Verfahren zur Festlegung vergleichbarer Arbeitnehmer regeln. Um Transparenz zu fördern wird vorgeschlagen, dass die Konkretisierung der Vergleichbarkeit in der Betriebsvereinbarung sowie die nachfolgende einvernehmliche Festlegung der konkreten Vergleichspersonen zwischen Arbeitgeber und Betriebsrat in Textform nur auf grobe Fehlerhaftigkeit überprüft werden kann.
Des Weiteren sollen im Einklang mit der Rechtsprechung die Kriterien des Begünstigungs- und Benachteiligungsverbots konkretisiert werden. Eine Begünstigung oder Benachteiligung bezüglich des gezahlten Arbeitsentgelts liegt demnach nicht vor, wenn das Betriebsratsmitglied die für die Gewährung des Arbeitsentgelts erforderlichen Anforderungen und Kriterien erfüllt und die Festlegung nicht ermessensfehlerhaft erfolgt.
Im Übrigen verweise ich auf den instruktiven Aufsatz meines Kollegen Peter Hützen im Infobrief Arbeitsrecht 09 2023.
Krankschreibung per Telefon
Nachdem der „Gelbe Zettel“, die Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung auf Papier, bereits zu Jahresbeginn für gesetzliche Krankenversicherte durch die elektronische Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung ersetzt wurde, gibt es weitere Neuerungen zur telefonischen Krankschreibung.
Die Krankschreibung per Telefon hatte sich bereits während der Corona-Pandemie bewährt. Die Regelung hatte dazu beigetragen, die Verbreitung des Virus einzudämmen. Nach mehrmaliger Verlängerung ist sie am 31.3.2023 ausgelaufen.
Die Krankschreibung per Telefon ist bei Erkrankungen wie leichten grippale Infekten nun dauerhaft möglich. Das hat der Gemeinsame Bundesausschuss von Ärzten, Krankenkassen und Kliniken (G-BA) in seiner Sitzung am 7.12.2023 beschlossen. Versicherte können diese Möglichkeit seitdem nutzen.
Bei einer leichten Atemwegserkrankung können Versicherte, die arbeitsunfähig sind, bis zu fünf Kalendertage telefonisch krankgeschrieben werden. Ärzte stellen hierfür am Telefon Fragen zu den Beschwerden und entscheiden, ob eine telefonische Krankschreibung möglich ist oder eine Untersuchung in der Praxis erforderlich ist.
Es ist indes nicht möglich, die telefonische Krankschreibung telefonisch zu verlängern. Falls eine Folgebescheinigung erforderlich ist, muss der Versicherte die Praxis persönlich aufsuchen. Sollte der behandelnde Arzt die erstmalige Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung jedoch während eines Praxisbesuchs ausgestellt haben, kann er diese Krankschreibung telefonisch verlängern.
Nach Presseberichten will nun Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach die telefonische Krankschreibung auch für Eltern erkrankter Kinder einführen. Danach bat er die Kassenärztliche Bundesvereinigung (KBV) und den Spitzenverband der gesetzlichen Krankenversicherungen (GKV) in einem Brief, zeitnah eine entsprechende Vereinbarung zu treffen. Damit sollen die Arztpraxen entlastet werden. Ob und wann die angeregte Möglichkeit auch für Eltern beim Kinderkrankengeld kommen wird, ist noch offen.
Kinderkrankengeld
Ab dem 1.1.2024 wird der gesetzliche Anspruch auf Kinderkrankengeld von bisher regulär zehn auf 15 Arbeitstage je gesetzlich versichertem Elternteil pro Kind im Kalenderjahr erhöht. Die Gesamtzahl der Anspruchstage wird dabei von 25 auf 35 Tage im Jahr angehoben.
Für Alleinerziehende erhöht sich der reguläre Anspruch von 20 auf 30 Arbeitstage pro Kind, wobei der maximale Anspruch auf 70 Arbeitstage im Jahr festgelegt ist.
Diese Änderungen wurden am 27.9.2023 im Rahmen des sog. Pflegestudiumstärkungsgesetzes durch den Gesundheitsausschuss des Deutschen Bundestags eingeführt. Das Gesetz erhielt die Zustimmung des Bundesrats am 24.11.2023.
Die Neuregelung war erforderlich, weil die Corona-Sonderregelungen Ende 2023 auslaufen.
Hinweisgeberschutzgesetz
Das Gesetz für einen besseren Schutz hinweisgebender Personen (Hinweisgeberschutzgesetz – HinSchG) ist bereits am 2.7.2023 in Kraft getreten.
Hintergrund des Gesetzes ist, dass Beschäftigte in Unternehmen und Behörden Missstände oftmals als erste wahrnehmen und durch ihre Hinweise dafür sorgen können, dass Rechtsverstöße aufgedeckt, untersucht, verfolgt und unterbunden werden. Hinweisgeber übernehmen Verantwortung für die Gesellschaft und verdienen daher Schutz vor Benachteiligungen, die ihnen wegen ihrer Meldung drohen und sie davon abschrecken können.
Das HinSchG regelt, dass Unternehmen und Behörden mit in der Regel mindestens 50 Beschäftigten ein internes Hinweisgebersystem, die „interne Meldestelle“, einrichten und betreiben müssen. Seit Inkrafttreten des Gesetzes gilt dies bereits für private Beschäftigungsbetriebe mit in der Regel mindestens 250 Beschäftigten, öffentlich-rechtliche Beschäftigungsbetriebe mit in der Regel mindestens 50 Beschäftigten und Finanzinstitute unabhängig von der Beschäftigtenzahl. Die Übergangsfrist für Unternehmen und Organisationen mit 50 oder mehr Beschäftigten endet am 17.12.2023.
Das Nichteinrichten einer internen Meldestelle ist nach § 40 Abs. 2 Nr. 2 HinSchG bußgeldbewehrt. Das Bußgeld kann bis zu 20.000,– EUR betragen, § 40 Abs. 6 HinSchG.
Im Übrigen verweise ich auf meinen Aufsatz im Infobrief Arbeitsrecht 06 2023.
Arbeitszeitgesetz
Nachdem im April 2023 der Referentenentwurf für Änderungen im Arbeitszeitgesetz bekannt wurde, der vorsieht, dass Arbeitgeber die Arbeitszeiten ihrer Mitarbeiter – möglicherweise elektronisch – aufzeichnen müssen, dachte man zunächst, dass es zeitnah einen offiziellen Gesetzesentwurf geben würde.
Stattdessen hat das Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) im Mai 2023 umfangreiche „Fragen und Antworten zur Arbeitszeiterfassung“ auf seinen Internetseiten veröffentlicht, die dort auch noch zugänglich sind. Hierin soll man nach der einleitenden Ankündigung des BMAS „Antworten auf die häufigsten Fragen zur Arbeitszeiterfassung“ im Lichte der Rechtsprechung des EuGH zur Arbeitszeiterfassung finden.
Überraschenderweise ist bislang immer noch kein Gesetzentwurf vorgelegt worden. Das Arbeitszeitgesetz scheint kein aktuelles „to-do“ des Bundestages zu sein. Auch sind keine weiteren Schritte durch das BMAS angekündigt. Ob und wann sich 2024 etwas tun wird, ist damit weiterhin ungewiss und bleibt abzuwarten.
Weiterentwicklung der Fachkräfteeinwanderung
Das Gesetz zur Weiterentwicklung der Fachkräfteeinwanderung wurde am 7.7.2023 im Bundesrat beschlossen. Das Gesetz besteht aus mehreren Teilen, die beginnend mit dem 18.11.2023, sowie dann zum 1.3.2024, zum 1.6.2024 sowie zum 1.1.2026 sukzessive in Kraft treten. So soll sichergestellt werden, dass die betroffenen Behörden genügend Zeit für die Umsetzung haben.
Bereits zum 18.11.2023 sind folgende Neuregelungen in Kraft getreten.
-
Ausweitung der Einwanderungsmöglichkeiten mit der neu gestalteten Blauen Karte EU in fristgerechter Umsetzung der revidierten Hochqualifizierten- Richtlinie
-
Anspruch auf Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis für Fachkräfte mit Berufsausbildung oder akademischer Ausbildung bei Vorliegen sämtlicher für die Erteilung erforderlicher Voraussetzungen
-
Wegfall der Beschränkung, dass man nur aufgrund der mit dem Berufsabschluss vermittelten Befähigung arbeiten darf, d.h. Ausbildung muss nicht zur ausgeübten Tätigkeit befähigen oder der Tätigkeit angemessen sein, sondern es reicht die Ausübung jeder qualifizierten Tätigkeit
-
vereinfachte Zustimmungserteilung der Bundesagentur für Arbeit für die Beschäftigung von Berufskraftfahrern aus Drittstaaten.
Weitere Regelungen zur Beschäftigung und Anerkennung treten dann ab März 2024 in Kraft. Diese ermöglichen den Aufenthalt zur Anerkennung einer ausländischen Berufsqualifikation. Unter bestimmten Voraussetzungen dürfen auch Berufserfahrene ohne in Deutschland formal anerkannten Abschluss hier dann arbeiten.
Ab Juni 2024 wird die sog. Westbalkanregelung entfristet, wonach Staatsangehörige aus Albanien, Bosnien und Herzegowina, Kosovo, Montenegro, Nordmazedonien und Serbien erleichterten Arbeitsmarktzugang in Deutschland haben, und das insoweit zur Verfügung stehende Kontingent wird auf 50.000 pro Jahr verdoppelt. Außerdem wird die Chancenkarte, die unter bestimmten Voraussetzungen einen Aufenthalt zur Arbeitssuche ermöglicht und an das sog. points-based system angelehnt ist, eingeführt.
Die letzte Neuregelung durch das Gesetz zur Weiterentwicklung der Fachkräfteeinwanderung wird dann – dies nur der Vollständigkeit halber – zum 1. 1.2026 in Kraft treten und sieht die Errichtung von staatlichen Beratungsstellen für Ausländer sowie eine Hinweispflicht des Arbeitgebers vor, welcher dieser gleich am ersten Tag der Beschäftigung nachzukommen hat, was allerdings erfreulicherweise in Textform geschehen können soll.
Im Hinblick auf die Neuregelungen aus November 2023 verweise ich auf die profunde Analyse meines Kollegen Dr. Gunther Mävers im Infobrief Arbeitsrecht 08 2023. Auch über die 2024 bzw. 2026 anstehenden Neuerungen wird er Sie beizeiten in den zukünftigen Ausgaben informieren.
Zu guter Letzt: Aufhebung des Schriftformerfordernisses?
Das Bundeskabinett hat am 30.8.2023 die von dem Bundesminister der Justiz vorgelegten Eckpunkte für ein Bürokratieentlastungsgesetz beschlossen. Damit soll ein wesentlicher Beitrag zum Abbau von bürokratischen Hürden geleistet und ein Vorhaben aus dem Koalitionsvertrag umgesetzt werden.
Um den digitalen Rechtsverkehr zu fördern, soll danach im Allgemeinen Teil des BGB die elektronische Form oder – soweit geeignet – die Textform als Regelform ausgestaltet werden und an die Stelle der Schriftform treten. Die Schriftform soll umgekehrt nur noch als Ersatzform für die elektronische Form beibehalten werden. Dementsprechend sollen die allgemeinen Formvorschriften in den §§ 126 ff. BGB geändert werden.
Im Nachweisgesetz soll eine Regelung geschaffen werden, wonach – wie bereits bisher bei schriftlichen Arbeitsverträgen – die Verpflichtung des Arbeitgebers, einen Nachweis der wesentlichen Vertragsbedingungen zu erteilen, entfällt, wenn und soweit ein Arbeitsvertrag in einer die Schriftform ersetzenden gesetzlichen elektronischen Form geschlossen wurde. Entsprechendes soll für in elektronischer Form geschlossene Änderungsverträge bei Änderungen wesentlicher Vertragsbedingungen gelten. Ausgenommen werden sollen die Wirtschaftsbereiche und Wirtschaftszweige nach § 2a Absatz 1 Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetz.
Bürokratieentlastung ist kein neues Thema, es gab zwischen 2016 und 2019 bereits drei Bürokratieentlastungsgesetze. Die Umsetzung soll im ersten Halbjahr 2024 erfolgen. Zwischenzeitlich hat die CDU-/CSU-Fraktion zum Nachweisgesetz die Initiative ergriffen und einen Gesetzentwurf „zur Änderung des Gesetzes über den Nachweis der für ein Arbeitsverhältnis geltenden wesentlichen Bedingungen“ (BT-Drs. 20/9142) vorgelegt. Diesen hat der Bundestag am 14.12.2023 erstmals beraten. Im Anschluss an die Debatte wurde die Initiative an den federführenden Ausschuss für Arbeit und Soziales zur weiteren Beratung überwiesen.
Entfällt also künftig das Schriftformerfordernis für Kündigungen und Aufhebungsverträge? Wir sind gespannt!
Constantin Wlachojiannis, Fachanwalt für Arbeitsrecht, Köln, wlachojiannis@michelspmks.de