Wie in der letzten Serie angekündigt, beschäftigen wir uns heute mit den zahlreichen Kombinierungsmöglichkeiten im Formular. So hatten wir bereits im ersten Teil der Serie darauf hingewiesen, dass eine Kombinierungsmöglichkeit der Vermögensauskunft (Modul G2) mit dem Sachpfändungsauftrag (Modul K) nur in Ausnahmefällen Sinn macht. Zur Vermeidung von Wiederholungen verweisen wir insoweit auf die Ausführungen im ersten Teil der Serie (Infobrief Zwangsvollstreckung 1/2020).
Nach der Erfahrung des Verfassers wird auch gern seitens der Gläubiger das Modul K3 gewählt, wonach der Sachpfändungsauftrag nach der Vermögensauskunft durchgeführt werden soll. Das Ganze liest sich im Formular recht nachvollziehbar, jedoch stellt sich tatsächlich die Frage, wer letztlich entscheiden soll, ob es sich um einen sinnvollen Sachpfändungsauftrag handelt. Denkt man Modul K3 konsequent zu Ende, so bedeutet dies, dass offenbar nach den Wünschen des Gläubigers der Gerichtsvollzieher bzw. die Gerichtsvollzieherin das Vermögensverzeichnis auswerten und in eigener Zuständigkeit entscheiden soll, ob gewisse dort enthaltene körperliche Sachen einen Sachpfändungsauftrag rechtfertigen. Diese Überlegungen erscheinen doch recht theoretisch und kosten vor allem Zeit, nachdem sich selbstverständlich der Gerichtsvollzieher nicht unmittelbar nach Abnahme der Vermögensauskunft ins Auto setzt und zur Wohnung des Schuldners fährt, um den bedingt gestellten Sachpfändungsauftrag auszuführen. Insoweit bleibt dies nach Auffassung des Verfassers eine weitgehend schöne Theorie mit wenig Vorteilen in der Praxis.
Pfändung körperlicher Sachen
Erschwerend kommt hinzu, dass regelmäßig – ebenfalls aufgrund der Seminarerfahrung des Verfassers – oftmals seitens der Gläubiger sehr großzügig mit weiteren Modulen kombiniert wird. So hält sich nach wie vor hartnäckig die Kombinationsmöglichkeit der Vermögensauskunft mit dem Antrag auf Erlass eines Haftbefehls in Falle des Nichterscheinens des Schuldners zum Termin. Diese Kombinationsmöglichkeit ist wohl historisch bedingt, nachdem vor Einführung der Reform der Sachaufklärung eine Alternative überhaupt nicht zur Verfügung stand. Dies verleitet allerdings eine Vielzahl der Gläubiger nach wie vor standardmäßig dazu, den Haftbefehl zu beantragen, wobei vielfach verkannt wird, dass allein durch die Stellung des Haftbefehlsantrages weitere Gerichtkosten in Höhe von derzeit 20,00 EUR anfallen, was die Vollstreckungskosten insgesamt beachtlich erhöht. Unabhängig davon, muss auch beachtet werden, dass die Vollziehung des Haftbefehls regelmäßig kostenintensiv sein kann, nämlich dann, wenn wiederrum der Schuldner mehrfach nicht angetroffen wird und schlimmstenfalls Schlosserkosten für die Wohnungsöffnung verlangt werden. Einen etwaigen Haftkostenzuschuss des Gläubigers für die tatsächliche Inhaftierung des Schuldners möchten wir an dieser Stelle nicht weiter kommentieren, da üblicherweise der Schuldner den Haftbefehl durch Abgabe der Vermögenauskunft abwendet.
Erlass des Haftbefehls nach § 802g ZPO
Im Ergebnis zeigt sich jedoch, dass das gern genommene Verfahren – Antrag auf Erlass eines Haftbefehls und späterer Verhaftungsauftrag – einerseits sehr kostenintensiv und andererseits auch extrem zeitaufwendig ist. Das beste Ergebnis, was der Gläubiger dabei erzielen kann ist, dass sich der Schuldner nunmehr bereiterklärt, die Vermögensauskunft abzugeben. Der Verfasser hat kürzlich im Rahmen eines Online-Seminars eine Umfrage an rund 90 Teilnehmer gestellt mit dem Thema „Wer glaubt, dass die Angaben des Schuldners im Vermögensverzeichnis der Richtigkeit entsprechen?“ Das Ergebnis war mehr als eindeutig. 100 % der Befragten antworteten, dass sie nicht von der Richtigkeit des Vermögensverzeichnisses des Schuldners ausgehen. Umso befremdlicher erscheint es doch, dass eine Vielzahl der Gläubiger immer noch im ersten Schritt durch die Stellung des Haftbefehlsantrages exakt dieses Verzeichnis, an dessen Glaubwürdigkeit sie erhebliche Zweifel haben, in Händen halten wollen und dies als Grundlage ihrer Vollstreckung dient. Diese Vorgehensweise ist unter Berücksichtigung des Aufwandes, der Kosten und des Umstandes, dass die wenigsten Gläubiger an die Richtigkeit des Vermögensverzeichnisses glauben, für den Verfasser nicht nachvollziehbar.
Hinzukommt, dass wiederrum eine Vielzahl von Gläubigern, vor allem im Bereich des Massengeschäfts und der Klein- und Kleinstforderungen regelmäßig nicht über die gängigsten Vollstreckungsmaßnahmen, nämlich die Kontenpfändung und eventuell die Lohnpfändung, hinausgehen. Insoweit ist es für einen solchen Gläubiger wohl nicht sonderlich relevant, ob der Schuldner eine Mietkaution hinterlegt hat, Steuererstattungsansprüche hat, Patente besitzt oder Grundvermögen unterhält, wenn der Gläubiger entweder aufgrund der Vereinbarung mit den Mandanten oder aber aufgrund wirtschaftlicher Erwägungen sowieso derartige Ansprüche nicht vollstreckt.
Demgegenüber hätte exakt diese Gläubigergruppe die Möglichkeit, neutrale/unabhängige Drittauskünfte über Behörden, nämlich über die Deutsche Rentenversicherung und das Bundeszentralamt für Steuern zu erhalten, also Auskünfte, die aufgrund ihrer Neutralität wohl eher der Richtigkeit entsprechen als das vom Schuldner abgegebene Vermögensverzeichnis.
Drittauskünfte
Exakt mit diesen Behördenauskünften erhält der Gläubiger wieder das, was er regelmäßig pfändet, nämlich Bankverbindungen und Angaben zum Arbeitgeber zwecks Lohnpfändungen. Daher ergibt sich nach Auffassung des Verfassers seit der Reform der Sachaufklärung im Jahr 2013 sehr wohl eine neue Vollstreckungsstrategie, die echte Alternativen zum altbewährten Haftbefehl bringen. Vor diesem Hintergrund ist auch nicht ansatzweise der Einwand berechtigt, dass die Drittauskünfte zu teuer wären. Wie bereits ausgeführt, erhält der Gläubiger den Haftbefehl längst nicht mehr unentgeltlich, abgesehen von den Kosten der tatsächlichen Vollstreckung des Haftbefehls. Damit macht es durchaus Sinn, das Modul G1 mit dem Modul M zu kombinieren. Es kann auch aus Kostengründen durchaus überlegt werden, ob im Einzelfall wirklich sämtliche Drittauskünfte eingeholt werden sollen. Hat nämlich der Gläubiger die Kenntnis, dass sein Schuldner selbstständig tätig ist oder es sich um eine juristische Person handelt, so macht die Einholung der Auskunft bei der Deutschen Rentenversicherung wenig Sinn. Gleiches gilt für den Fall, wonach der Gläubiger aufgrund der Forderungshöhe nicht ansatzweise bereit wäre, ein Fahrzeug zu pfänden und zu verwerten. Besteht diese Grundeinstellung, macht es wiederum wenig Sinn, eine Auskunft beim Kraftfahrtbundesamt zeit- und kostenintensiv einzuholen, wenn man sowieso nicht bereit wäre, im Falle des positiven Eintrages das entsprechende Fahrzeug zu pfänden. Durch die überlegte Auswahl der einzuholenden Drittauskünfte können also Vollstreckungskosten erheblich gesenkt werden. Der große Gewinn durch die Reform der Sachaufklärung ist nach Meinung des Verfassers tatsächlich die Auskunft des Bundeszentralamtes für Steuern, welche konkurrenzlos gut ist.
Ein Beispiel:
Vor der Reform der Sachaufklärung musste ein Gläubiger anhand des abgegebenen Vermögensverzeichnisses dem Schuldner schlichtweg glauben, wenn er an Eides statt versicherte, er unterhalte keine Lebensversicherung, keine weiteren Bankverbindungen, keinen Bausparvertrag. Durch die Auskunft des Bundeszentralamtes für Steuern erhält der Gläubiger exakt diese Information und zwar losgelöst von der Bereitschaft des Schuldners diese Informationen dem Gläubiger preiszugeben.
Mehr ist über die Effektivität der Drittauskünfte schon nicht mehr zu sagen, da es selbsterklärend sein sollte. Daher ist für den Verfasser in der täglichen Vollstreckungspraxis die Drittauskunft das Mittel erster Wahl und der Haftbefehl lediglich sekundär.
In der Praxis entdeckt man immer wieder auch die Kombination, dass Gläubiger sowohl einen Antrag auf Erlass eines Haftbefehls stellen, diesen am besten noch verbinden mit einem Verhaftungsauftrag, also Weiterleitung des Haftbefehls an den zuständigen Gerichtsvollzieher, aber gleichzeitig Drittauskünfte beantragen. Auch diese Kombinationsmöglichkeit der Gläubiger ist für den Verfasser schwer nachzuvollziehen. Es dürfte Einigkeit dahingehend bestehen, dass mit hoher Wahrscheinlichkeit dem Gläubiger zuerst die Drittauskünfte übermittelt werden. Dies bedeutet, dass bestenfalls der Gläubiger nunmehr die Kenntnis von Bankverbindungen, Lebensversicherungen etc. hat und diese wohl gerne pfänden würde. Die Pfändung scheitert allerdings daran, dass dem Gläubiger die Vollstreckungsunterlagen nicht vorliegen, da sich diese beim Vollstreckungsgericht zwecks Erlass eines Haftbefehls befinden und nach Erlass des Haftbefehls auch wieder den Weg zum Gläubiger nicht zurückfinden, da schließlich der Gläubiger beantragt hat, den Haftbefehl nebst Vollstreckungsunterlagen direkt an den Gerichtsvollzieher zwecks Verhaftungsauftrag weiterzuleiten.
Diese Vorgehensweise ist widersinnig und entspricht überdies auch nicht der Intension des Gesetzgebers, wonach durch die Abschaffung der besonderen Vollstreckungsvoraussetzungen im Rahmen der Vermögensauskunft dem Gläubiger schnellstmöglich Gelegenheit gegeben werden soll, im Wege der Forderungspfändung seine Ansprüche zu realisieren. Hinzu kommt, dass sich der Gläubigervertreter auch einer gewissen Haftung aussetzt, weil schließlich die Regelung des § 802l Abs. 3, 5 ZPO vorsieht, dass die gleichen Informationen, also die Bankverbindungen und Lebensversicherungen des Schuldners dem Schuldner ebenfalls binnen einer Frist von 4 Wochen bekanntgegeben werden. Insoweit braucht sich also ein Gläubiger nicht zu wundern, wenn er eine negative Drittschuldnererklärung erhält und der Schuldner aufgrund der Mitteilung nach § 802l Abs. 3, 5 ZPO seine Konten leergeräumt oder aufgelöst hat. Dem Gläubiger kann nur empfohlen werden, nach Erhalt der Drittauskünfte schnellstmöglich die entsprechenden Konten zu pfänden, um exakt diese Reaktion des Schuldners nach Möglichkeit zu verhindern. Diese schnelle Reaktionsmöglichkeit nimmt sich der Gläubiger jedoch selbst, wenn er mehr oder weniger sinnfrei parallel noch Haftbefehlsantrag oder Verhaftungsauftrag stellt. Auch die Ausbringung eines vorläufigen Zahlungsverbotes in solchen Fällen ist nicht ohne Risiko, da einerseits das vorläufige Zahlungsverbot nur die Arrestwirkung von einem Monat hat und umgekehrt die mehrfache Wiederholung von vorläufigen Zahlungsverboten den notwendigen Kosten der Zwangsvollstreckung nach § 788 ZPO widerspricht. Es besteht also durchaus die Gefahr, dass der Gläubiger auf den Zustellkosten für die weiteren vorläufigen Zahlungsverbote sitzen bleibt.
Dabei möchte der Verfasser keineswegs unerwähnt lassen, dass es selbstverständlich in der Praxis Fälle gibt, in denen ein Gläubiger auf den Erlass des Haftbefehls bzw. Abgabe der Vermögensauskunft durch den Schuldner bestehen soll/muss. Wichtig in diesem Zusammenhang ist nach Meinung des Verfassers nur, dass sich der Gläubiger für einen Weg zunächst entscheidet und diesen Weg konsequent zu Ende geht. Das Formular verleitet dazu, möglichst viele Module anzukreuzen und vermittelt das Gefühl, dass damit alle Maßnahmen der Gerichtsvollziehervollstreckung ausgeschöpft wurden. Das Gegenteil ist der Fall. Der Gläubiger täte gut daran, dass Formular „Vollstreckungsauftrag an den Gerichtsvollzieher“ öfter zu verwenden, allerdings mit gezielten und konkreten Aufträgen. Dies bedeutet, dass sich zuvor der Gläubiger eine entsprechende Vollstreckungsstrategie zurechtgelegt hat.
Ähnlich gestaltet sich die Kombinationsmöglichkeit beim Ermittlungsauftrag gemäß Modul L.
Ermittlung des Aufenthaltsorts des Schuldners
Ist es wirklich sinnvoll, dass sämtliche Ermittlungsaufträge angekreuzt werden und ohne Entscheidungskompetenz des Gläubigers an vermeintlich zuständige Gerichtsvollzieher der neuen Anschrift des Schuldners die Aufträge weitergebeben werden? Im Ergebnis verliert der Gläubiger sogar die Kontrollmöglichkeit darüber, ob die vom Gerichtsvollzieher ermittelte bzw. sich aus dem Ermittlungsauftrag ergebende Adresse bereits veraltet ist oder dort bereits vor Jahren vollstreckt wurde. Der Gläubiger hat letztlich kaum mehr den Überblick, wo sich sein Schuldner im Moment aufhält und welcher Gerichtsvollzieher zuständig ist. Ablauforganisatorisch ist diese Kombinationsmöglichkeit sicherlich ein Gewinn, weil der Gläubiger kaum mit Mehrarbeit belastet wird und die Akte sicherlich für längere Zeit nicht mehr auf dem Tisch des Sachbearbeiters landet. Für eine zielführende Zwangsvollstreckung hat der Verfasser Bedenken. Auch dürfte Einigkeit dahingehend bestehen, dass jeder Gläubigervertreter in der Regel schnell und unkompliziert in der Lage ist, eine Einwohnermeldeamtsanfrage einzuholen. Gleiches gilt für Handelsregisterauskünfte und Gewerbeamtsanfragen. Daher sind nach Meinung des Verfassers vor allem die Auskünfte nach § 755 Abs. 2 ZPO interessant, also die Auskunft des Kraftfahrtbundesamtes, der Deutschen Rentenversicherung sowie des Ausländerzentralamtes. Allerdings muss auch hier – ähnlich wie bei den Drittauskünften nach § 802l ZPO – abgewogen werden, welche Auskünfte für den Einzelfall sinnvoll sind. Beim Kraftfahrbundesamt ist zu berücksichtigen, dass regelmäßig auch wesentlich ältere Anschriften geliefert werden, nämlich die Anschrift abhängig vom Zeitpunkt der Zulassung des jeweiligen Fahrzeuges.
Es ist insoweit nicht ausgeschlossen, dass über diese Auskunft ein Gläubiger eine Anschrift erhält, die noch wesentlich älter ist, als die Anschrift, bei der er zum jetzigen Zeitpunkt gescheitert ist. Hinsichtlich der Deutschen Rentenversicherung gilt das Gleiche wie bei § 802l ZPO, also dass es wenig Sinn macht, bei einem reinen Selbstständigen eine entsprechende Adressermittlung über die Deutsche Rentenversicherung durchzuführen. Die Auskunft des Ausländerzentralregisters ist für europäische Mitgliedsstaaten ausgeschlossen und es stellt sich sodann trotzdem fiktiv die Frage, ob ein Gläubiger in Anbetracht der Forderungshöhe, etc. bereit wäre, eine Vollstreckung beispielsweise in Kairo durchzuführen, wenn sich eine aktuelle Anschrift des Schuldners in Kairo aus dem Ausländerzentralregister ergäbe.
Abschließend darf noch eine weitere Kombinierungsmöglichkeit erwähnt werden: Der Pfändungs- und Verhaftungsauftrag. Während vor der Reform der Sachaufklärung regelmäßig der Pfändungs- und Verhaftungsauftrag ohne Gebühren zu erteilen war, weil der Gläubiger nicht darlegen konnte, dass innerhalb der kurzen Zeit zwischen dem ersten Pfändungsauftrag als Voraussetzung für die damalige eidesstattliche Versicherung und dem neuerlichen Pfändungsauftrag im Rahmen des Verhaftungsauftrages der Schuldner über neues bewegliches Vermögen verfügt, ändert sich die Vollstreckungspraxis bei isolierter Antragsstellung dahingehend, dass der Gerichtsvollzieher im Rahmen der Vermögensauskunft überhaupt keine Sachpfändung durchgeführt hat (vergleiche Modul G1). Dementsprechend fällt selbstverständlich für den nunmehr zu erteilenden Pfändungs- und Verhaftungsauftrag die 0,3 Gebühr nach Nr. 3309 VV RVG aus der zu vollstreckenden Forderung an, da es sich bei dieser Art der Antragstellung sodann um den ersten Sachpfändungsauftrag handelt. Aus strategischen Gründen kann auch noch überlegt werden, einen Durchsuchungsbeschluss zu beantragen, sodass der Gerichtsvollzieher auch im Falle der Abwesenheit des Schuldners eine wirksame Sachpfändung vornehmen kann. Der Haftbefehl rechtfertigt nämlich nur die Wohnungsöffnung zum Zwecke der Durchsuchung nach dem Schuldner, nicht hingegen zum Zwecke der Pfändung von beweglichen Vermögen. Hierfür benötigt der Gerichtsvollzieher im Falle der Abwesenheit des Schuldners den Durchsuchungsbeschluss. Nur vorsorglich weist der Verfasser auf die Erfolgsaussichten des Sachpfändungsauftrages in Teil 1 der Serie hin (Infobrief Zwangsvollstreckung 1/2020).
Selbstverständlich könnte neben der Kombination eines Pfändungsauftrages der Verhaftungsauftrag auch mit einem Wegnahmeauftrag erfolgen. Denkbar für den Wegnahmeauftrag sind beispielsweise Lohnabrechnungen, Kontoauszüge, welche zuvor mittels Pfändungs- und Überweisungsbeschluss mitgepfändet wurden. Grundlage für die Wegnahmevollstreckung bietet sodann der Pfändungs- und Überweisungsbeschluss. Diese Kombinationsmöglichkeit hätte für den Gläubiger ferner den Vorteil, dass sowieso bereits ein Wegegeld für die Durchführung des Verhaftungsauftrages anfällt und sodann die Wegnahme der Unterlagen, wie beispielsweise Lohnabrechnungen, Sparbücher und Kontoauszüge miterledigt werden könnten. Natürlich ist auch im Falle des Wegnahmeauftrages sodann zu klären, wie sich der Gerichtsvollzieher im Falle des Nichtvorfindens der Unterlagen zu verhalten hat. Regelmäßig wird der Gläubiger auf eine eidesstattliche Versicherung gem. § 836 Abs. 3 ZPO bestehen, welche einerseits vom Gläubiger beantragt und notfalls formuliert werden muss, welche sodann wiederum im Falle der Verweigerung durch Haftbefehl erzwungen werden kann. Der Wegnahmeauftrag könnte beispielsweise unter Modul O als weiterer Auftrag ausformuliert werden.
Der Verfasser ist der Hoffnung, dass mit dieser Serie kritisch dargestellt wurde, dass es gilt altbewährte und eingefahrene Vollstreckungskombinationen aufzubrechen und neu zu hinterfragen, um den größtmöglichen Vollstreckungserfolg für den individuellen Einzelfall zu ermöglichen.
In diesem Sinne wünscht der Verfasser weiterhin viel Erfolg in der Gerichtsvollziehervollstreckung!
Herausgeber:
Antonio Carpitella
Eichenweg 19
57392 Schmallenberg
antonio.carpitella@gmx.de
Harald Minisini
Kornackerstr. 18c
85293 Reichertshausen
info@vollstreckung-für-anwälte.de
www.fachseminare-minisini.de
Erscheinungsweise:
6x jährlich, nur als PDF, nicht im Print.
ZAP Verlag GmbHRochusstraße 2–4 · 53123 BonnTel.: 0228-91911-62 · Fax: 0228-91911-66service@zap-verlag.de
Ansprechpartnerin im Verlag: Anne Kraus
Hinweis:
Die Ausführungen in diesem Werk wurden mit Sorgfalt und nach bestem Wissen erstellt. Sie stellen jedoch lediglich Arbeitshilfen und Anregungen für die Lösung typischer Fallgestaltungen dar. Die Eigenverantwortung für die Formulierung von Verträgen, Verfügungen und Schriftsätzen trägt der Benutzer. Herausgeber, Autoren und Verlag übernehmen keinerlei Haftung für die Richtigkeit und Vollständigkeit der in diesem Infobrief enthaltenen Ausführungen.
Hinweise zum Urheberrecht:
Die Inhalte dieses Infobriefs wurden mit erheblichem Aufwand recherchiert und bearbeitet. Sie sind für den Abonnenten zur ausschließlichen Verwendung zu internen Zwecken bestimmt.
Dementsprechend gilt Folgendes:
- Die schriftliche Verbreitung oder Veröffentlichung (auch in elektronischer Form) der Informationen aus diesem Infobrief darf nur unter vorheriger schriftlicher Zustimmung durch die ZAP Verlag GmbH erfolgen. In einem solchen Fall ist der ZAP Verlag als Quelle zu benennen.
- Unter „Informationen“ sind alle inhaltlichen Informationen sowie bildliche oder tabellarische Darstellungen von Informationen aus diesem Infobrief zu verstehen.
- Jegliche Vervielfältigung der mit dem Infobrief überlassenen Daten, insbesondere das Kopieren auf Datenträger sowie das Bereitstellen und/oder Übertragen per Datenfernübertragung ist untersagt. Ausgenommen hiervon sind die mit der Nutzung einhergehenden, unabdingbaren flüchtigen Vervielfältigungen sowie das Herunterladen oder Ausdrucken der Daten zum ausschließlichen persönlichen Gebrauch. Vom Vervielfältigungsverbot ausgenommen ist ferner die Erstellung einer Sicherheitskopie, soweit dies für die Sicherung künftiger Benutzungen des Infobriefs zum vertraglich vorausgesetzten, ausschließlich persönlichen Gebrauch notwendig ist. Sicherungskopien dürfen nur als solche verwendet werden.
- Es ist nicht gestattet, den Infobrief im Rahmen einer gewerblichen Tätigkeit Dritten zur Verfügung zu stellen, sonst zugänglich zu machen, zu verbreiten und/oder öffentlich wiederzugeben.
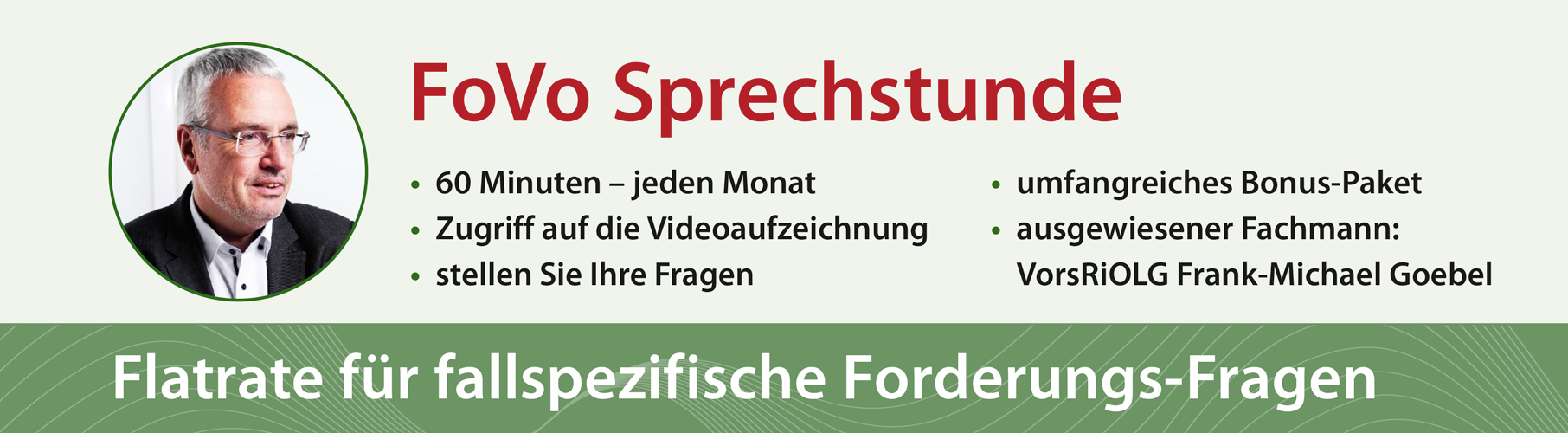

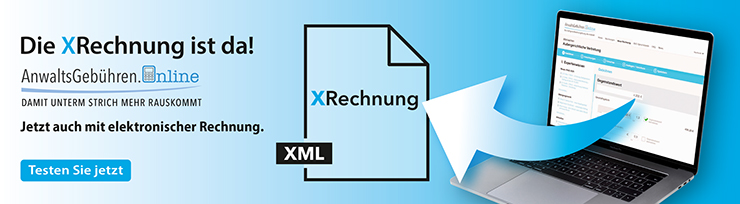

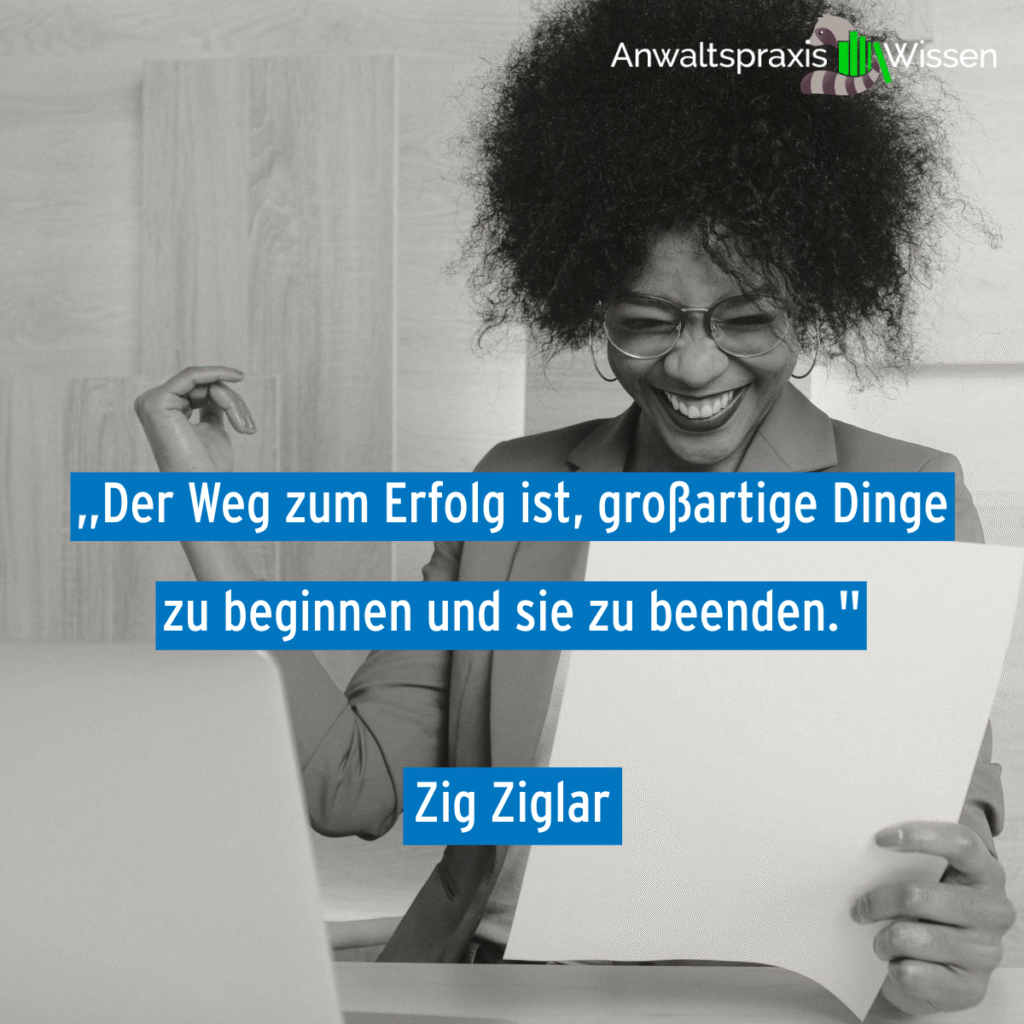

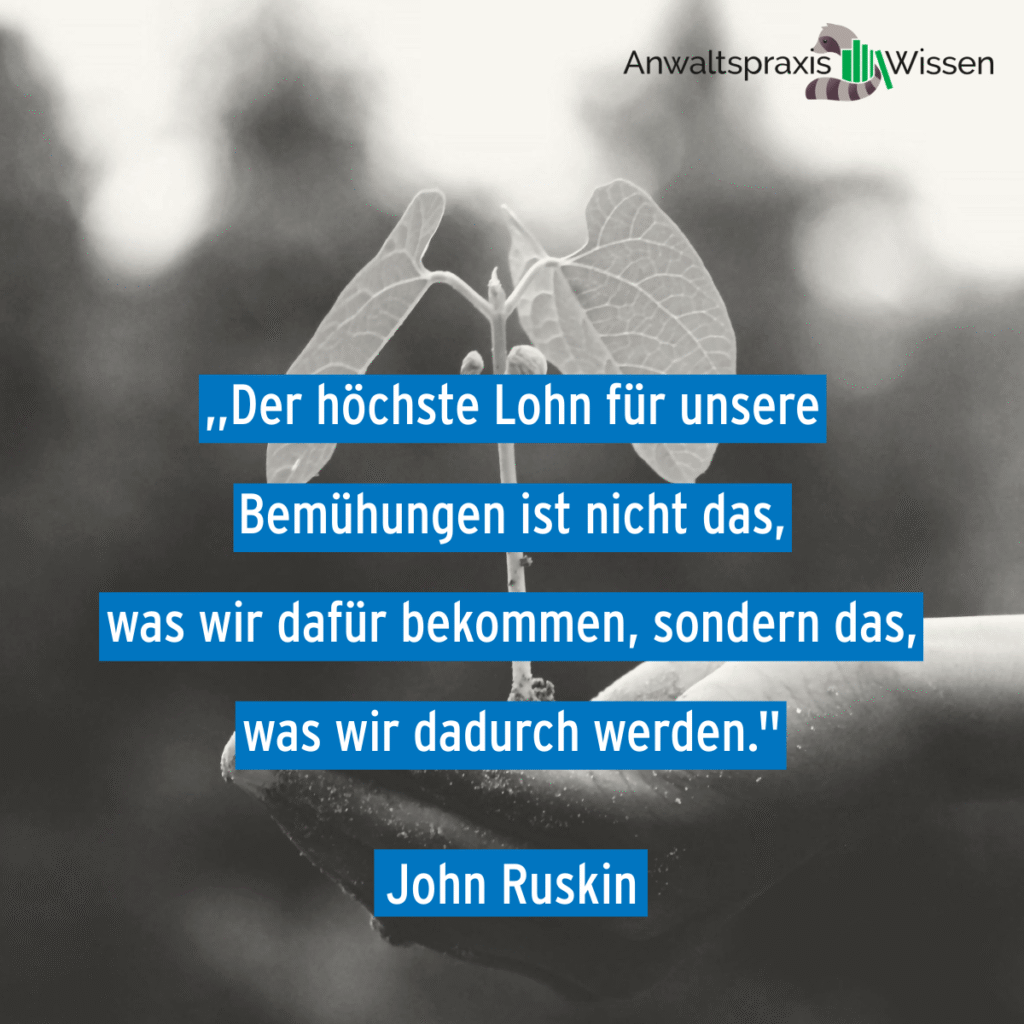

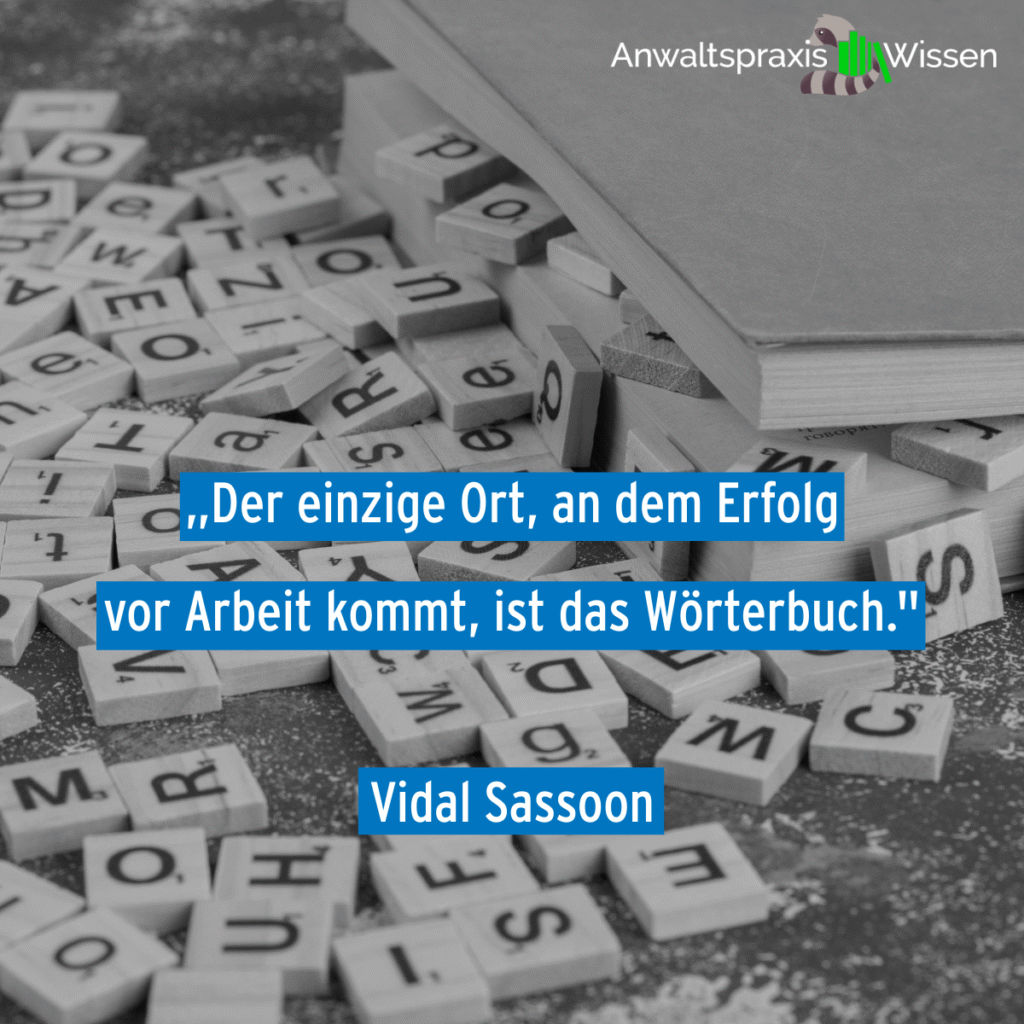
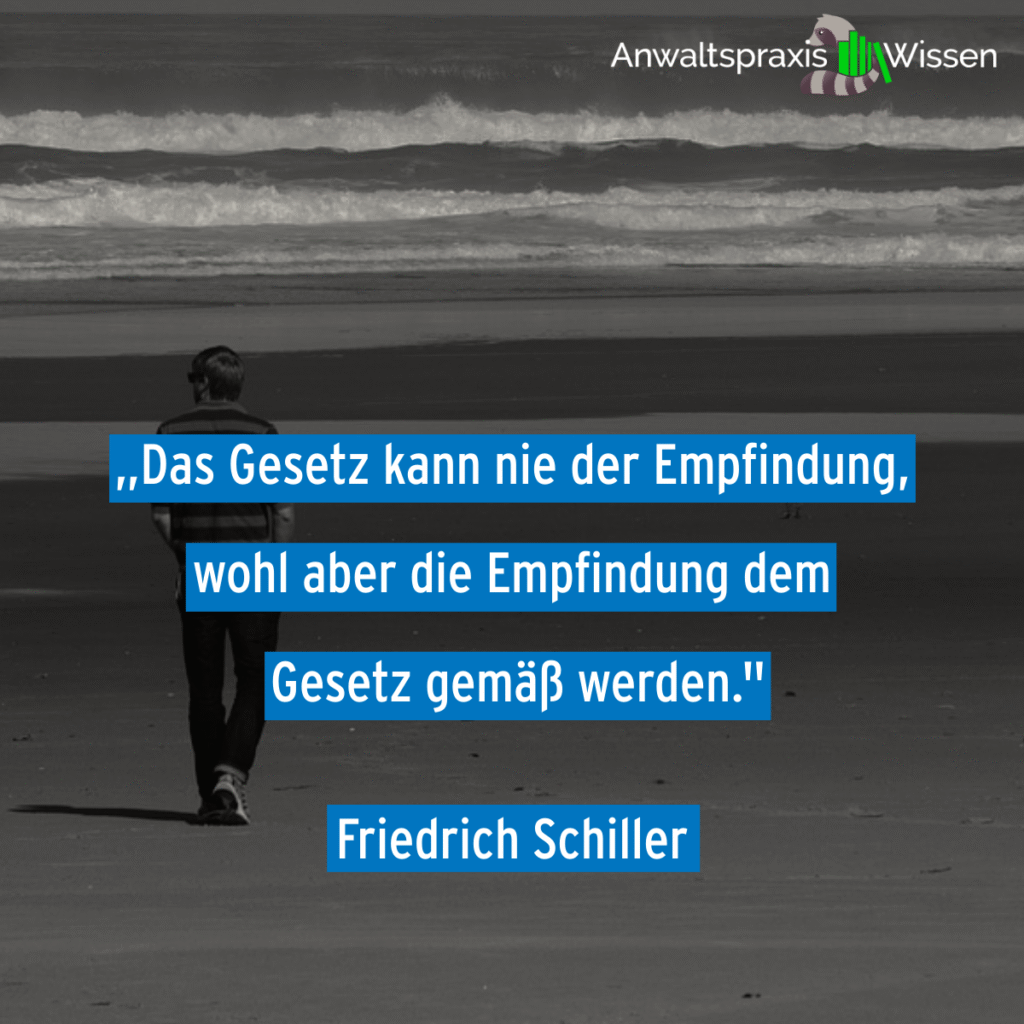
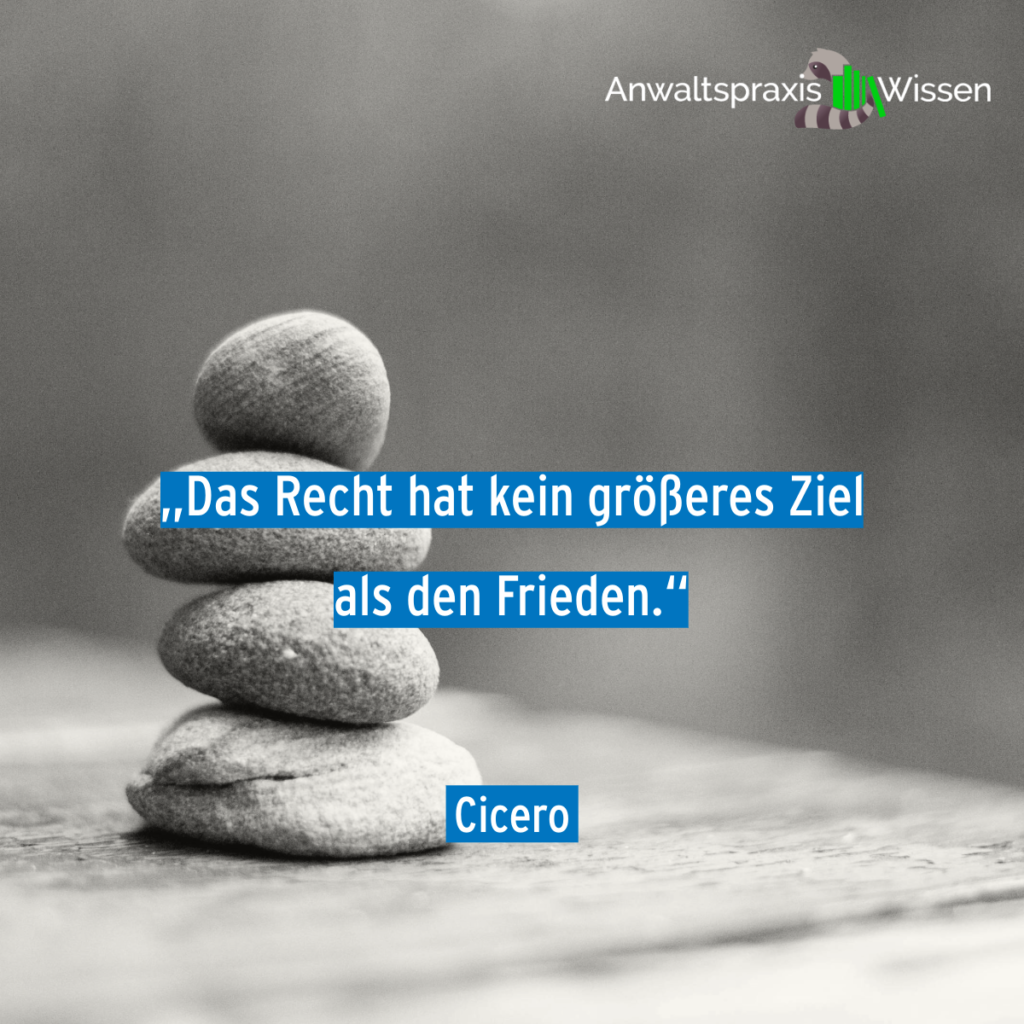

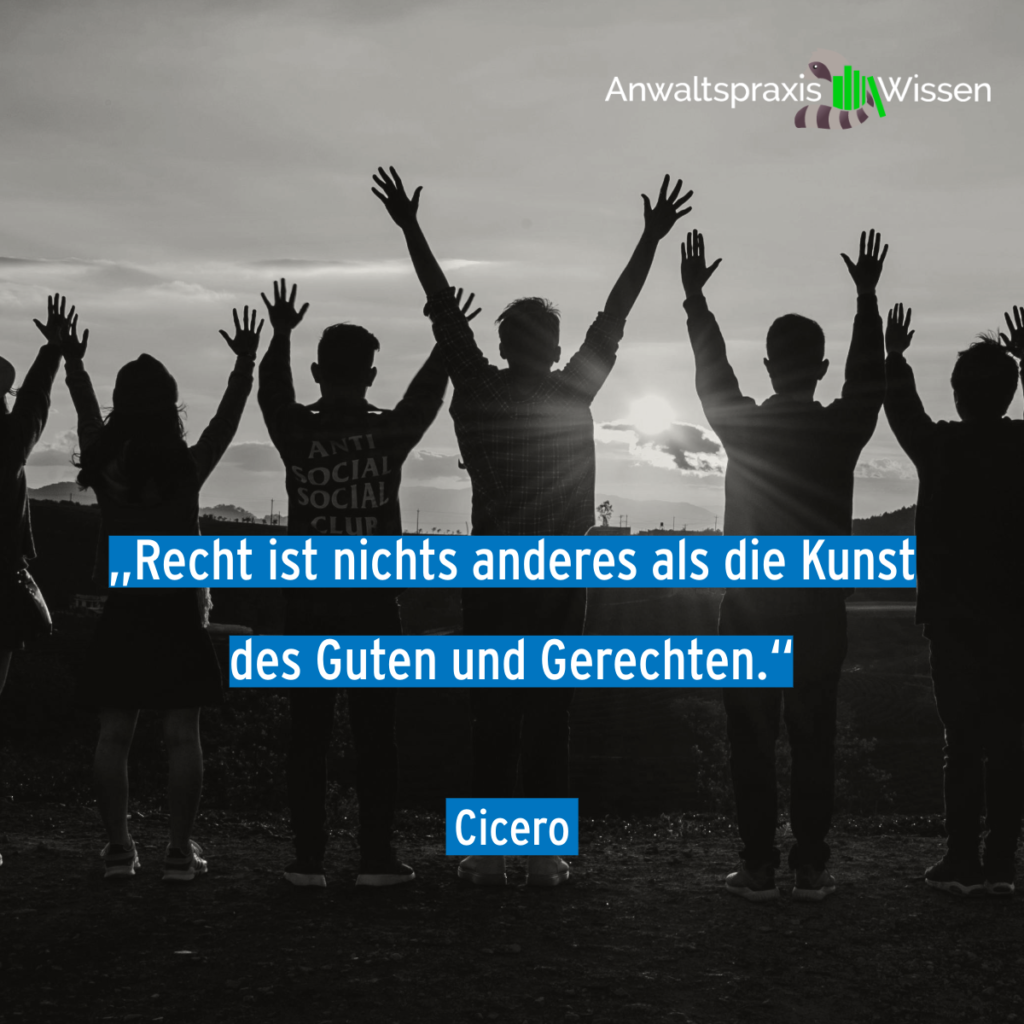
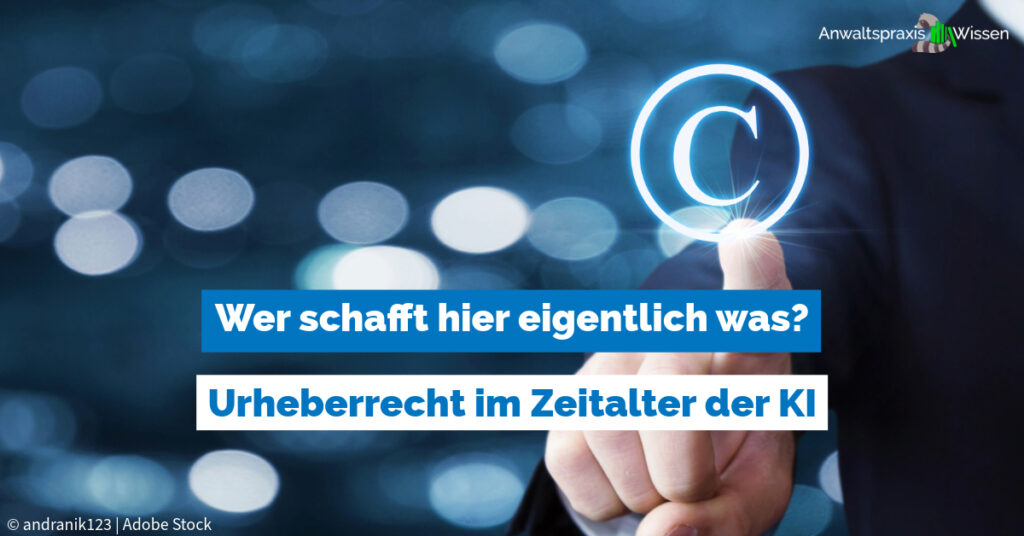

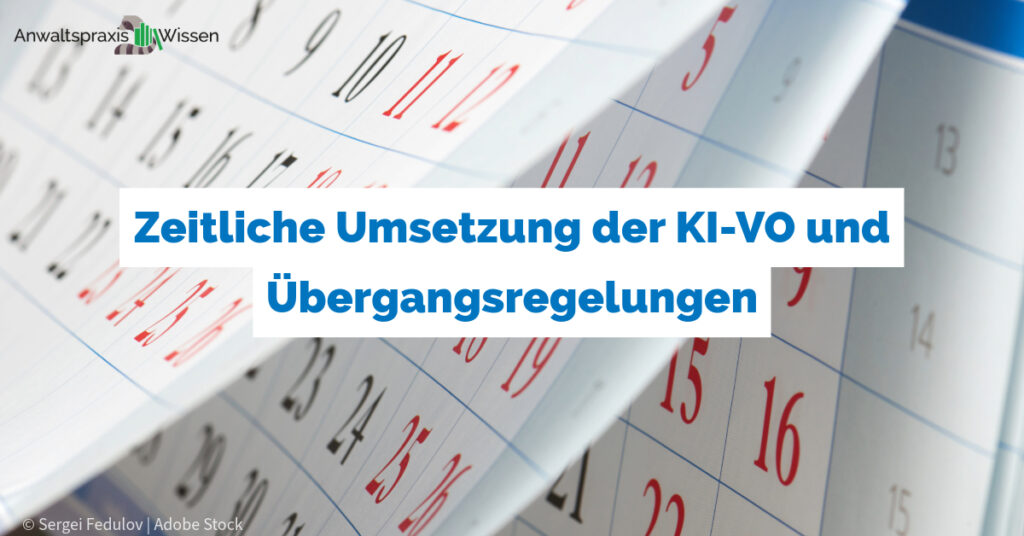




![Erbrecht im Gespräch: Kurze[s] Update: #15 Die Rechte des Erben vor dem Erbfall – mit Walter Krug](https://anwaltspraxis-magazin.de/wp-content/uploads/2025/05/Erbrecht-im-Gespraech-15-1024x536.jpeg)

