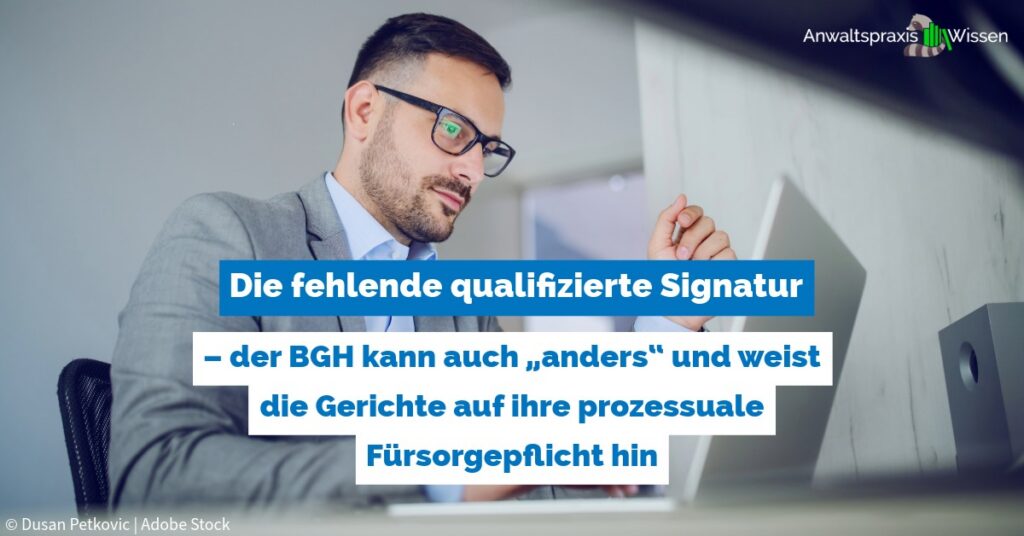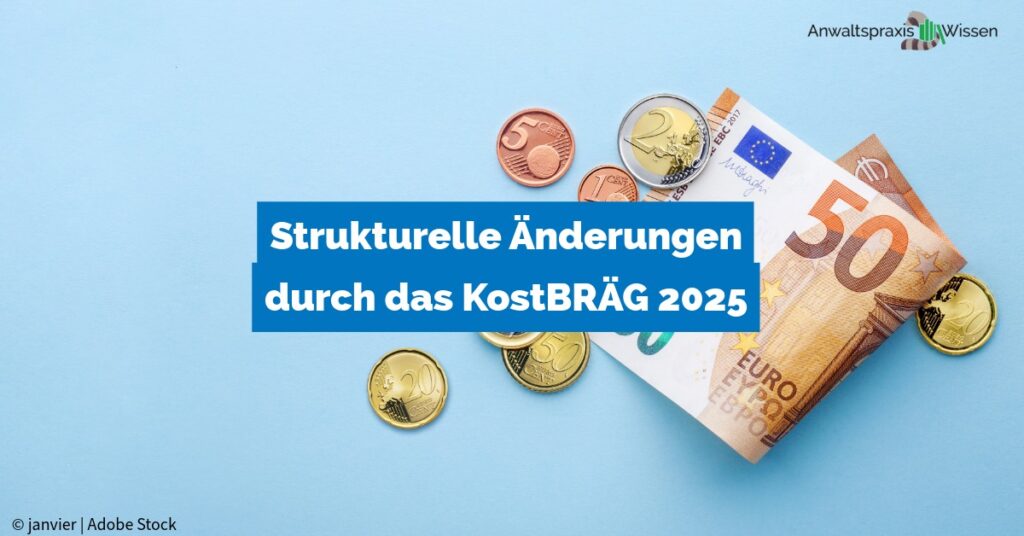Nahezu jedermann bekannt ist, dass nach einem Verkehrsunfall der Ausfall eines Kraftfahrzeuges zu einem Anspruch auf Erstattung eines sogenannten Nutzungsausfalls berechtigten kann. In der Praxis wird allerdings in der Regel nicht beachtet, dass diese Grundsätze unter bestimmten Voraussetzungen auch erfolgreich herangezogen werden können, um bei der Beschädigung eines Fahrrades einen Nutzungsausfall begründen zu können. Dies gilt erst recht, wenn beachtet wird, dass die Anschaffung von Fahrrädern als sogenannte „E-Bikes“ zu einer weitreichenden Nutzung für den täglichen Bedarf und insbesondere auch Fahrten zur Arbeit an Bedeutung gewonnen hat.
Voraussetzungen für einen Nutzungsausfall
Nach den vom BGH aufgestellten Grundsätzen kann auch bei Beschädigung eines Fahrrades ein Nutzungsausfall als Entschädigung zu beachten sein.
1. Grundsatzurteil des BGH
Der BGH hat bereits in seiner Grundsatzentscheidung aus den 1960er Jahren (BGH, Urt. v. 30.9.1963 – III ZR 137/62) betont, dass dem Geschädigten auch ein Ersatz für den vorübergehenden Verlust der Gebrauchsmöglichkeit eines Kraftwagens zustehen kann, wenn der Geschädigte sich für diese Zeit keinen Ersatzwagen beschafft. Dazu hat sich der BGH von der Überlegung leiten lassen, dass Möglichkeit, jederzeit und sofort einen Kraftwagen benutzen zu können, als wirtschaftlicher Vorteil angesehen wird. Dies unabhängig davon, ob und wie oft man von dem Wagen Gebrauch macht. Deshalb erleidet der Eigentümer nach Ansicht des BGH durch den Ausfall seines Wagens wirtschaftlich gesehen bereits in dem Augenblick einen Schaden, zu dem der Wagen beschädigt wird und infolge dessen eine gewisse Zeit nicht benutzt werden kann.
Nun ließe sich der Übertragung dieser Grundsätze auf Fahrräder entgegenhalten, dass der Geschädigte bei dem Erwerb eines Kraftfahrzeuges i.d.R. erhebliche finanzielle Aufwendungen getätigt hat, um die Nutzungsmöglichkeit des Fahrzeuges überhaupt zu erlangen. Vor dem Hintergrund der Tatsache, dass vorliegend aber auch Fahrräder zu Preisen gehandelt werden, die ohne Weiteren in einer Größenordnung von 1.000,00 EUR liegen, bei bestimmten Modellen auch ohne Weiteres zwischen 3.000,00 EUR bis 5.000,00 EUR betragen können und in vielen Fällen auch die Anschaffung von E-Bikes im Raum steht, deren Kosten zwischen 2.000,00 EUR und 10.000,00 EUR liegen, lassen sich diese Grundsätze ohne Weiteres ebenfalls bei der Anschaffung eines Fahrrades bejahen.
2. Vergleichsmaßstab: Nutzungsausfall für Motorräder
Zwischenzeitlich hat der BGH im Jahr 2018 auch eine Nutzungsausfallentschädigung bei der Beschädigung eines Motorrades für möglich gehalten, wenn bestimmte Voraussetzungen erfüllt sind (BGH, Urt. v. 23.1.2018 – VI ZR 57/17). Dabei kommt es insbesondere darauf an, dass das Motorrad nicht alleine sogenannten Freizeitzwecken dient. Diese Voraussetzung ist bei dem Einsatz eines Fahrrades naturgemäß besonders zu prüfen. Wird ein Fahrrad oder ein E-Bike nur für einzelne Bereiche der Freizeit wie den Sport genutzt, ist nach dieser Vorgabe des BGH ein Nutzungsausfall zu versagen. Den dann geht es auch nicht mehr um eine alltägliche Nutzung zur eigenen wirtschaftlichen Lebensführung im Sinne der Rechtsprechung des BGH aus dem Jahre 1963.
Genau wie bei Motorrädern scheidet daher eine Entschädigung bei einer Nutzung als reines Sport- und Freizeitrad aus (LG Frankenthal, Urt. v. 5.6.2020 – 4 O 10/19). Dies gilt insbesondere für Rennräder. So ist in der Rechtsprechung bereits anerkannt, dass der zeitweilige Verlust der Gebrauchsfähigkeit eines ausschließlich zur sportlichen Betätigung dienenden Rennrades nicht zu erstatten ist (OLG Stuttgart, Beschl. v. 9.9.2013 – 13 U 102/13). Dies gilt insbesondere für ein Rennrad, welches noch besonders für die sportliche Betätigung individuell angepasst worden ist (LG Heilbronn, Urt. v. 24.5.2013 – 5 O 30/13).
3. Bedeutung für die allgemeine Lebensführung
Dabei ist auch zu beachten, dass bei der Prüfung, ob nach der Verkehrsanschauung der vorübergehende Verlust der Nutzungsmöglichkeit eines Gegenstandes als wirtschaftlicher Schaden zu werten ist, ein strenger Maßstab anzulegen ist. So wurde in der Vergangenheit bei der Beschädigung eines Fahrrades ein Nutzungsausfall mit dem Hinweis auf diese fehlende zentrale Bedeutung für die allgemeine Lebensführung abgelehnt (vgl. Landgericht Hamburg, Urt. v. 24.4.1992 – 306 O 344/91; AG Stade, Urt. v. 27.8.2020 – 61 C 236/20).
Anders liegt der Fall allerdings, wenn beispielsweise einem Arbeitnehmer vom Arbeitgeber ein E-Bike als sogenanntes Dienstrad angeboten wird, wodurch auch ein geldwerter Vorteil für den Arbeitnehmer entsteht, der sogar gesondert steuerrechtlich zu erfassen ist – ein Modell, das in der Praxis immer mehr an Bedeutung gewinnt, wenn Arbeitnehmer auch mit dem Fahrrad im Rahmen der geförderten Verkehrswende zum Arbeitsplatz fahren. Bei einem solchen Sachverhalt spricht vieles dafür, eine ausreichende Bedeutung des Fahrrades für die allgemeine Lebensführung und damit auch Erstattung eines Nutzungsausfalls zu bejahen. Daher ist auch bei einem für tägliche Fahrten zur Schule (vgl. Amtsgericht Kiel, Urt. v. 2.4.1990 – 4 C 604/89) oder zum Arbeitsplatz (LG Lübeck, Urt. v. 8.7.2011 – 1 S 16/11; AG Frankfurt am Main, Urt. v. 16.2.1990 – 32 C 5136/89) genutzten Fahrrad eine Nutzungsausfallentschädigung zugesprochen worden.
4. Nutzungsfähigkeit beim Geschädigten
Neben dem Nutzungswillen muss auch eine Nutzungsmöglichkeit des Geschädigten bestehen (vgl. BGH, Urt. v. 23.1.2008 – VI ZR 57/17). Wurde beispielsweise der Geschädigte auch verletzt, ist wie immer zu prüfen, ob er aufgrund der Verletzung überhaupt in dem Ausfallzeitraum in der Lage gewesen wäre, nach dem Unfall mit dem Fahrrad zu fahren. Ist dies verletzungsbedingt nicht möglich gewesen, scheidet für den Ausfallzeitraum eine Nutzungsausfallentschädigung aus (vgl. KG, Urt. v. 16.7.1993 – 18 O 1276/92). Gestattet die Verletzung aber zumindest teilweise eine entsprechende Nutzung, kann dagegen auch ein Nutzungsausfall trotz der erlittenen Verletzungen zuzusprechen sein (vgl. OLG Brandenburg, Urt. v. 11.10.2007 – 12 U 24/07 zur Kfz-Nutzung).
5. Nutzungsmöglichkeit bei geeigneten Wetterverhältnissen
In seinem Urteil aus dem Jahr 2018 hat der BGH auch betont, dass eine saisonale bzw. witterungsbedingte Nutzung des Fahrzeuges wie etwa bei einem Motorrad auch zu beachten ist. Wenn in einer bestimmten Saison eine Nutzung nicht erfolgt, ist ein Anspruch auf eine Nutzungsausfallentschädigung nicht gegeben (vgl. BGH, Urt. v. 23.1.2018 – VI ZR 57/17). Hier ist also genau zu prüfen, ob der Geschädigte tatsächlich willens und in der Lage gewesen ist, das beschädigte Fahrrad im Ausfallzeitraum zu nutzen und in welcher Saison und unter welchen Wetterbedingungen er dieses auch in der Vergangenheit benutzt hat. Die Darlegungs- und Beweislast liegt dann beim Geschädigten, ist aber beispielsweise auch dem Zeugenbeweis oder einer allgemeinen Lebenserfahrung – zum Beispiel bei täglichen Fahrten zur Schule oder einem kurzen Weg zur Arbeit – zugänglich.
6. Kein Zweitfahrzeug
Ein Anspruch auf Schadensersatz wegen der vorübergehenden Entziehung der Gebrauchsmöglichkeit eines Kraftfahrzeugs besteht nicht, wenn dem Geschädigten ein weiteres Fahrzeug zur Verfügung steht, dessen ersatzweise Nutzung ihm zumutbar ist (BGH, Urt. v. 10.11.2022 – VI ZR 35/22, VRR 2/2023, 9 ff.). Verfügt der Geschädigte über ein zweites Fahrzeug, besteht also kein Anspruch auf Nutzungsausfallersatz (OLG München, Urt. v. 22.9.2017 – 10 U 304/17). Diese Grundsätze gelten mithin auch bei einem Fahrrad – verfügt der Geschädigte über ein Kfz, will aber lieber aus subjektiven Gründen mit dem Fahrrad fahren, steht ihm daher kein Nutzungsausfall zu (LG Frankenthal, Urt. v. 5.6.2020 – 4 O 10/19). Auch kann bei mehreren Fahrzeugen allein die bessere Ausstattung, das angesehenere Prestige oder das geschätzte besondere Fahrgefühl keinen Nutzungsausfall begründen (BGH a.a.O.) und diese Grundsätze müssen auch gelten, wenn z.B. dem Geschädigten mehrere Fahrräder zur Verfügung stehen, er eines aber mehr wertschätzt.
Allerdings kann der gewichtige Unterschied zwischen einem E Bike und einem normalen Fahrrad bei der erleichterten Fortbewegung aus Sicht des Verfassers anders zu beurteilen sein. Auch kann der Geschädigte nicht auf Rennrad verwiesen werden, wenn dieses z.B. mangels ausreichender Beleuchtung gar nicht für Fahrten bei Nacht verkehrssicher ist. Zudem kann z.B. auch das Fehlen von Schutzblechen an möglichen Ersatzrädern zur Unzumutbarkeit ihrer ersatzweisen Nutzung für den Weg zur Arbeit, weil bei entsprechender Witterung mit erheblichen Spritzern auf der Kleidung zu rechnen ist (LG Lübeck, Urt. v. 8.7.2011 – 1 S 16/11).
Anspruchshöhe
Ist ein Anspruch auf Nutzungsausfall grundsätzlich gegeben, ist genau zu prüfen, in welcher Höhe eine Entschädigung zu erfolgen hat.
1. Bedeutung von Tabellenwerken
Bei Pkws hat es sich beispielsweise etabliert, auf ein Tabellenwerk von Sanden/Danner/Küppersbusch zurückzugreifen, dessen Werte im Regelfall aus den üblichen Mietwagenkosten abgeleitet werden und dann eine Korrektur wegen der Gewinnspanne des Vermieters erfolgt. Bei Fahrrädern gibt es aber (bisher) eine solche Tabelle nicht.
2. Schätzung anhand von Mietpreisen
Auch wenn es bei Fahrrädern dieses Tabellenwerk nicht gibt, dürfte diese bei Fahrzeugen etablierte Vorgehensweise ebenfalls anbieten. Dabei ist auch zu beachten, dass es zwischenzeitlich auch nachvollziehbare Tagespreise für die Anmietung eines Fahrrades oder auch bei einem E Bike gibt. Demzufolge ist es auch in der Rechtsprechung anerkannt, die Tagespauschale für die Kosten eines Mietfahrrades als Hilfe zur Schätzung zugrunde zu legen (vgl. LG Lübeck, Urt. v. 8.7.2011 – 1 S 16/11; AG Frankfurt am Main, Urt. v. 16.2.1990 – 32 C 5136/89). Dabei kann es sich anbieten, in Anlehnung an die beispielsweise für die Einholung von Restwertangeboten entwickelten Grundsätze zumindest drei Vergleichsangebote zur Bestimmung eines Durchschnittswerts heranzuziehen. Von dem auf diesem Wege ermittelten Betrag ist sodann ein Abschlag für den Unternehmergewinn vorzunehmen, der z.B. in der Vergangenheit bei 40 % geschätzt worden ist (LG Lübeck, a.a.O.), um sodann einen Tageswert für die Entschädigung festzulegen. Bei einem längeren Ausfall kann dieser schon ab der dritten Woche noch weiter herabzusetzen sein, da längere Anmietungen entsprechend günstiger werden – im Fall des LG Lübeck waren dies 99 EUR für die erste Woche dann 13 EUR pro Tag in der zweiten Woche und ab der 3. Woche 50 % weniger.
3. Abzug bei alten Fahrrädern
Bei Kfz ist einem Fahrzeugalter von 5–10 Jahren eine Abstufung um eine Fahrzeugklasse, ab 10 Jahren sogar um zwei Klassen innerhalb der Nutzungsausfalltabelle geboten (BGH DAR 2005, 265). Eine unterlassene Herabstufung würde dagegen zu einer ungerechtfertigten Bereicherung führen, da die angegebenen Werte aus der Tabelle Sanden & Danner im Wesentlichen auf Mietwagenpreisen basieren, welche sich auf Mietzinsen für Neufahrzeuge beziehen (OLG Düsseldorf, Urt. v. 2.7.2008 – 1 W 24/08). Wenn nun auch der Tagessatz für ein Fahrrad anhand dieser Preise als Orientierungssatz berechnet wird dürfte es auch überzeugend sein, bei Fahrrädern ab einer Altersgrenze von 5 Jahren einen Abschlag von zumindest 10 % vorzunehmen.
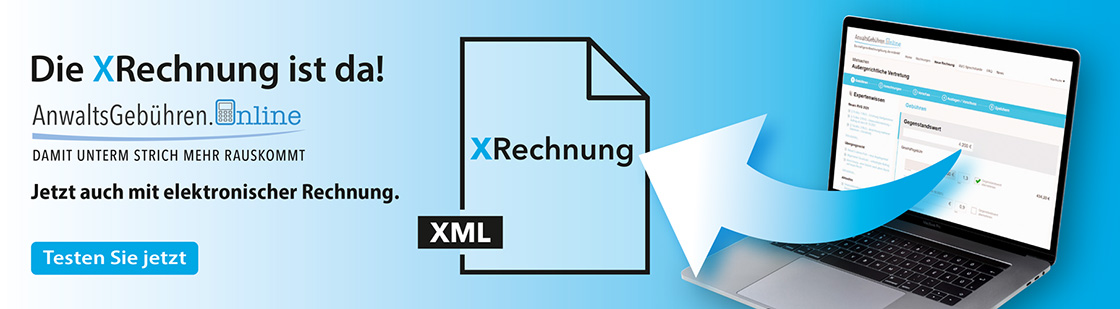

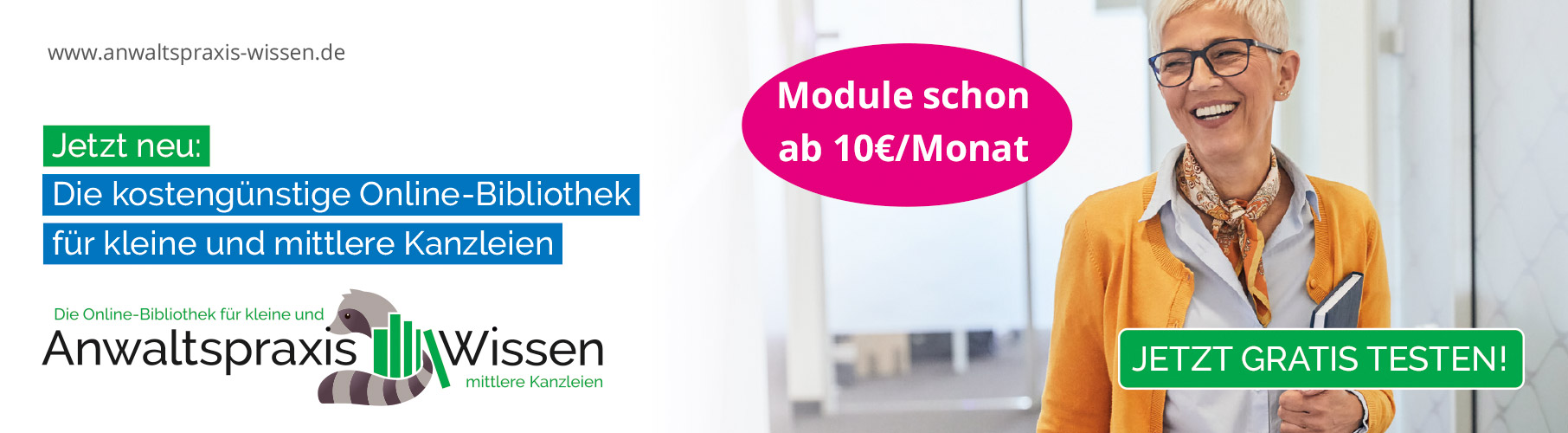

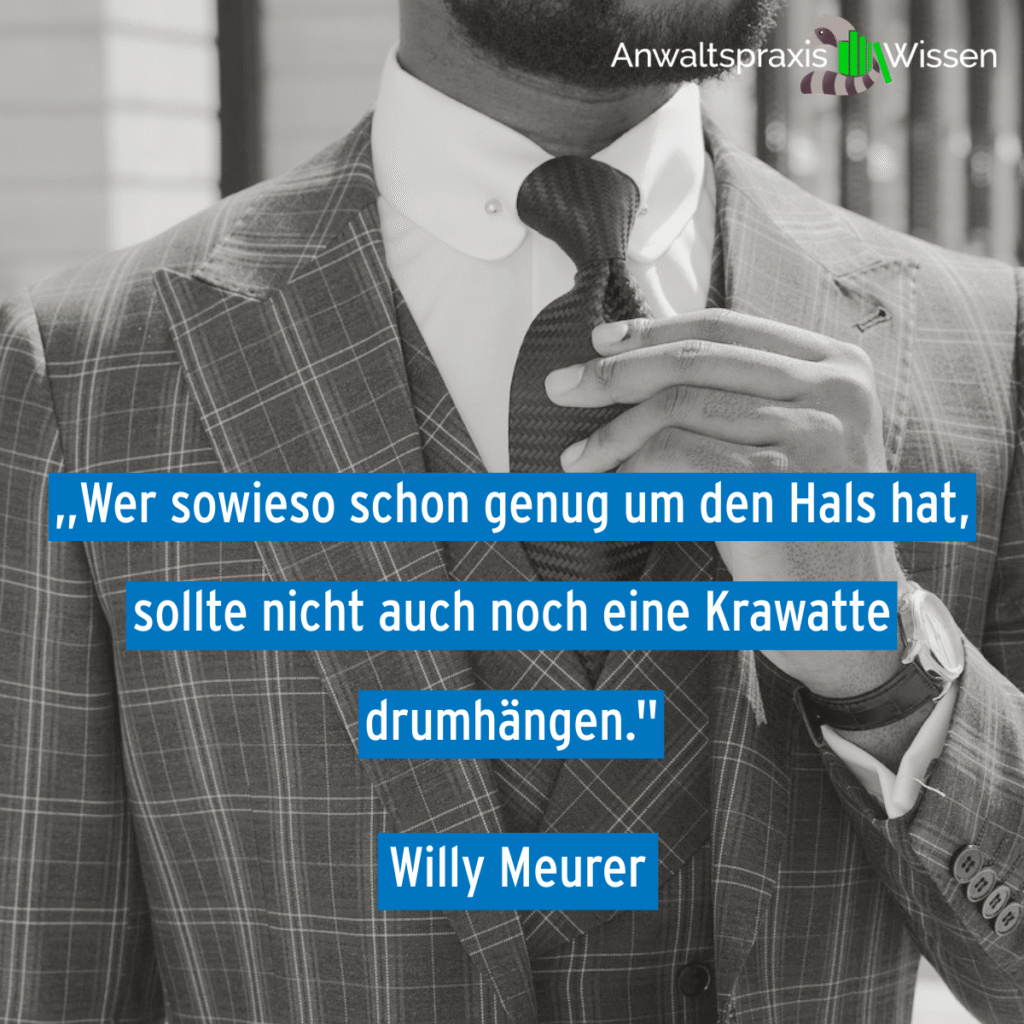



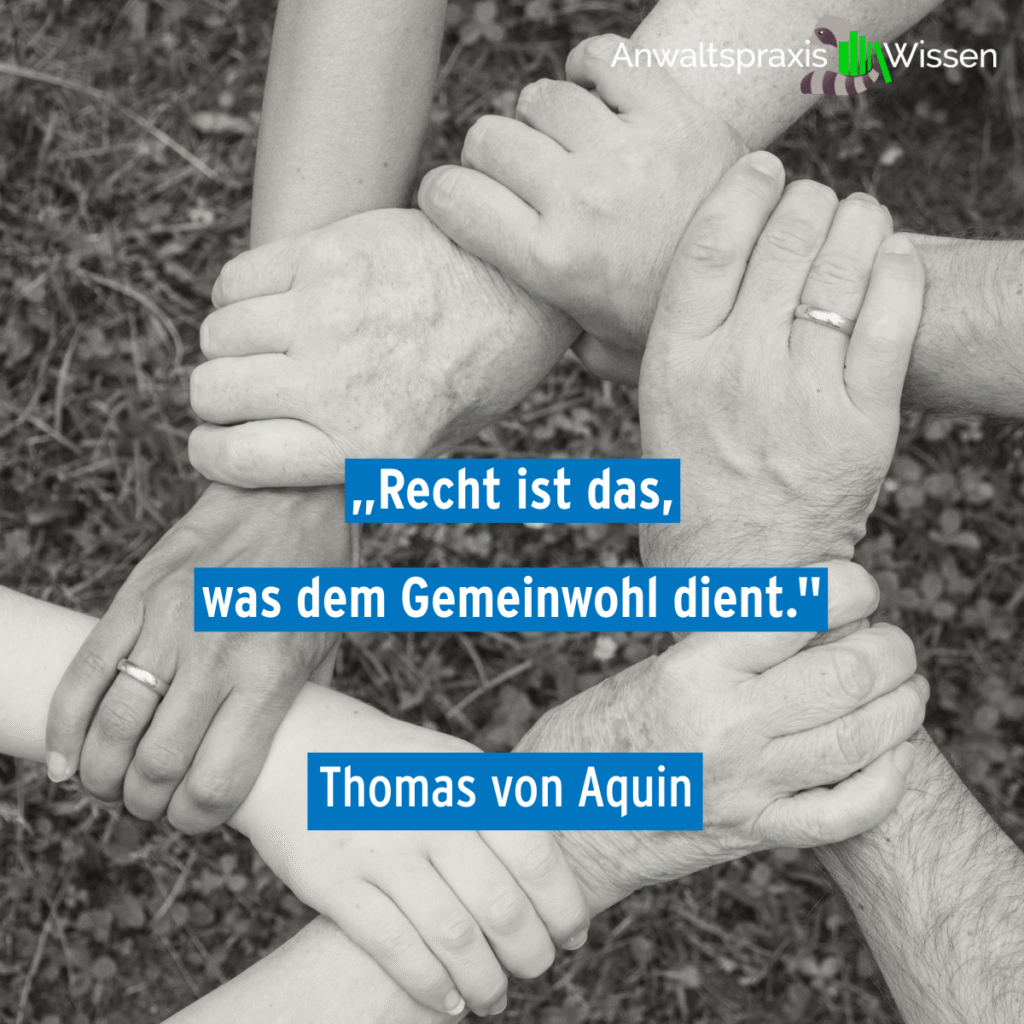
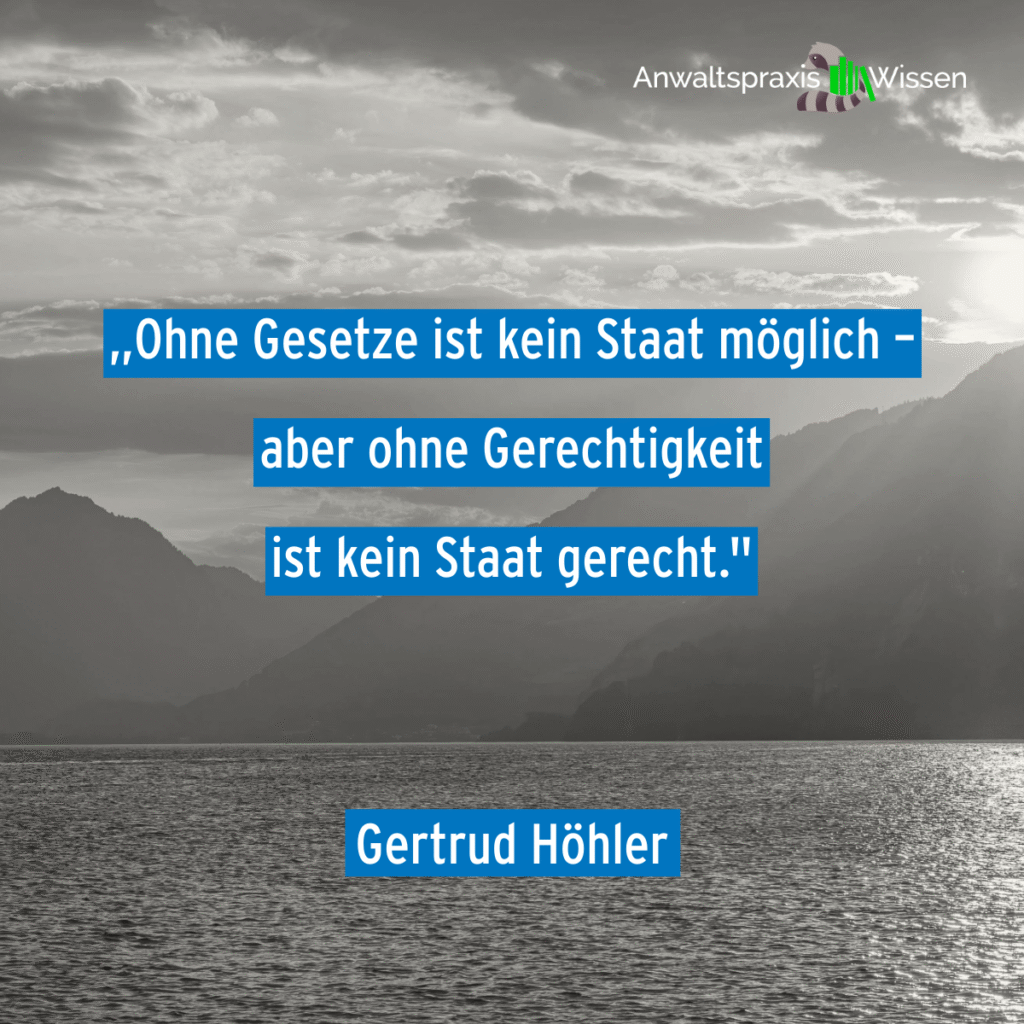
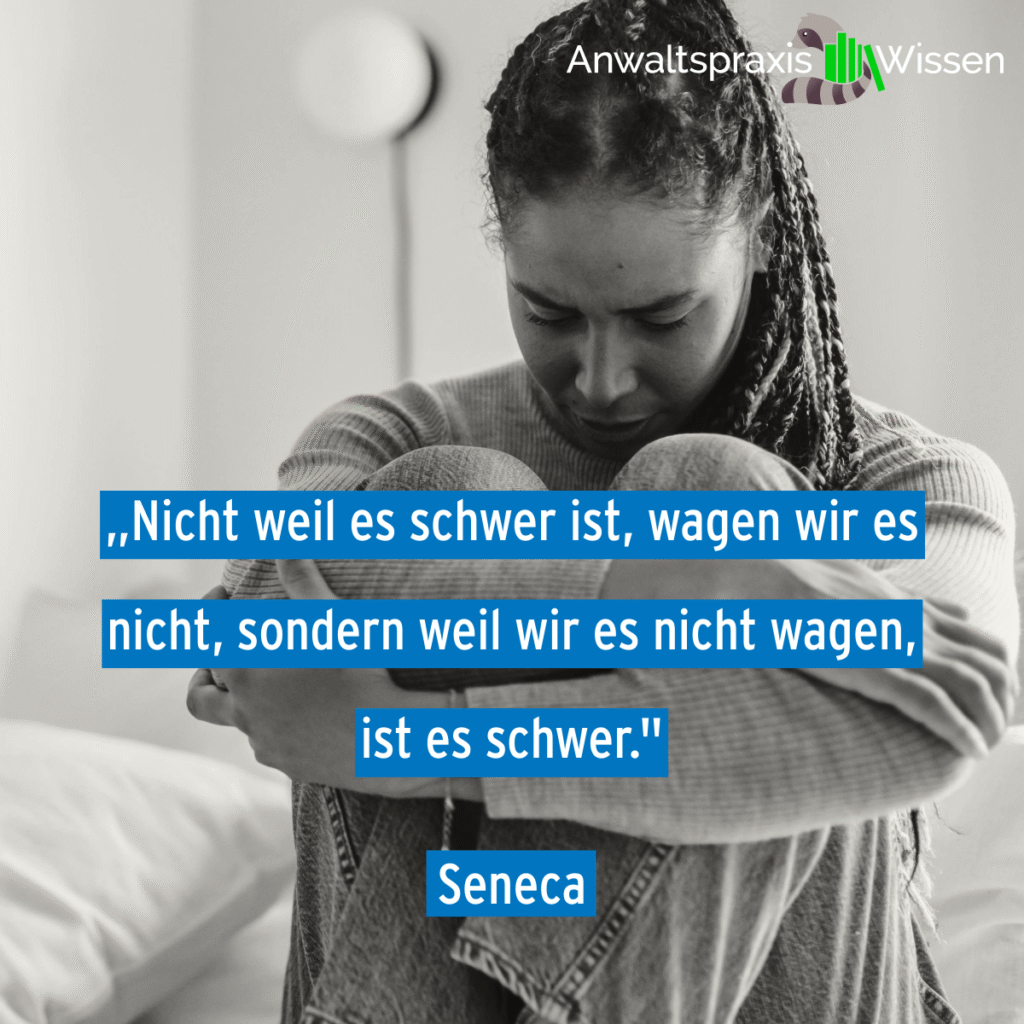
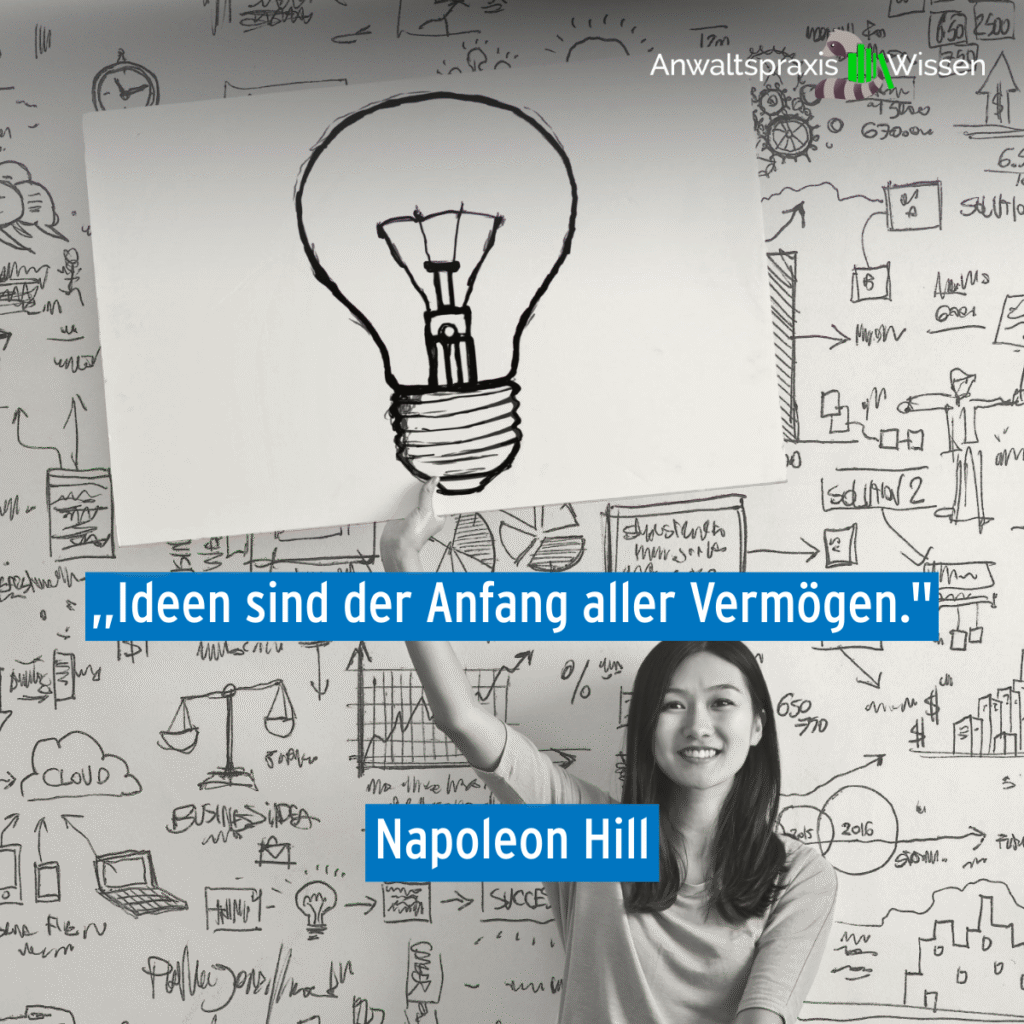
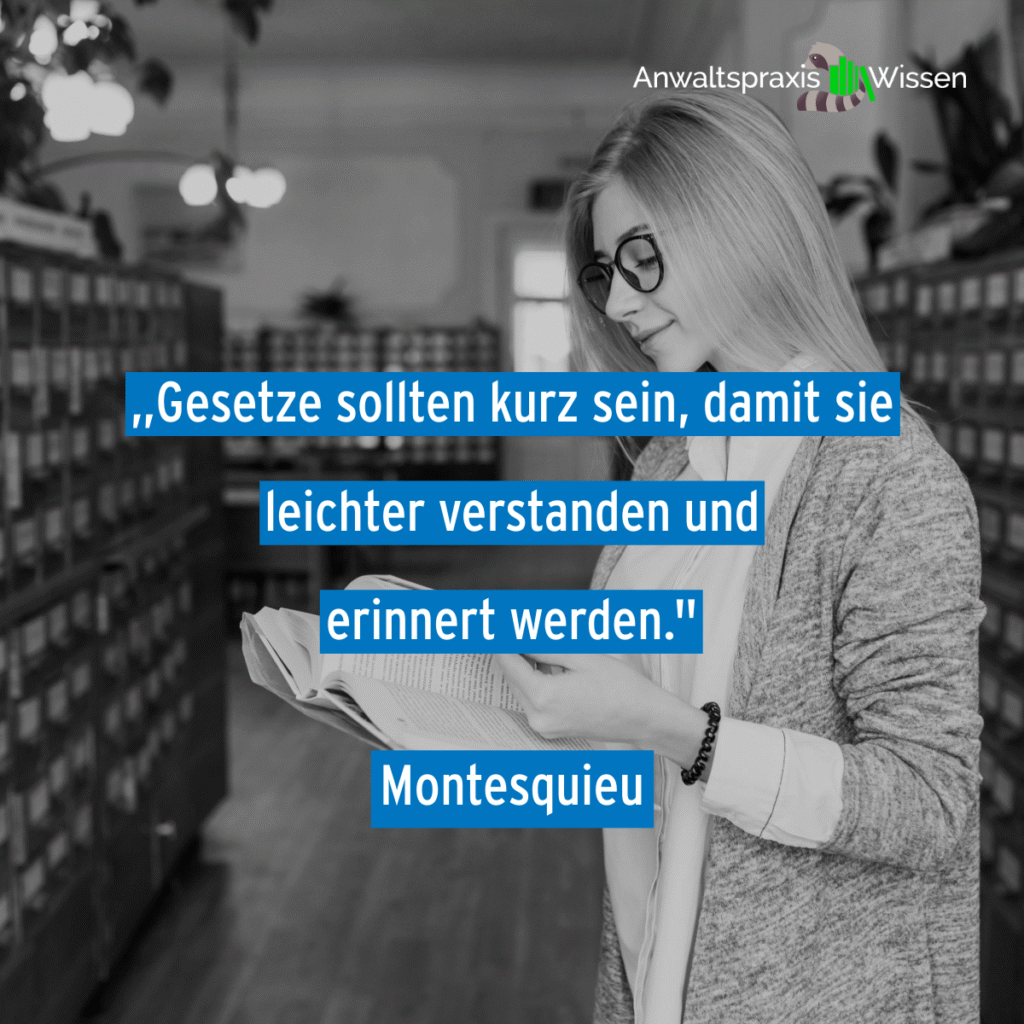

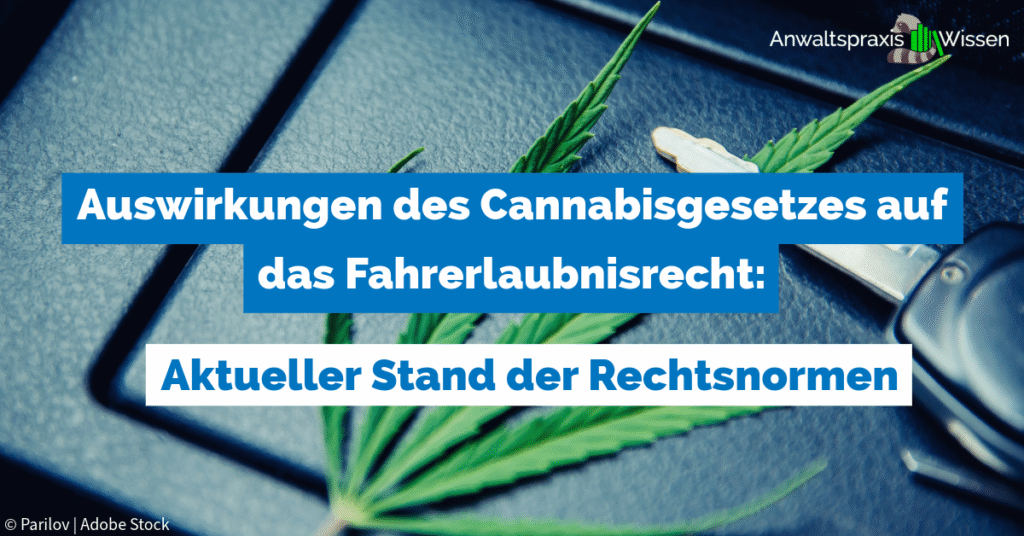

![Erbrecht im Gespräch: Kurze[s] Update: #21 Ehegatten: Testament oder Erbvertrag? – mit Dr. Markus Sikora](https://anwaltspraxis-magazin.de/wp-content/uploads/2025/11/Erbrecht-im-Gespraech-21-1024x536.jpeg)