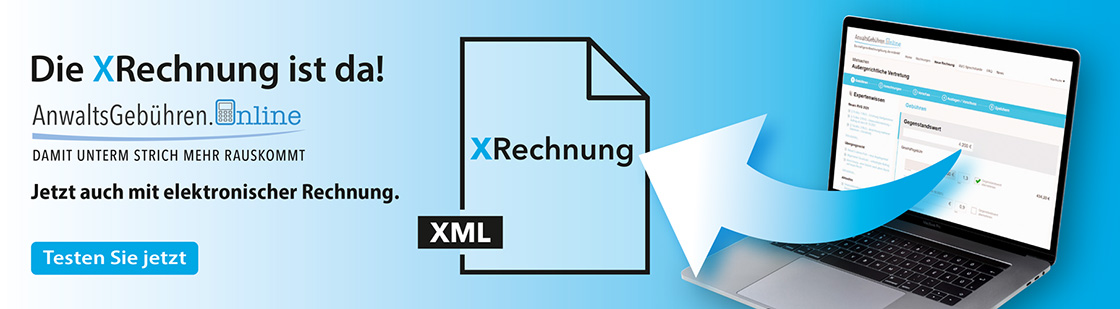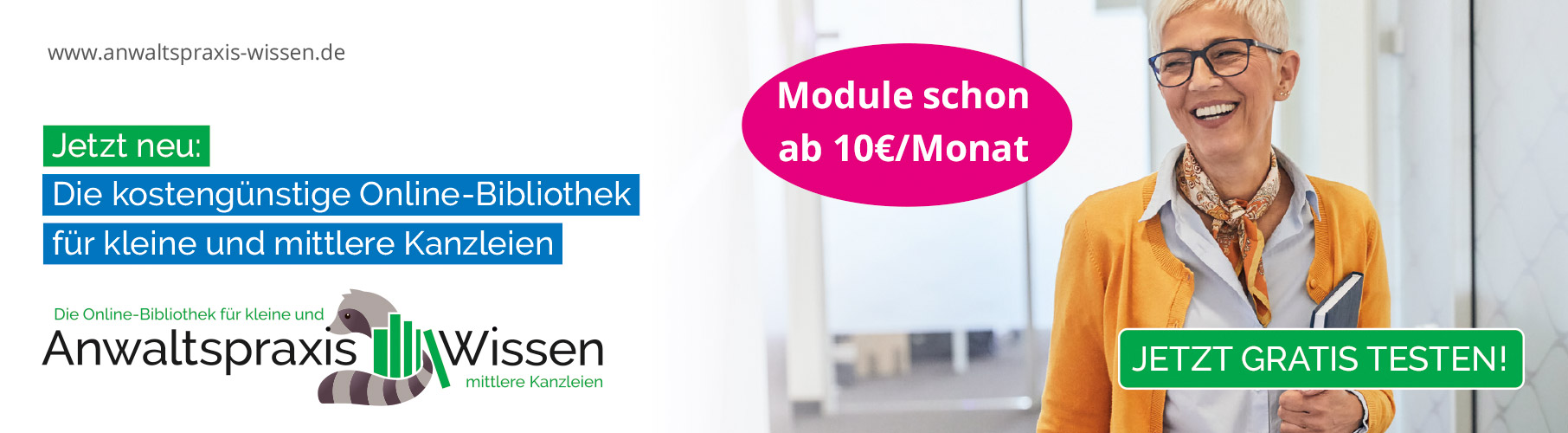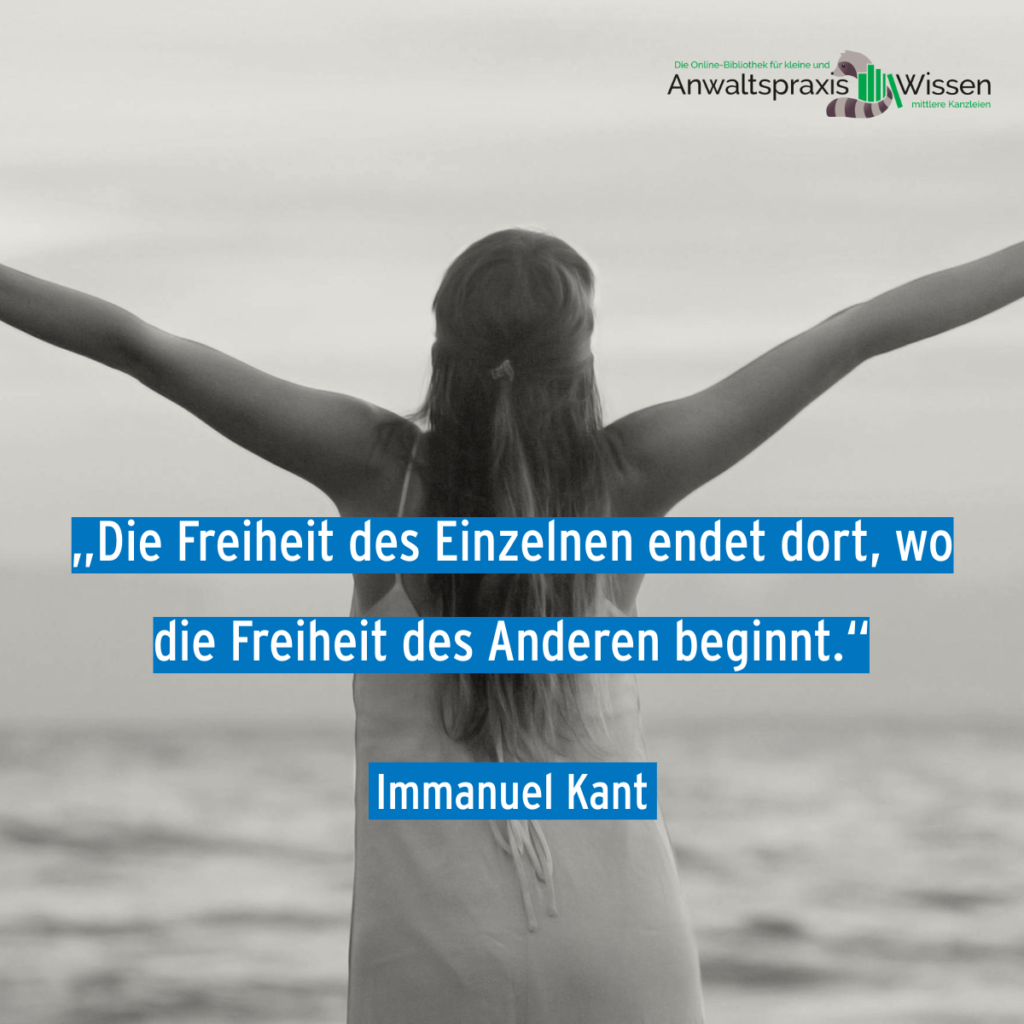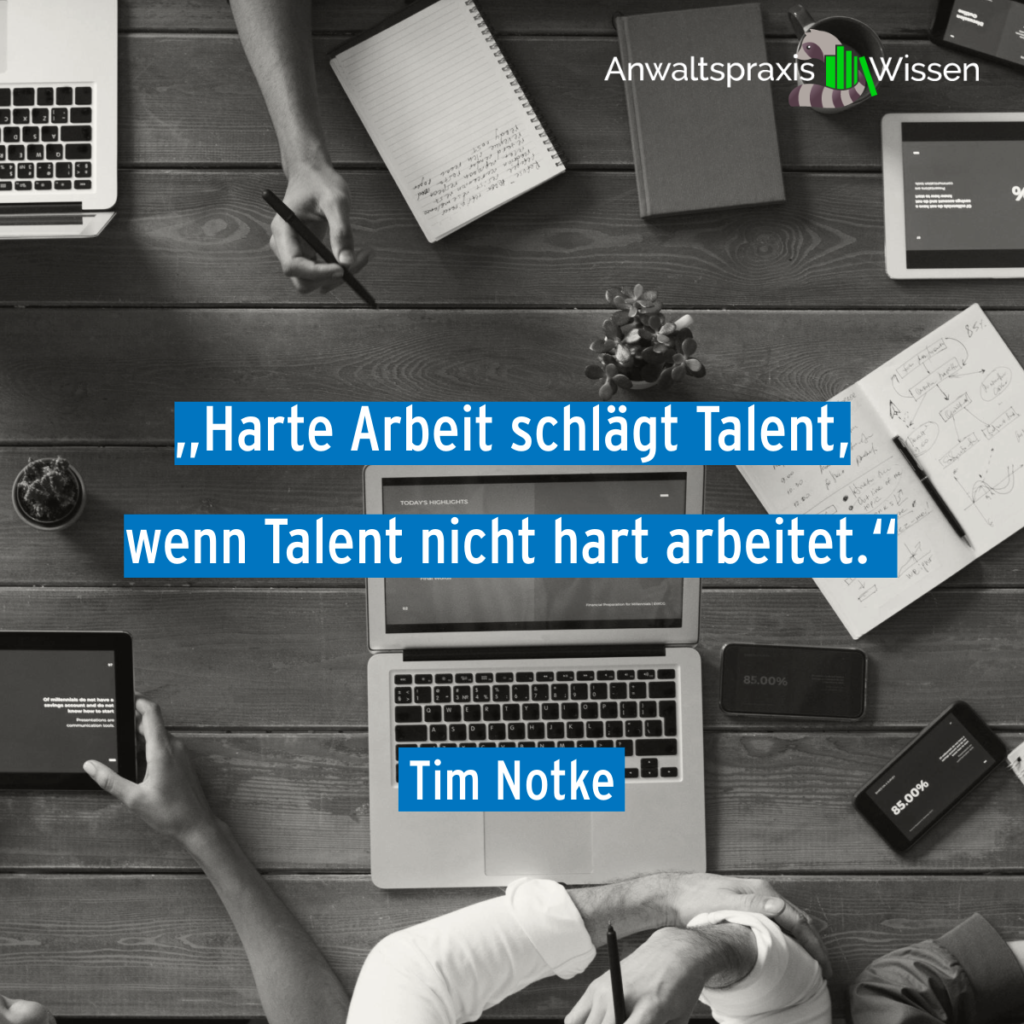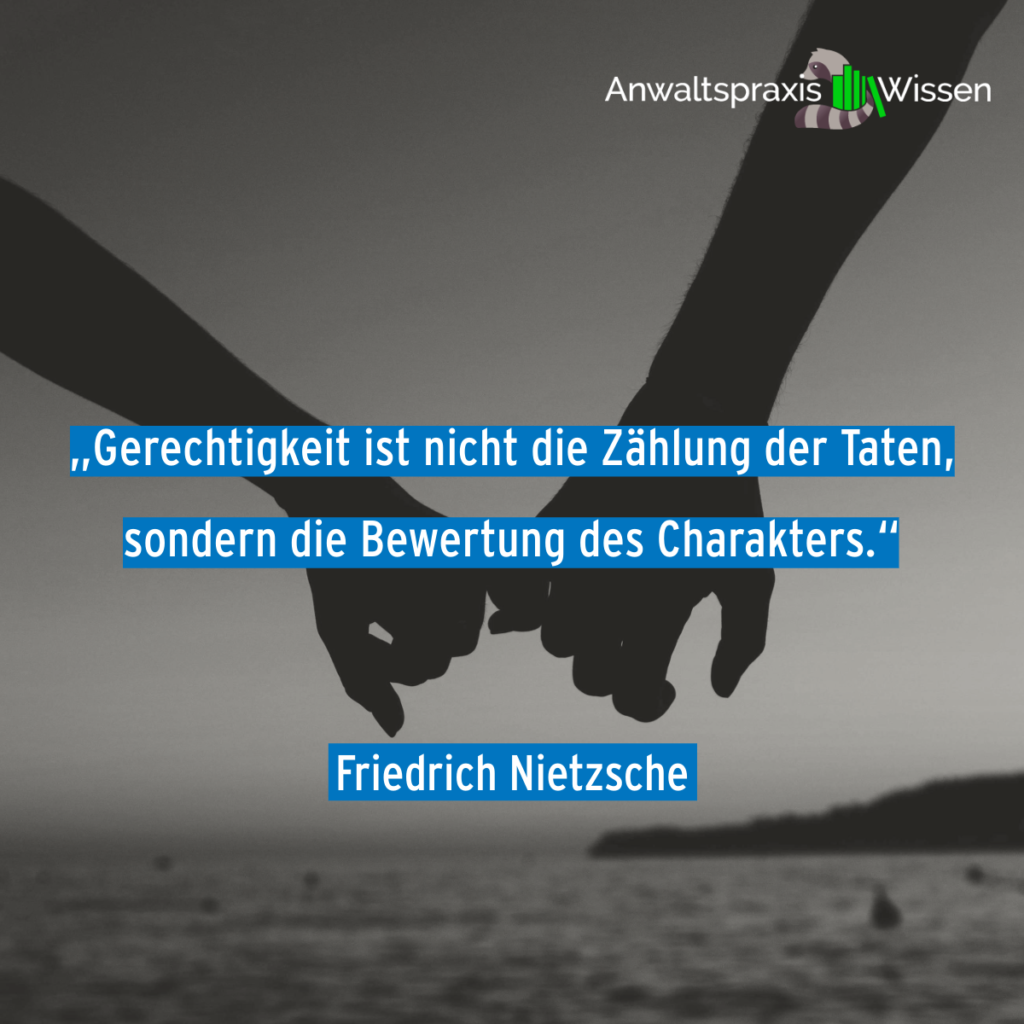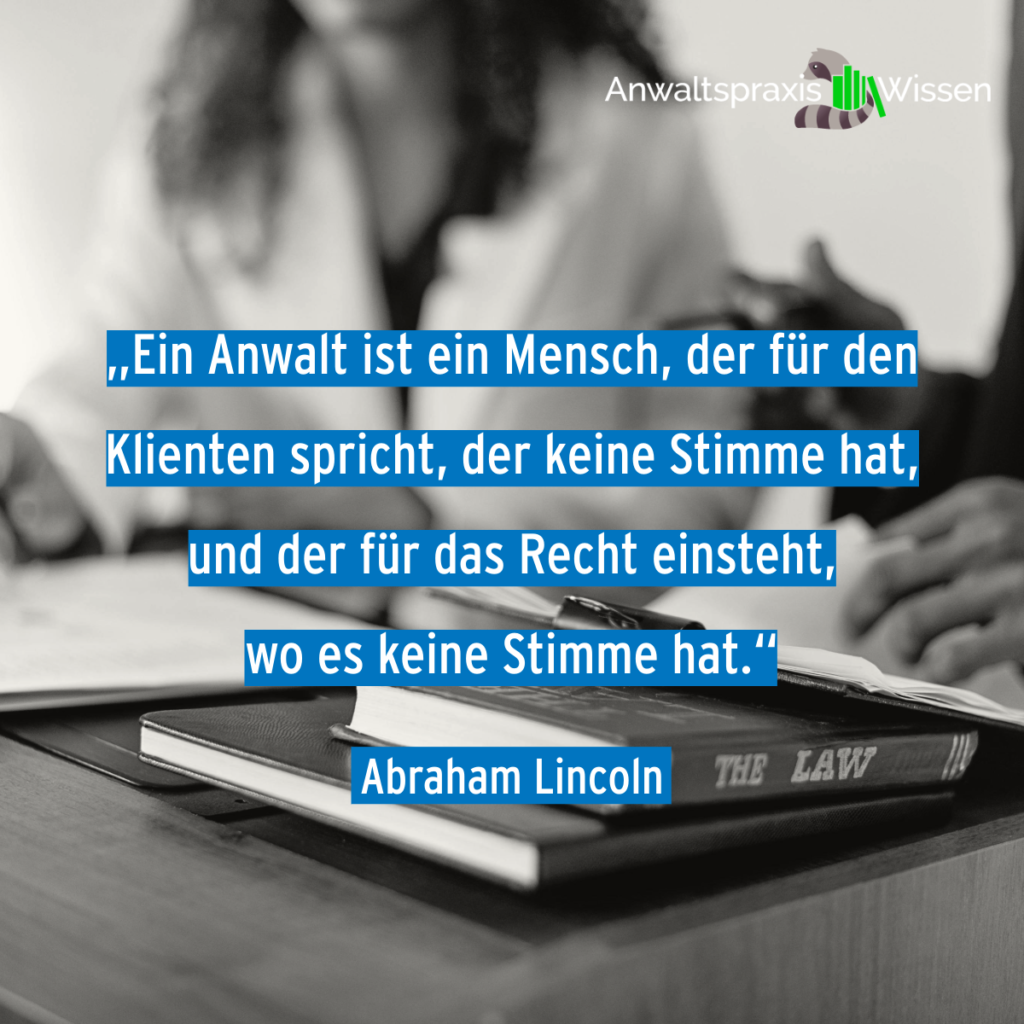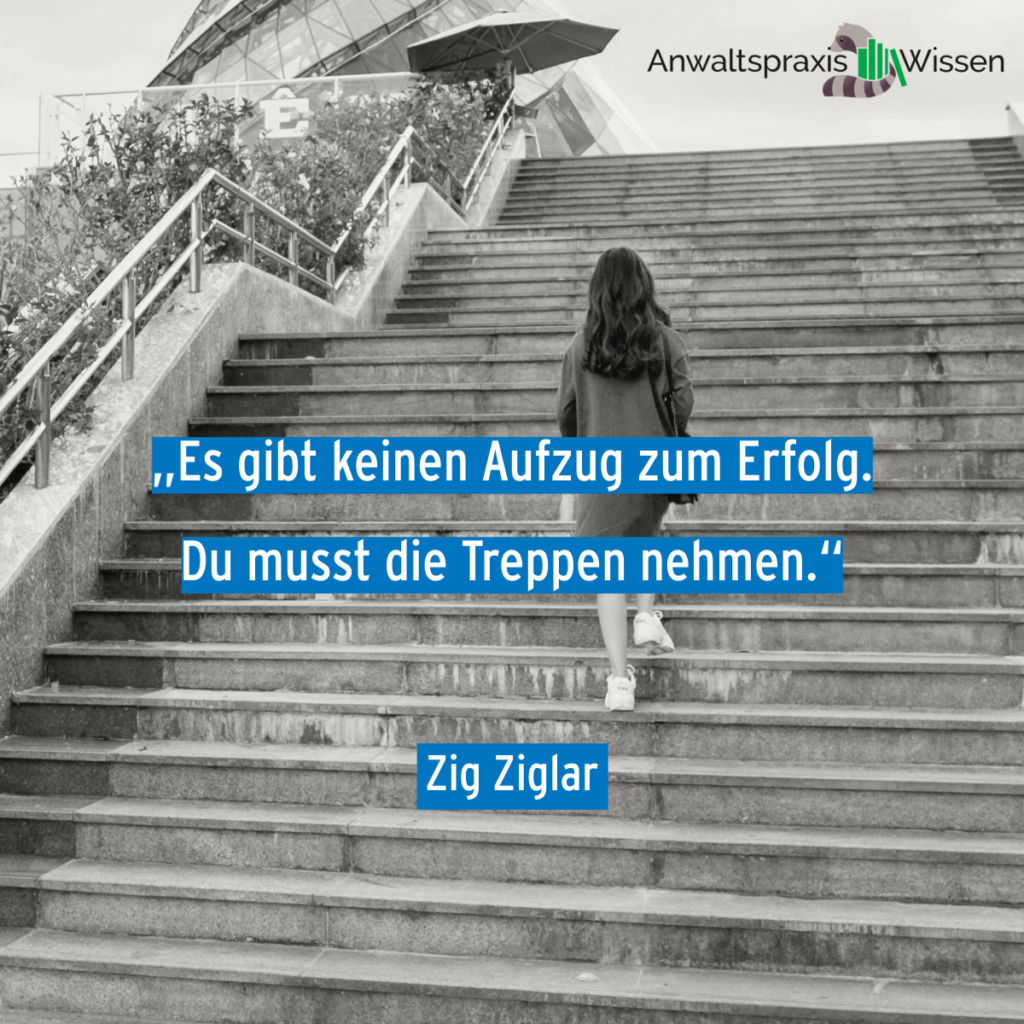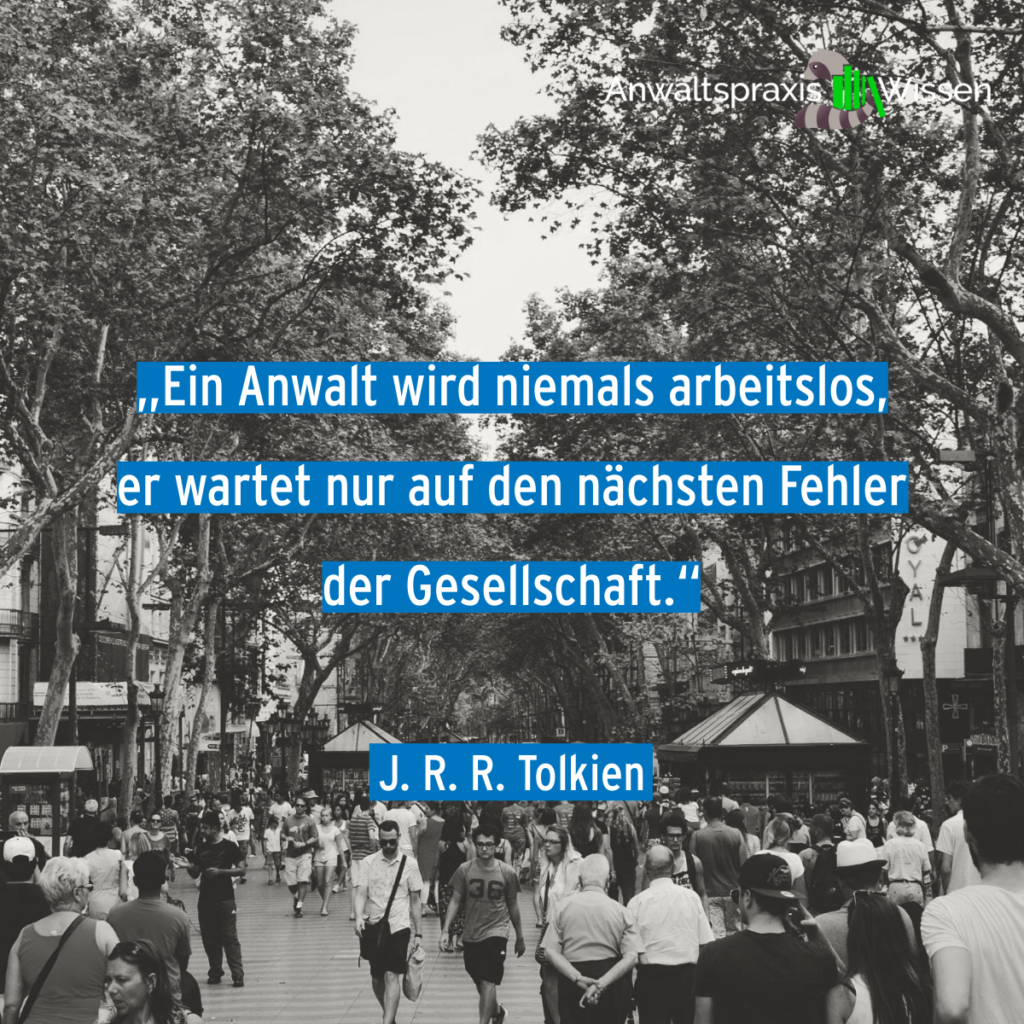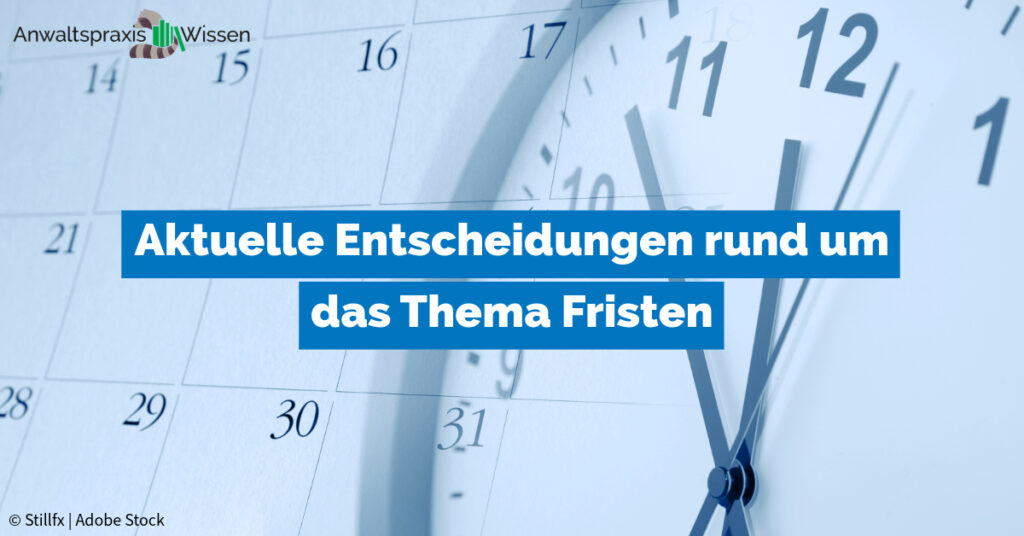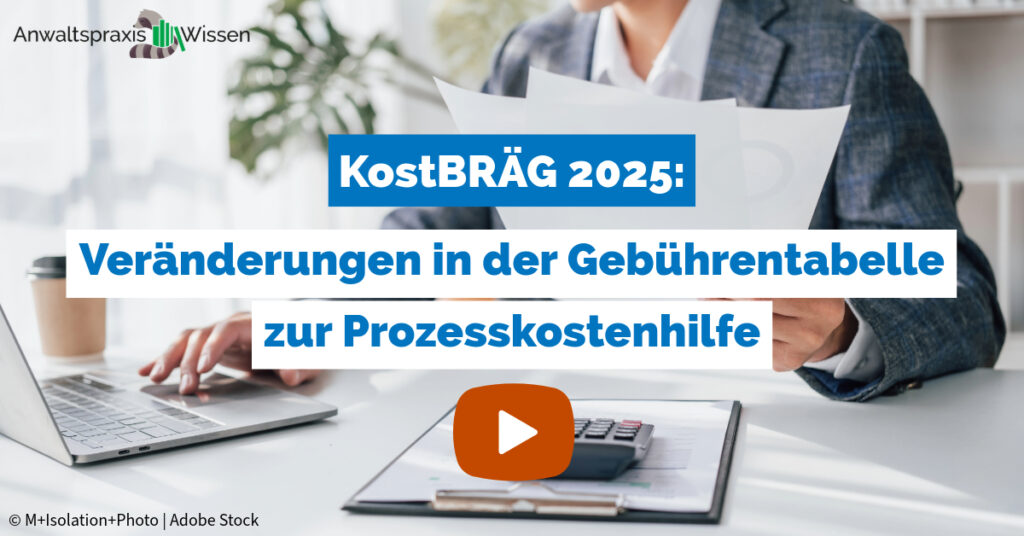Der Verzicht auf sichergestelltes Geld oder andere Gegenstände ist keine Rechtsfolge, die Inhalt eines Urteils sein kann.
(Leitsatz des Verfassers)
I. Sachverhalt
Verfahrensrüge hat Erfolg
Das Landgericht hat den Angeklagten wegen Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge verurteilt und die erweiterte Einziehung von 4.675 EUR angeordnet. Die u.a. auf die Verfahrensrüge gestützte Revision hatte mit der Beanstandung Erfolg, dass das Urteil auf einer Verletzung von § 257c Abs. 2 S. 1 StPO und mithin auf einer gesetzeswidrigen Verständigung beruht.
Verfahrensgeschehen/Verzicht auf Herausgabe von Bargeld
Der Verfahrensrüge liegt folgendes Verfahrensgeschehen zugrunde: Nach Belehrung des Angeklagten gemäß § 257c Abs. 5 StPO stellte die Strafkammer in der Hauptverhandlung für den Fall eines Geständnisses des Angeklagten betreffend die abgeurteilte Tat und bei Verzicht auf die Herausgabe des sichergestellten Bargeldes und weiterer in der Verständigung bezeichneter Gegenstände die Verhängung einer Strafe von mindestens drei und höchstens vier Jahren in Aussicht. Der Angeklagte, sein Verteidiger und die Staatsanwaltschaft stimmten dem Vorschlag zu. Anschließend wurde die Verständigung protokolliert. Der Angeklagte ließ sich geständig ein. Hinsichtlich des sichergestellten Geldes ordnete das Gericht die erweiterte Einziehung von Taterträgen nach § 73a Abs. 1 StGB an.
II. Entscheidung
Verzicht kein zulässiger Verständigungsinhalt …
Nach Auffassung des BGH bestehen durchgreifende rechtliche Bedenken, weil die Strafkammer mit den Verfahrensbeteiligten durch die Aufnahme des Verzichts in die Verständigung einen vom Gesetz nicht vorgesehenen Inhalt vereinbart und damit eine gesetzeswidrige Verständigung getroffen habe. Gegenstand einer Verständigung i.S.d. § 257c Abs. 1 StPO dürfen nach § 257c Abs. 2 S. 1 StPO nur solche Rechtsfolgen sein, die Inhalt des Urteils und der dazugehörigen Beschlüsse sein können, sonstige verfahrensbezogene Maßnahmen im zugrunde liegenden Erkenntnisverfahren sowie das Prozessverhalten der Verfahrensbeteiligten. Verzichtserklärungen wie die hier in Rede stehenden seien materiell-rechtliche Erklärungen des Angeklagten, weil damit eine Änderung der Rechte an dem sichergestellten Gegenstand verbunden sein könne. Sie werden daher – indes missverständlich – auch als „formlose Einziehungen“ bezeichnet, welche eine an sich gesetzlich zwingende förmliche Anordnung der Nebenfolgen nach §§ 73 ff. StGB oder eine im Ermessen des Tatgerichts stehende Entscheidung nach §§ 74 ff. StPO in der Urteilsformel ersetzen können (vgl. BGH, Urt. v. 10.4. 2018 – 5 StR 611/17, BGHSt 63, 116). Ihre rechtlichen Folgen seien auf die Sachrüge hin zu überprüfen (vgl. BGH, Beschl. v. 11.12.2018 – 5 StR 198/18, BGHSt 63, 305; Beschl. v. 14.11.2023 – 1 StR 142/23). Es handele sich daher nicht um verfahrensbezogene Maßnahmen (des Gerichts) oder ein Prozessverhalten der Verfahrensbeteiligten i.S.d. § 257c Abs. 2 S. 1 StGB (vgl. hierzu LR/Stuckenberg, StPO, 27. Aufl., § 257c Rn 39 ff.; Meyer-Goßner/Schmitt, StPO, 67. Aufl. 2024, § 257c Rn 13 ff.). Die Verzichtserklärung des Angeklagten wäre mithin nur dann ein zulässiger Verständigungsgegenstand i.S.d. § 257c Abs. 2 S. 1 StPO, wenn sie eine Rechtsfolge darstellte, die Inhalt des Urteils oder eines dazugehörigen Beschlusses sein kann. Dies ist nicht der Fall.
… da kein als Rechtsfolge möglicher Urteilsinhalt
Der Verzicht auf sichergestelltes Geld oder andere Gegenstände sei keine Rechtsfolge, die Inhalt eines Urteils sein könne. Einen zum Urteil gehörenden Beschluss mit einem solchen Inhalt sehe das Gesetz ebenfalls nicht vor. Inhalt eines Urteils i.S.d. § 257c Abs. 2 S. 1 StPO meine die Urteilsformel. Denn was in ihr Ausdruck findet, ist entschieden (KK-StPO/Tiemann, 9. Aufl. 2023, § 260 Rn 8); nur sie allein erwachse in Rechtskraft und bilde die Grundlage für die Vollstreckung (vgl. LR/Stuckenberg, a.a.O., § 260 Rn 27, 31). Sämtliche Rechtsfolgen einer abgeurteilten Straftat müssten daher in die Urteilsformel aufgenommen werden (Meyer-Goßner/Schmitt, a.a.O., § 260 Rn 28). Rechtsfolgen i.S.v. § 257c Abs. 2 S. 1 StPO seien mithin nur solche, die das Gesetz vorsehe und die durch das Urteil verhängt werden können (vgl. Meyer-Goßner/Schmitt, a.a.O., § 257c Rn 8; KK-StPO/Moldenhauer/Wenske, a.a.O., § 257c Rn 8, 15; siehe für die Kompensation für eine rechtsstaatswidrige Verfahrensverzögerung BGH, Beschl. v. 25.11.2015 – 1 StR 79/15, BGHSt 61, 43, 46). Dies werde – so der BGH – durch systematische Erwägungen gestützt. Auch ergebe sich aus den Gesetzesmaterialien ein dieses Ergebnis bestätigender Anhalt. Danach können in materiell-rechtlicher Hinsicht Inhalt einer Verständigung die Maßnahmen sein, die das erkennende Gericht verfügen, also Maßnahmen, die es im Erkenntnis treffen kann (vgl. BT-Drucks 16/11736, S. 11). Die Abgabe einer Verzichtserklärung durch den Angeklagten und die Reaktion der Staatsanwaltschaft nebst den hieraus folgenden materiellen Rechtsfolgen (vgl. hierzu BGH, Beschl. v. 11.12.2018 – 5 StR 198/18, a.a.O.) unterliegen jedoch nicht der Verfügung des Gerichts. Vielmehr stehe es dem Angeklagten frei, eine Verzichtserklärung abzugeben, so wie die Staatsanwaltschaft in ihrer Reaktion hierauf frei sei. Die Rechtsfolgen ergeben sich ohne Weiteres aus den einschlägigen rechtlichen Regelungen. Sie könnten daher nicht mit konstitutiver Wirkung durch das Gericht im Urteil bestimmt werden.
Formlose Einziehung
Daran ändere nichts, dass die „formlose Einziehung“ rechtlich nicht ausgeschlossen sei (vgl. BGH, Urt. v. 10.4.2018 – 5 StR 611/17, a.a.O.) und das Gericht ungeachtet eines wirksamen Verzichts die förmliche Einziehung anordnen könne (vgl. u.a. BGH, Urt. v. 13.12.2018 – 3 StR 307/18, BGHSt 63, 314). Denn was ein gesetzlich zulässiger Teil einer Verständigung sein kann, richte sich gemäß § 257c Abs. 1 S. 1 StPO allein „nach Maßgabe“ des § 257c Abs. 2 StPO. Darin ist mithin abschließend festgelegt, über welche Rechtsfolgen sich das Gericht mit den Verfahrensbeteiligten verständigen darf. Alle in der Vorschrift nicht erwähnten Verhaltensweisen der Verfahrensbeteiligten seien daher als Verständigungsgegenstände ausgeschlossen (LR/Stuckenberg, StPO, 27. Aufl., § 257c Rn 36); solche Vereinbarungen – wie hier die über den Verzicht auf sichergestellte Gegenstände – seien untersagt (vgl. BVerfG, Urt. v. 19.3.2013 – 2 BvR 2628/10, BVerfGE 133, 168).
Dies gelte hinsichtlich des als Tatertrag sichergestellten Bargeldes umso mehr, als die Einziehung von Taterträgen nach §§ 73 ff. StGB aufgrund ihres zwingenden Charakters nicht zu den einer Verständigung zugänglichen Rechtsfolgen gehöre (BGH, Beschl. v. 6.2.2018 – 5 StR 600/17 Rn 8, NStZ 2018, 366; v. 25.1.2023 – 1 StR 288/22, NStZ 2023, 696), was mit der Zulassung einer „formlosen Einziehung“ als Gegenstand einer Verständigung umgangen würde (a.A. möglicherweise SSW-StPO/Ignor/Wegener, 5. Aufl., § 257c Rn 63; KMR-StPO/von Heintschel-Heinegg, 56. EL, § 257c Rn 28).
III. Bedeutung für die Praxis
Die Entscheidung ist zutreffend, sodass der BGH zu Recht das Urteil wegen des Verfahrensfehlers aufgehoben hat (§ 337 Abs. 1 StPO). Zwar hatte der Generalbundesanwalt (nach Ansicht des BGH) zutreffend darauf hingewiesen, dass die mit dem vereinbarten Verzicht beabsichtigten Rechtsfolgen auch durch entsprechende gerichtliche Anordnungen nach § 74 StGB, § 33 BtMG und § 73a Abs. 1 StGB (ggf. i.V.m. § 73b Abs. 1 Nr. 2 StGB) erreichbar gewesen wären; zudem hatte das LG letztlich die erweiterte Einziehung des sichergestellten Bargeldes nach § 73a Abs. 1 StGB angeordnet und sich mithin insoweit nicht mit dem Verzicht begnügt. Dies änderte nach Auffassung des BGH aber nichts daran, dass die Strafkammer zuvor eine Vereinbarung mit den Verfahrensbeteiligten mit einem gemessen an § 257c Abs. 2 S. 1 StPO unzulässigen Inhalt geschlossen hatte, die in ihrer Gesamtheit daher keine nach § 257 Abs. 1 StPO zulässige Verständigung, sondern eine teilweise gesetzeswidrige Absprache darstellte. In einem solchen Fall könne, so der BGH, regelmäßig nicht ausgeschlossen werden, dass die Verständigung ohne den fehlerhaften Bestandteil nicht zustande gekommen wäre und der Angeklagte das verständigungsbasierte Geständnis nicht abgegeben hätte (LR/Stuckenberg, a.a.O., Rn 86; MüKo-StPO/Jahn, 2. Aufl., § 257c Rn 204).