1. Dem der deutschen Sprache nicht hinreichend mächtigen Beschuldigten steht grundsätzlich das Recht auf Übersendung einer Übersetzung der Anklageschrift in einer für ihn verständlichen Sprache zu, was in aller Regel schon vor der Hauptverhandlung zu geschehen hat.
2. Die mündliche Übersetzung allein des Anklagesatzes genügt nur in Ausnahmefällen, namentlich dann, wenn der Verfahrensgegenstand tatsächlich und rechtlich einfach zu überschauen ist.
(Leitsätze des Verfassers)
I. Sachverhalt
Keine schriftliche Übersetzung der Anklageschrift
Das LG hat den Angeklagten u.a. wegen versuchten Mordes angeklagt. Der der deutschen Sprache nur rudimentär mächtige Angeklagte beantragte erfolglos zu Beginn der Hauptverhandlung deren Aussetzung. Zur Begründung führte er unter anderem aus, dass er, auch wenn er die kurdische Sprache besser spreche als die türkische, geschriebene Texte nur auf Türkisch verstehen könne. Eine türkische Übersetzung der Anklageschrift sei ihm nicht ausgehändigt worden. Eine schriftliche Übersetzung der Anklageschrift in die türkische Sprache erhielt der Angeklagte bis zum Schluss der Hauptverhandlung nicht. Am 6. Verhandlungstag gab der Angeklagte eine bestreitende Einlassung ab. Der Anklagesatz wurde für den Angeklagten während seiner Verlesung mündlich übersetzt, ebenso der weitere Verlauf der Hauptverhandlung. Seine Revision war erfolgreich.
II. Entscheidung
Grundsätzlich Anspruch auf schriftliche Übersetzung …
Der Angeklagte sei in seinem Recht aus Art. 6 Abs. 3 Buchst. a) EMRK verletzt worden, innerhalb möglichst kurzer Frist in einer ihm verständlichen Sprache in allen Einzelheiten über Art und Grund der gegen ihn erhobenen Beschuldigung unterrichtet zu werden. Art. 6 Abs. 3 Buchst. a) EMRK gewähre dem der deutschen Sprache nicht hinreichend mächtigen Beschuldigten grundsätzlich das Recht auf Übersendung einer Übersetzung der Anklageschrift in einer für ihn verständlichen Sprache. Dies habe in aller Regel schon vor der Hauptverhandlung zu geschehen. Denn ein Angeklagter könne auf die das Strafverfahren abschließende Entscheidung nur dann hinreichend Einfluss nehmen, wenn ihm der Verfahrensgegenstand in vollem Umfang bekannt ist, was nicht zuletzt die Kenntnis der Anklageschrift einschließlich des wesentlichen Ergebnisses der Ermittlungen voraussetzt. Die mündliche Übersetzung allein des Anklagesatzes genüge nur in Ausnahmefällen, namentlich dann, wenn der Verfahrensgegenstand tatsächlich und rechtlich einfach zu überschauen ist (BGH NStZ 2017, 63 = StRR 5/2016, 10 [Arnoldi]; NStZ 2014, 725 = StRR 2014, 386 [Deutscher]).
… auch in diesem Fall
Letzteres treffe auf den dem Angeklagten zur Last gelegten Vorwurf des Mordes, zumal unter Annahme von zwei Mordmerkmalen, nicht zu. Jedenfalls angesichts der Schwere und Komplexität des konkret erhobenen Tatvorwurfs genüge auch der Haftbefehl, der dem Angeklagten in türkischer Übersetzung ausgehändigt worden war, nicht, um diesen über Art und Grund der in der Hauptverhandlung erhobenen Beschuldigung in allen Einzelheiten zu informieren; der Angeklagte sei auch nicht gehalten, den Haftbefehl mit der Anklage abzugleichen. Dies gelte erst recht mit Blick darauf, dass dem Angeklagten mit dem Haftbefehl – anders als mit dem zu Beginn der Hauptverhandlung verlesenen Anklagesatz (§ 243 Abs. 3 S. 1 StPO) – die Erfüllung von lediglich einem Mordmerkmal angelastet worden war. Ein Angeklagter könne auf die das Strafverfahren abschließende Entscheidung nur dann hinreichend Einfluss nehmen, wenn ihm der Verfahrensgegenstand in vollem Umfang bekannt ist (BGH NStZ 2017, 63 = StRR 5/2016, 10 [Arnoldi]). Die vorstehenden Ausführungen würden entsprechend mit Blick auf die gerügte Verletzung des § 187 Abs. 2 S. 1, S. 3 GVG gelten. Dass der Angeklagte einen Verteidiger hat, führe unter den hier gegebenen Umständen – auch unter Berücksichtigung des § 187 Abs. 2 S. 5 GVG – zu keiner abweichenden rechtlichen Bewertung (BGH NStZ 2017, 63 = StRR 5/2016, 10 [Arnoldi]; NStZ 2014, 725 = StRR 2014, 386 [Deutscher]). Es sei nicht auszuschließen, dass der Angeklagte insgesamt in anderer Weise als tatsächlich erfolgt auf den Verfahrensverlauf Einfluss genommen hätte, wäre er gem. Art. 6 Abs. 3 Buchst. a) EMRK über Art und Umfang des Tatvorwurfs in allen Einzelheiten frühzeitig informiert worden.
III. Bedeutung für die Praxis
Nahezu ein Selbstläufer
Art. 6 Abs. 3 Buchst. a) EMRK und § 187 Abs. 2 GVG bilden den rechtlichen Rahmen für schriftliche Übersetzungen bei sprachunkundigen Angeklagten. Der BGH a.a.O. hat mehrfach klargestellt, dass eine schriftliche Übersetzung der Anklageschrift der Regelfall ist, von dem nur in rechtlich und tatsächlich einfach zu überschauenden Verfahren abgesehen werden kann. Liegt diese Ausnahme nicht vor, ist eine schriftliche Übersetzung der Anklageschrift entgegen der Regelannahme in § 187 Abs. 2 S. 5 GGVG auch dann erforderlich, wenn der Angeklagte einen Verteidiger hat (zur schriftlichen Übersetzung eines Strafbefehls EuGH NJW 2018, 142; BVerfG StV 2017, 775). Durch die Mitteilung der Anklageschrift soll „gerade die durch Art. 6 Abs. 3 Buchst. a) MRK gewährleistete Information des Beschuldigten über den Tatvorwurf ‚in allen Einzelheiten‘ bewirkt werden. Auch die Erklärungsrechte des § 201 Abs. 1 S. 1 StPO werden möglicherweise beschnitten, wenn der Angeschuldigte über den Anklagevorwurf nicht umfassend und zeitnah unterrichtet wird“ (NStZ 2014, 725 Rn 4 = StRR 2014, 386 [Deutscher]). Angesichts dieser klaren Vorgaben ist die Vorgehensweise des LG schlicht nicht nachvollziehbar, dem Angeklagten nach seiner Erklärung zu Anfang zu keinem Zeitpunkt eine türkische Übersetzung zukommen zu lassen. Spätestens nach der Einlassung des Angeklagten ist die Revision zum Selbstläufer geworden. Der BGH legt auch unmissverständlich klar, dass ein Ausnahmefall hier – offensichtlich schon wegen Art und Schwere des Tatvorwurfs – nicht vorgelegen hat. Das dürfte bei erstinstanzlichen Verfahren vor dem LG oder OLG ohnehin kaum je der Fall sein. Auch hinsichtlich der Frage des Zeitpunktes wird man mit dem BGH hinsichtlich der Anklageschrift grundsätzlich eine Übersendung vor Beginn der Hauptverhandlung zu verlangen haben. Allerdings sind hier Ausnahmen denkbar, etwa wenn sich die Sprachunkundigkeit erst in der Hauptverhandlung ergibt oder die zuvor gewählte Sprache sich wohl wie hier erst dann als falsch herausstellt, was bei Angeklagten aus Mehrvölkerstaaten nicht selten der Fall ist. Dann ist unverzüglich eine schriftliche Übersetzung erstellen zu lassen und zu übergeben. Bis dahin ist die Hauptverhandlung auszusetzen (zu allem Burhoff, Handbuch für die strafrechtliche Hauptverhandlung, 10. Aufl. 2022, Rn 604 ff. m.w.N.).
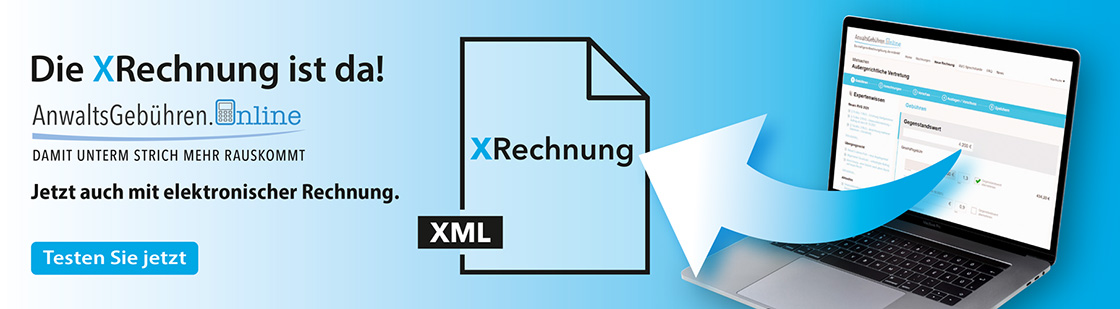

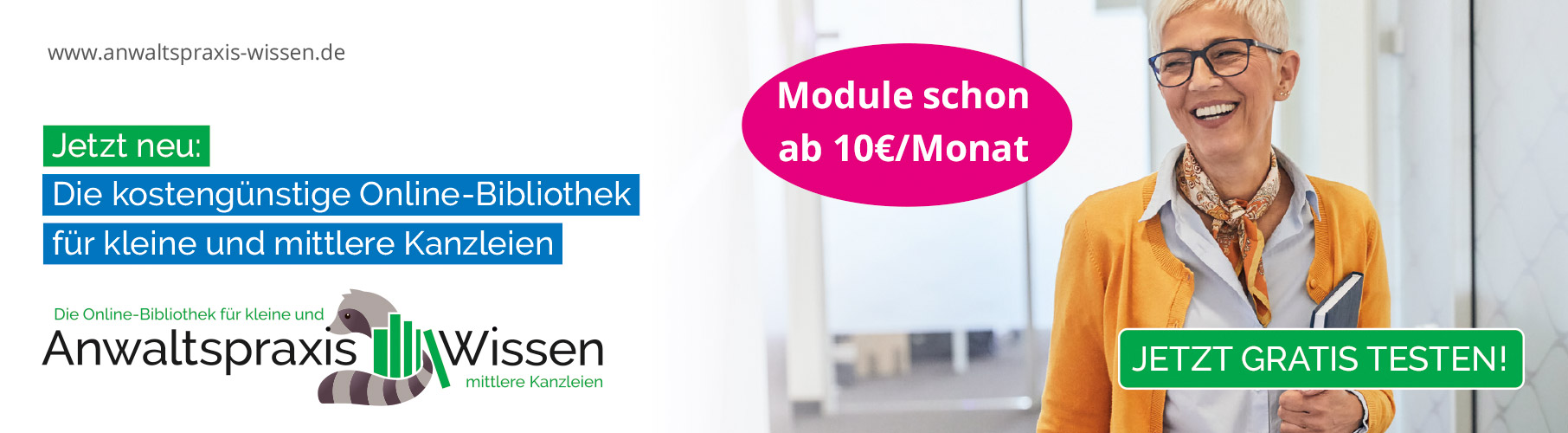


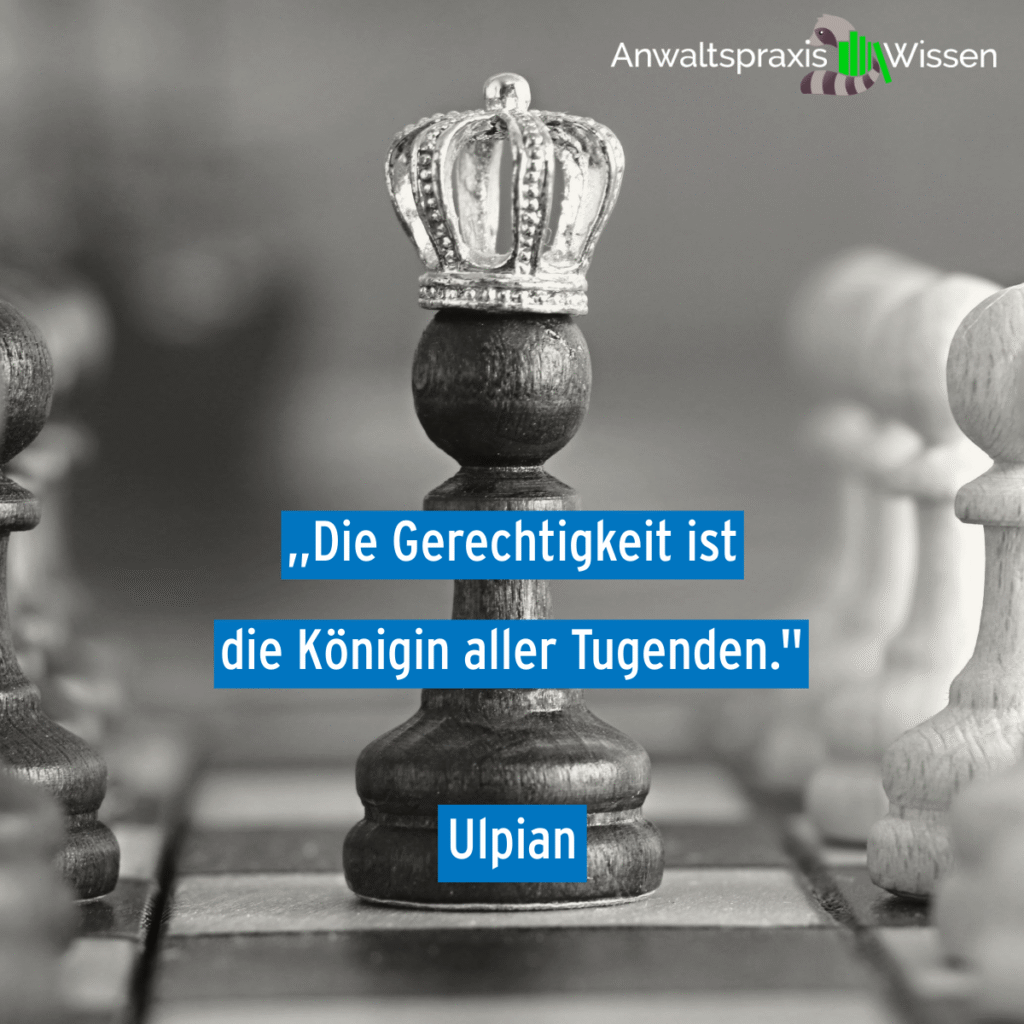

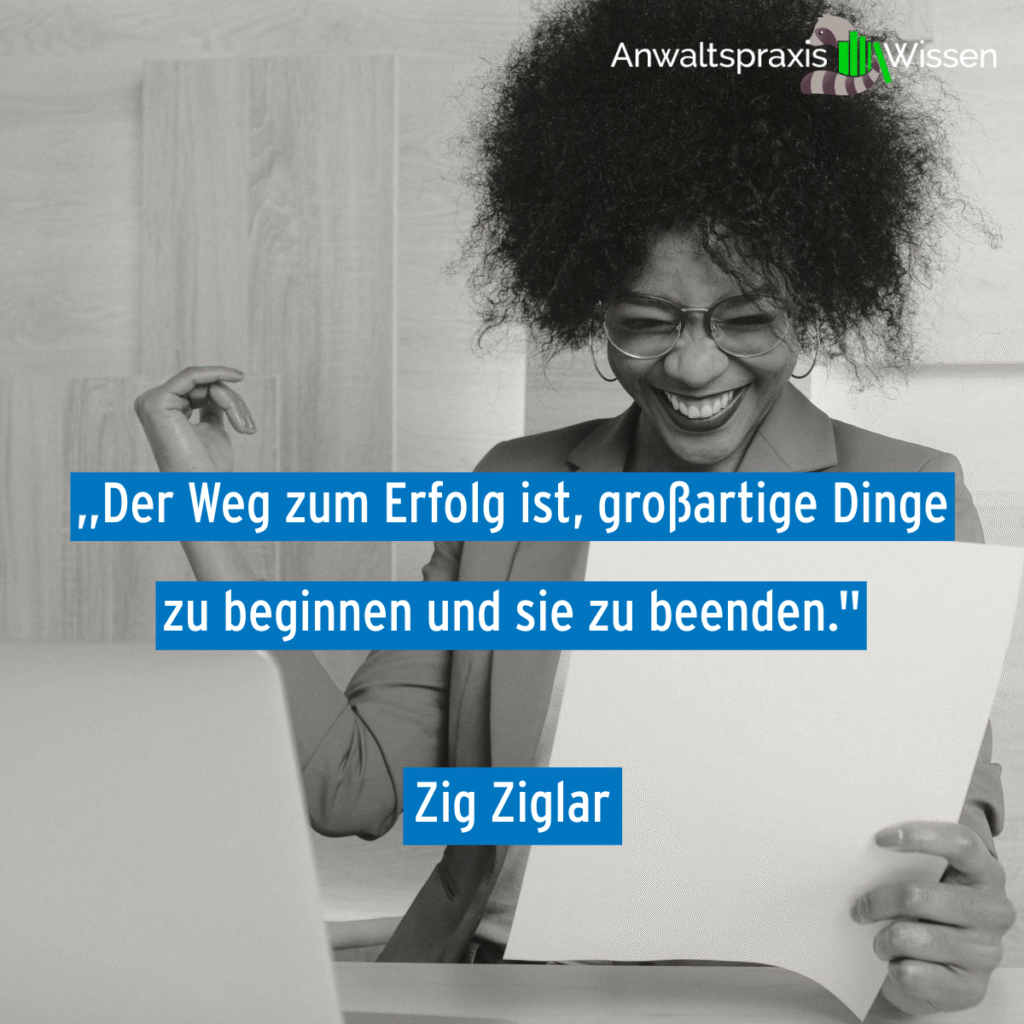

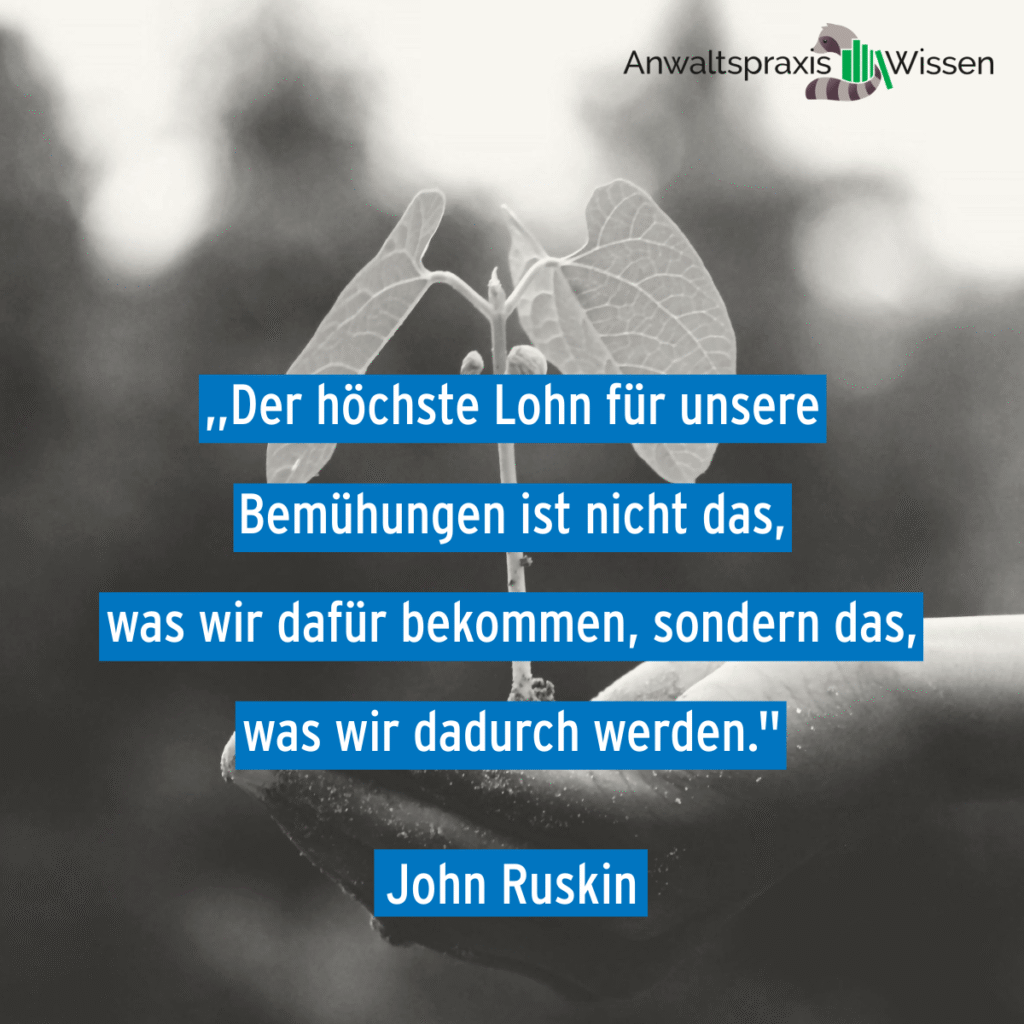

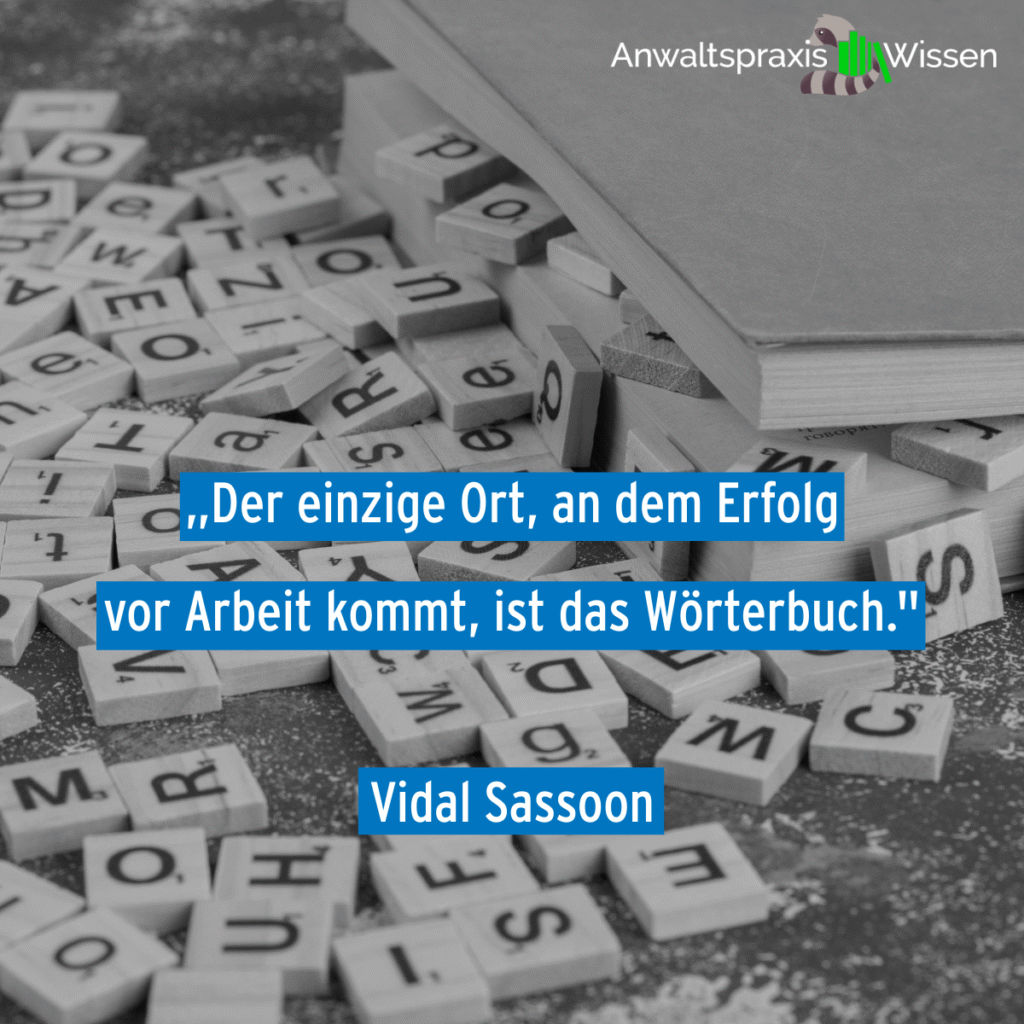
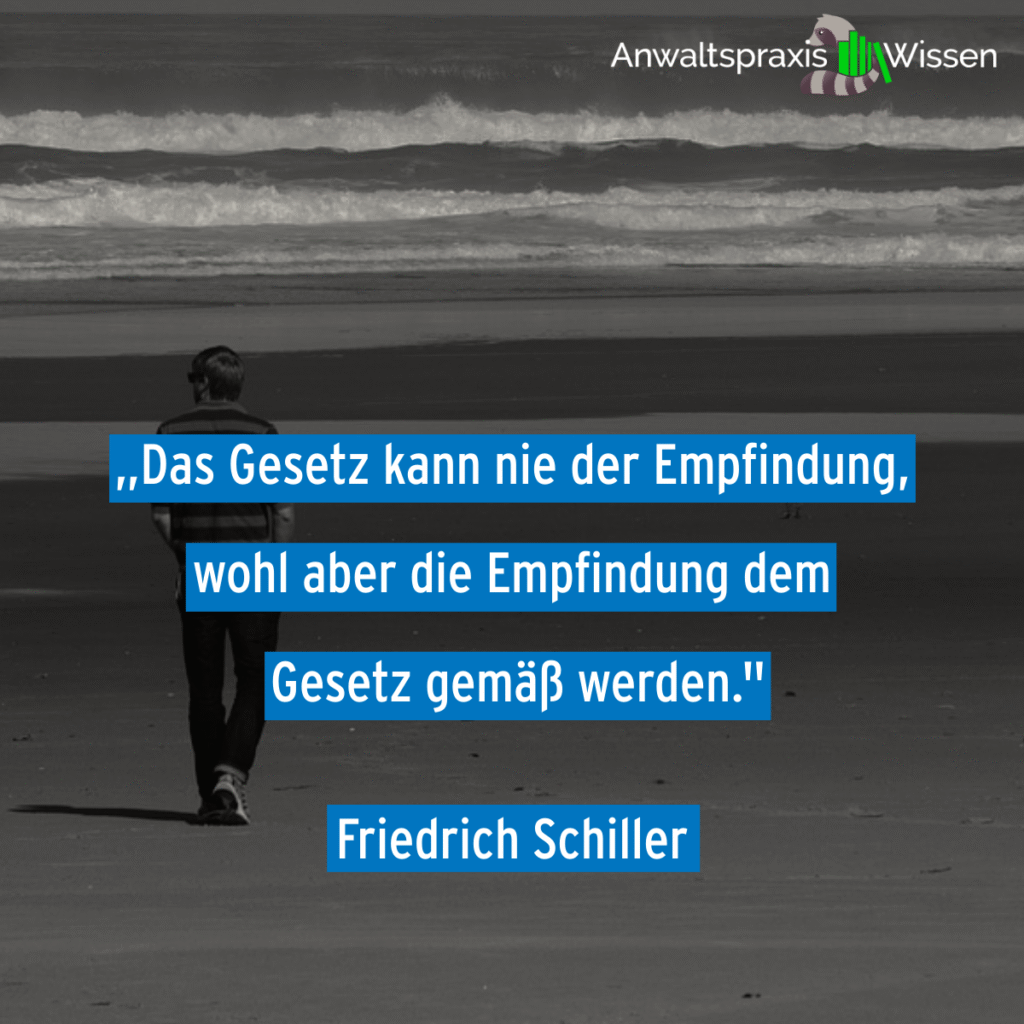
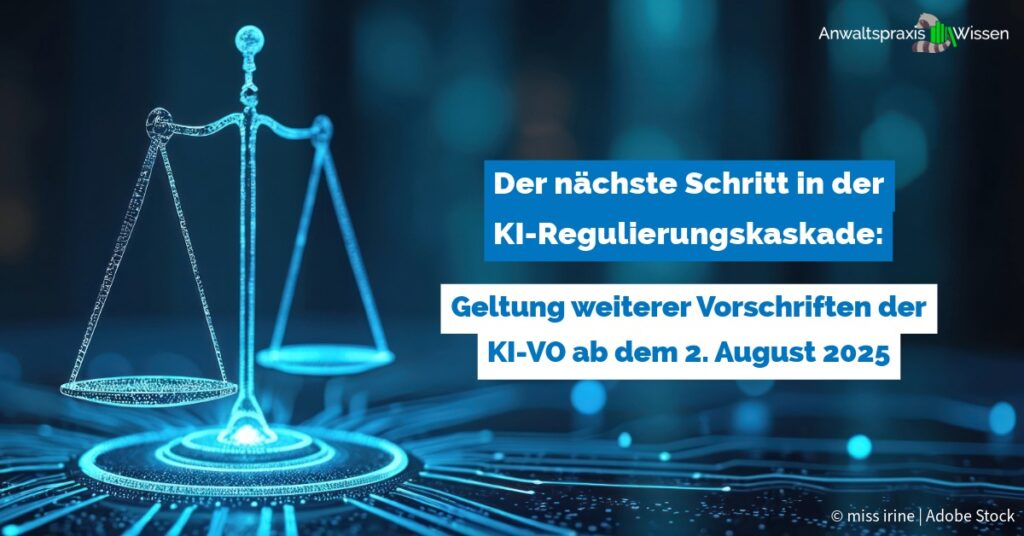
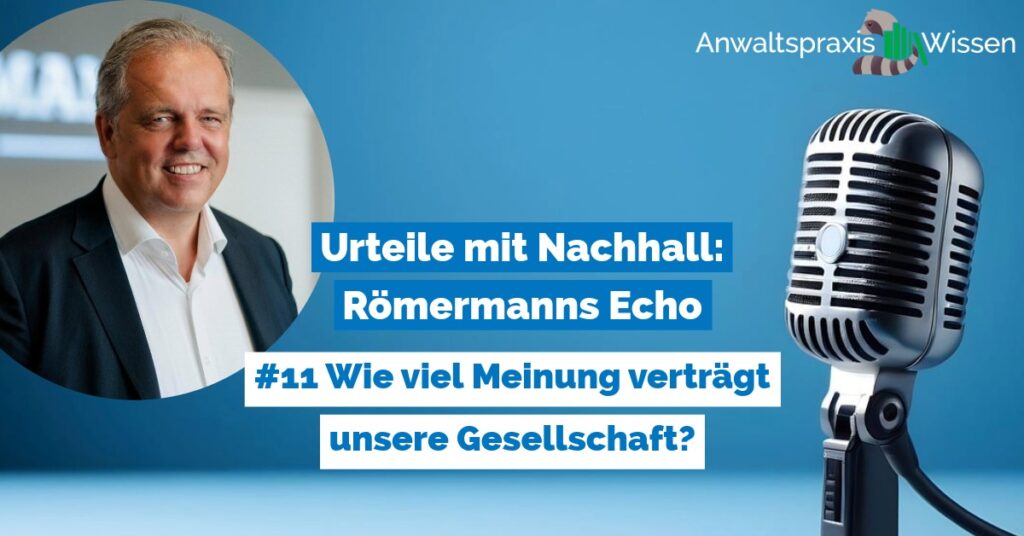
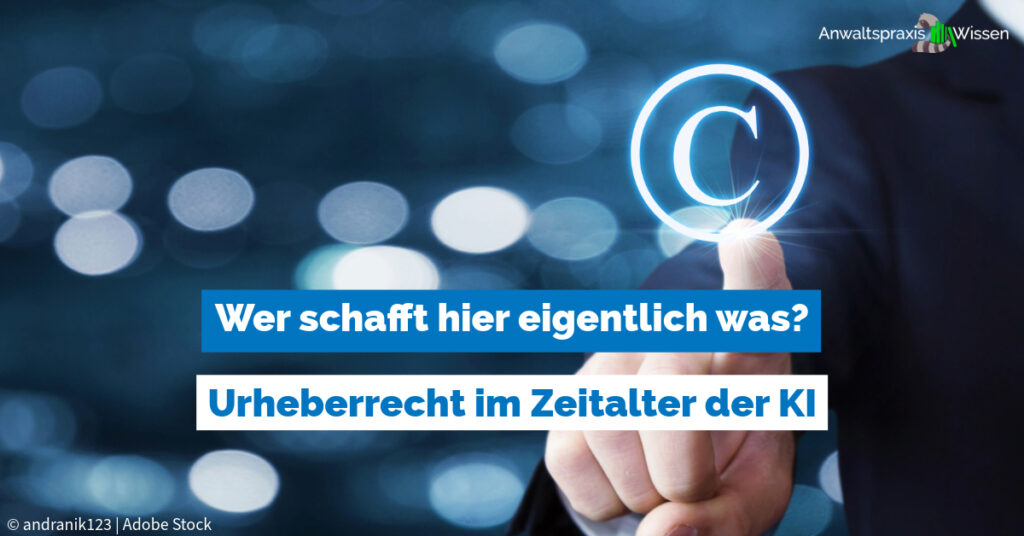

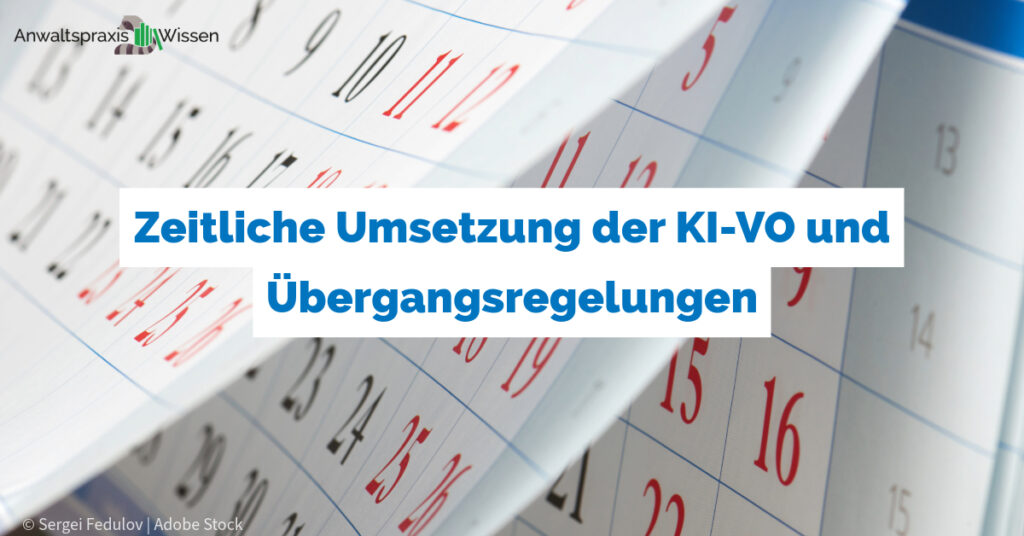




![Erbrecht im Gespräch: Kurze[s] Update: #15 Die Rechte des Erben vor dem Erbfall – mit Walter Krug](https://anwaltspraxis-magazin.de/wp-content/uploads/2025/05/Erbrecht-im-Gespraech-15-1024x536.jpeg)