I. Aktive Nutzungspflicht des beA
51
Jeder Rechtsanwalt verfügt über ein besonderes Anwaltspostfach (beA). Dies ergibt sich aus § 31a Abs. 1 S. 1 BRAO und § 21 Abs. 1 S. 2 RAVPV jeweils in der Fassung vom 12.5.2017, die zum 1.1.2018 in Kraft getreten ist. Sie regeln, dass die Bundesrechtsanwaltskammer für jeden bei einer Rechtsanwaltskammer eingetragenen Rechtsanwalt ein beA empfangsbereit einrichtet.
Gemäß § 31a Abs. 6 BRAO sind Rechtsanwälte verpflichtet, die für die Nutzung des beAs erforderlichen technischen Einrichtungen vorzuhalten sowie Zustellungen und den Zugang von Mitteilungen über das beA zur Kenntnis zu nehmen. Trotzdem gibt es immer noch Rechtsanwälte, die ihr beA nicht freigeschaltet haben. Dies bedeutet nicht nur, dass sie Nachrichten, die an ihr beA-Postfach übersandt werden, nicht zur Kenntnis nehmen können, sondern auch, dass sie der in einigen Fällen schon bestehenden aktiven Nutzungspflicht des beA nicht nachkommen können.
1. Exkurs: Pflicht zur Rücksendung des eEBs
52
Der erste Fall der aktiven Nutzungspflicht des beAs ist die Rücksendung des eEBs. Gemäß § 14 S. 1 BORA besteht die berufsrechtliche Verpflichtung, an Zustellungen mitzuwirken und Empfangsbekenntnisse zurückzusenden. Wird bei einer nicht ordnungsgemäßen Zustellung die Mitwirkung verweigert, muss der Rechtsanwalt dies dem Absender unverzüglich mitteilen, § 14 S. 2 BORA.
Gemäß § 174 Abs. 4 S. 3 ZPO wird eine elektronische Zustellung durch ein eEB nachgewiesen: Wird vom Gericht mit der Zustellung ein strukturierter Datensatz zur Verfügung gestellt, ist das eEB in Form dieses strukturierten Datensatzes zu übermitteln, § 174 Abs. 4 S. 4 und 5 ZPO. Da es Gerichte gibt, die noch nicht in der Lage sind, strukturierte Datensätze zu versenden, zu empfangen und weiterzuverarbeiten, wurde zum 1.1.2020 § 174 Abs. 4 S. 6 ZPO eingeführt. Hiernach ist das eEB, wenn das Gericht keinen strukturierten Datensatz mitversandt hat, als elektronisches Dokument i.S.v. § 130a ZPO zu übermitteln.
§ 37 Abs. 1 StPO, § 56 Abs. 2 VwGO, § 53 Abs. 2 FGO, § 50 Abs. 2 ArbGG und § 63 Abs. 2 SGG verweisen im Wesentlichen auf die Zustellvorschriften des § 174 ZPO.
Hinweis:Somit besteht eine aktive Nutzungspflicht des beAs zur Rücksendung des eEBs sei es als strukturierter Datensatzes oder als elektronisches Dokument i.S.v. § 130a ZPO.
2. Nutzung des beA bei einer Störung des Faxgeräts
53
Ein zweiter Fall der aktiven Nutzungspflicht des beAs könnte bestehen, wenn sich bei dem Versuch, kurz vor Fristablauf einen Schriftsatz per Fax an das Gericht zu senden, herausstellt, dass dies aufgrund von technischen Problemen nicht möglich ist. Dies bejaht das Oberlandesgericht Dresden in bislang zwei Entscheidungen.
54
■OLG Dresden, Beschl. v. 29.7.2019 – 4 U 879/19
Das OLG Dresden hatte über einen Antrag auf Widereinsetzung in den vorherigen Stand zu entscheiden. Die Berufungsbegründung ging einen Tag nach dem Ablauf der Berufungsbegründungsfrist per Fax ein. In dem Widereinsetzungsantrag wurde unter Vorlage einer eidesstattlichen Versicherung einer Mitarbeiterin der Beklagtenvertreterin behauptet, dass an dem letzten Tag der Berufungsbegründungsfrist beginnend am frühen Nachmittag zunächst durch die Beklagtenvertreterin selbst, später bis ca. 18:30 Uhr durch die Kanzleikraft „unzählige Versuche“ unternommen worden seien, die Berufungsbegründung zu faxen. Ausführungen dazu, wieso diese nicht per beA übersandt wurde, erfolgten nicht.
Das OLG Dresden gewährte keine Wiedereinsetzung in den vorigen Stand, da die Beklagte nicht ohne Verschulden an der Einhaltung der Berufungsbegründung gehindert war. Es wies darauf hin, dass keine Ausführungen dazu erfolgten, wieso ein Versand per beA nicht möglich war. In den Gründen führte das OLG aus:
„[…] Die Wiedereinsetzung in die versäumte Berufungsbegründungsfrist scheitert aber auch daran, dass die Beklagtenvertreterin nicht vorgetragen hat, wieso ihr eine Fristwahrung nicht auf anderem Wege möglich war […].“
Es „[…] bleibt weiterhin unklar, wieso eine Versendung der Berufungsbegründungsschrift nicht über das elektronische Anwaltspostfach (beA) möglich gewesen wäre, zu dessen passiver Nutzung die Beklagtenvertreterin gem. § 31a Abs. 6 BRAO verpflichtet war. Zwar sieht das Gesetz eine aktive Nutzungspflicht derzeit noch nicht vor. Mit erfolgreicher Anmeldung zum beA ist jedoch die Schaltfläche „Nachrichtenentwurf erstellen“ freigeschaltet und besteht damit grundsätzlich auch die Möglichkeit, aus dem beA heraus auch Nachrichten zu versenden. Eine qualifizierte elektronische Signatur ist hierzu nicht erforderlich, wenn die Nachricht aus dem Postfach des Rechtsanwalts von diesem selbst versendet wird. Mitarbeiter auf einem anderen Postfach können Nachrichten des Rechtsanwalts, die dieser dann qualifiziert elektronisch signieren muss, allerdings nur dann versenden, wenn ihnen dieses Recht ausdrücklich zugeordnet wurde (vgl. https://www.bea-brak.de/xwiki/bin/view/BRAK/%2300084 „Erstellen und Senden einer Nachricht“ abgerufen am 29.7.2019); dies war hier ausweislich der eidesstattlichen Versicherung der Mitarbeiterin D … nicht der Fall. Dass auch eine Versendung durch die Beklagtenvertreterin selbst nicht möglich gewesen wäre, lässt sich ihrem Vortrag indes nicht entnehmen. War aber in der Kanzlei der Beklagtenvertreterin nur den dort tätigen Anwälten die Möglichkeit eingeräumt, Nachrichten aus dem beA zu versenden, hätte die Beklagtenvertreterin bei Verlassen der Kanzlei die Mitarbeiterin anweisen müssen, sie bei einem weiteren Scheitern der Übermittlung umgehend zu kontaktieren, um sodann eine Versendung über das beA sicherzustellen. In dem Unterlassen einer solchen Einzelanweisung liegt ein Anwaltsverschulden, das sich die Beklagte zurechnen lassen muss.“
55
■OLG Dresden, Beschl. v. 18.11.2019 – 4 U 2188/19
Der Prozessbevollmächtigte des Beklagten beantragte mit Schriftsätzen vom 21.10.2019 und vom 23.10.2019, die beide beim OLG Dresden am 24.10.2019 eingingen, Wiedereinsetzung in den vorherigen Stand gegen die Versäumung der Berufungsbegründungsfrist und Verlängerung der Berufungsbegründungsfrist um einen Monat. Zur Begründung des Wiedereinsetzungsantrages trug er vor, dass er am 21.10.2019 in der Zeit von 17.50 Uhr bis 20.24 Uhr mehrfach versucht habe, dem OLG Dresden ein Telefax mit dem Antrag auf Verlängerung der Berufungsbegründungsfrist zu übersenden.
Das OLG Dresden gewährte keine Wiedereinsetzung in den vorigen Stand, da der Beklagte nicht ohne Verschulden an der Einhaltung der Berufungsbegründung gehindert war. In den Gründen heißt es:
Dem Prozessbevollmächtigten des Beklagten […] „ist es […] grundsätzlich zumutbar, aus einer allgemein zugänglichen Quelle eine weitere Telefaxnummer des Gerichts in Erfahrung zu bringen und den Schriftsatz an dieses Empfangsgerät zu versenden […]. Gleiches muss für die Forderung gelten, im Anschluss an einen gescheiterten Telefax-Versand einen fristgebundenen Schriftsatz über das besondere elektronische Anwaltspostfach zu versenden. Alle Rechtsanwälte in Deutschland sind bereits seit dem 1.1.2018 grundsätzlich zu dessen passiver Nutzung gemäß § 31a Abs. 6 BRAO verpflichtet, so dass davon auszugehen ist, dass in allen Anwaltskanzleien auch ein entsprechender Zugang existiert. Regelmäßig ist mit erfolgreicher Anmeldung zum beA die Schaltfläche „Nachrichtenentwurf erstellen“ freigeschaltet und besteht damit grundsätzlich auch in technischer Sicht die Möglichkeit, aus dem beA heraus Nachrichten zu versenden (vgl. Senat, Beschl. v. 29.7.2019 – 4 U 879/19, juris). Dass in Sonderfällen eine aktive Nutzung des beA zumutbar ist, folgt auch daraus, dass bereits seit dem 1.1.2017 Schutzschriften über das besondere elektronische Anwaltspostfach versandt werden können und Rechtsanwälte standesrechtlich zur elektronischen Einreichung verpflichtet sind (§ 49c BRAO). Auch wenn derzeit – soweit ersichtlich – in keinem Bundesland eine darüber hinausgehende aktive Nutzungspflicht auf den nach dem Gesetz zur Einführung des elektronischen Rechtsverkehrs mit den Gerichten vom 10.10.2013 (BGBl I S. 3786) frühestmöglichen Zeitpunkt 1.1.2020 vorgezogen wurde, kann allein hieraus kein Anspruch eines Rechtsanwalts abgeleitet werden, vor dem 1.1.2022 die Versendung von Nachrichten über das Anwaltspostfach auch in Eilfällen ohne Grund verweigern zu dürfen. Vor diesem Hintergrund kann ein Rechtsanwalt nur dann nach einem gescheiterten Faxversuch eines fristgebundenen Schriftsatzes die Nutzung des beA verweigern, wenn er glaubhaft macht, dass eine elektronische Übermittlung aus dem beA heraus aufgrund technischer oder zwingender organisatorischer Einschränkungen ebenfalls nicht möglich ist. Einen solchen Hinderungsgrund hat der Prozessbevollmächtigte des Beklagten trotz ausdrücklichen Hinweises in der Senatsverfügung vom 28.10.2019 nicht glaubhaft gemacht. Aus der Verfahrensakte ergibt sich im Gegenteil, dass er von der Möglichkeit der aktiven Kommunikation mit den Gerichten im Verfahren zu verschiedenen Zeitpunkten Gebrauch gemacht hat. Warum ihm dies beim Versand der Berufungsbegründung bzw. des Fristverlängerungsantrages nicht möglich gewesen sein soll, hat er nicht dargelegt. Das Verschulden seines Prozessbevollmächtigten muss sich der Beklagten gemäß § 85 Abs. 2 ZPO zurechnen lassen.“
56
Hinweis:Es bleibt abzuwarten, ob sich weitere Gerichte der Rechtsaufassung des OLG Dresden anschließen. Aus Gründen der rechtsanwaltlichen Vorsicht, sollte bei technischen Problemen beim Faxversand eines Schriftsatzes an das Gericht dieser vor Fristablauf per beA an das Gericht gesandt werden.
II. Landesrechtsverordnungen nach Art. 24 Abs. 1 ERVGerFöG
57
BGH, Beschl. v. 11.7.2019 – AnwZ (Brfg) 74/18
Im Rahmen der Entscheidung über die Zulässigkeit des Zulassungsantrags des Klägers kam es darauf an, ob dieser in signierter Form über das besondere elektronische Anwaltspostfach (beA) formwirksam eingereicht werden konnte.
In seinem Beschluss führt der Bundesgerichtshof aus:
„Die Einreichung über das besondere elektronische Anwaltspostfach (beA) war gemäß § 112c Abs. 1 S. 1 BRAO, § 55a Abs. 1, 3 und 4 Nr. 2 VwGO in der Fassung durch Art. 5 Nr. 1 des Gesetzes zur Förderung des elektronischen Rechtsverkehrs mit den Gerichten (im Folgenden: ERVGerFöG) vom 10.10.2013 (BGBlI S. 3786), in Kraft getreten am 1.1.2018 (Art. 26 Abs. 1 ERVGerFöG), aufgrund vorrangigen Bundesrechts (Art. 31 GG) zulässig. Zwar waren die Länder durch Art. 24 Abs. 1 ERVGerFöG ermächtigt, durch Rechtsverordnung für ihren Bereich eine Fortgeltung des § 55a VwGO in der vorherigen Fassung bis Ende 2018 oder 2019 anzuordnen. Von dieser Möglichkeit hat das Land Niedersachsen jedoch keinen Gebrauch gemacht. Die Tatsache, dass das Land Niedersachsen seine Verordnung über den elektronischen Rechtsverkehr in der Justiz vom 21.10.2011 (Nds. ERVVO-Justiz, Nds. GVBl. S. 367), zuletzt geändert durch Verordnung vom 11.11.2015 (Nds. GVBl. S. 335), die auf § 55a VwGO in der alten Fassung beruhte und durch die der elektronische Rechtsverkehr nur mit enumerativ aufgezählten Gerichten zugelassen wurde, nicht aufgehoben hat, steht dem Erlass einer solchen Rechtsverordnung nach Art. 24 Abs. 1 ERVGerFöG nicht gleich und wurde seitens des Landes auch nicht in diesem Sinne verstanden. Vielmehr geht das Land selbst davon aus (https://www.mj.niedersachsen.de/themen/elektronische_justiz_niedersachen_ejuni/mjelektronischer_rechtsverkehr/elektronischer-rechtsverkehr-160547.html), dass im Bereich der Verwaltungsgerichtsordnung – und damit über § 112c Abs. 1 Satz 1 BRAO auch in verwaltungsrechtlichen Anwaltssachen- der elektronische Rechtsverkehr seit Jahresbeginn 2018 eröffnet ist und die landesrechtliche Verordnung nur noch auf bundesrechtlich nicht geregelte Verfahren Anwendung findet.“
Hinweis: Isabelle Désirée Biallaß ist Referentin im Ministerium der Justiz Nordrhein-Westfalen. Der Beitrag gibt ausschließlich ihre persönliche Auffassung wieder.


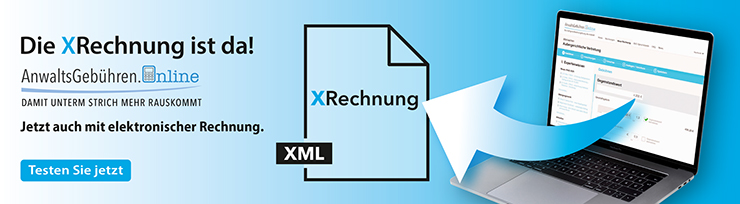

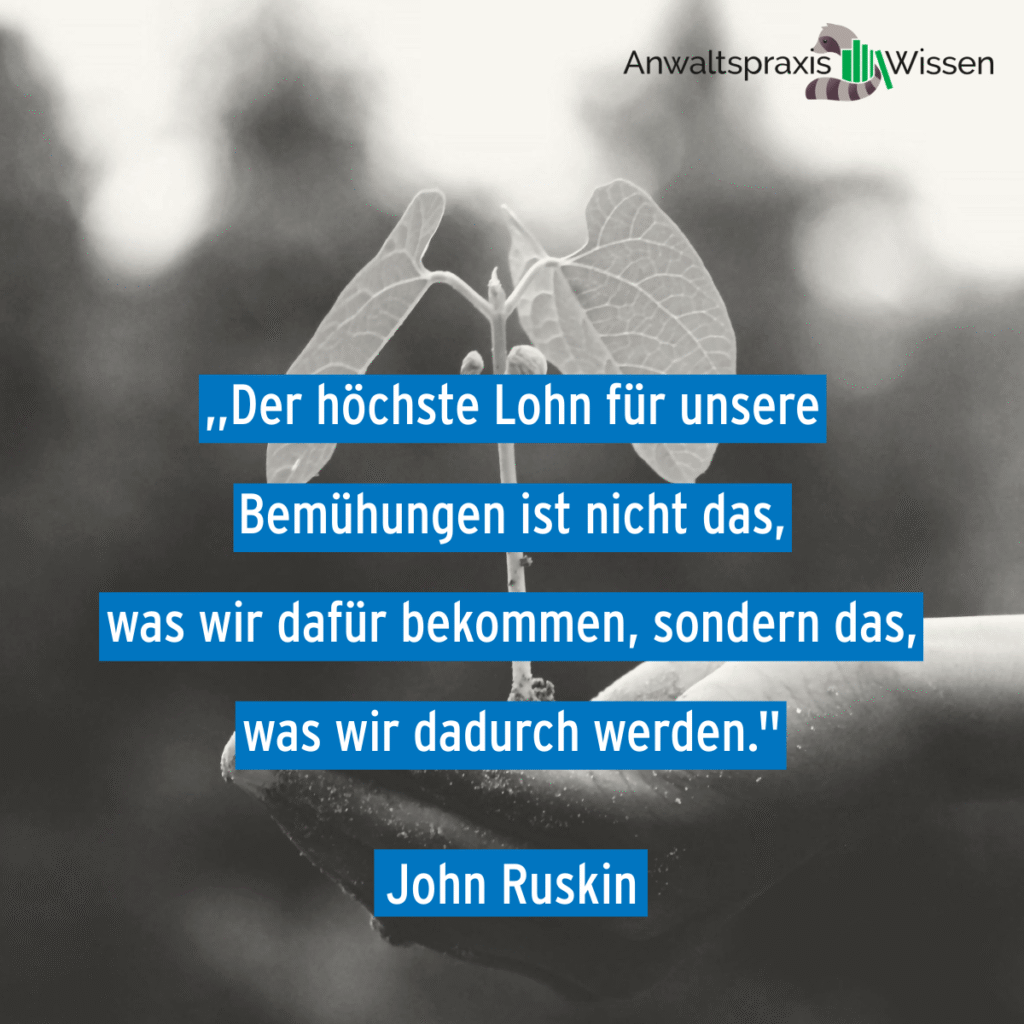

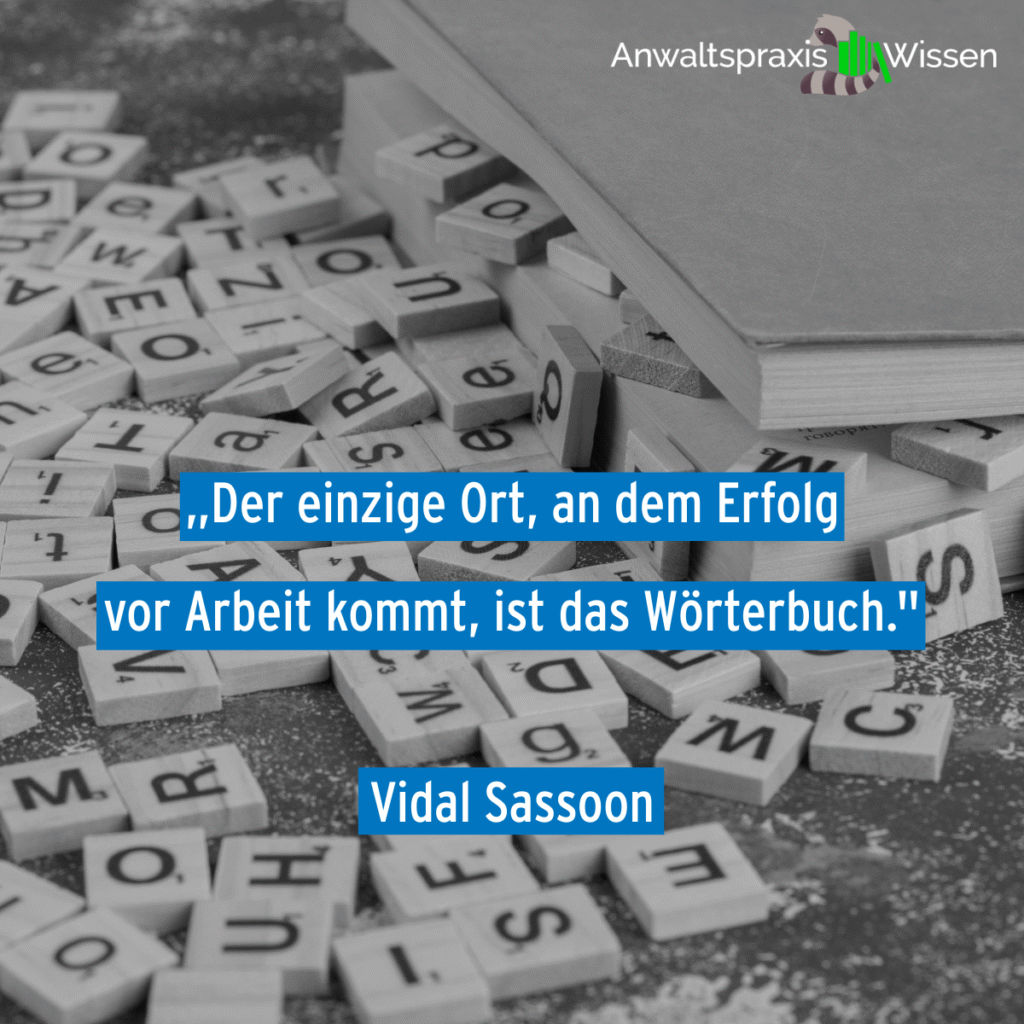
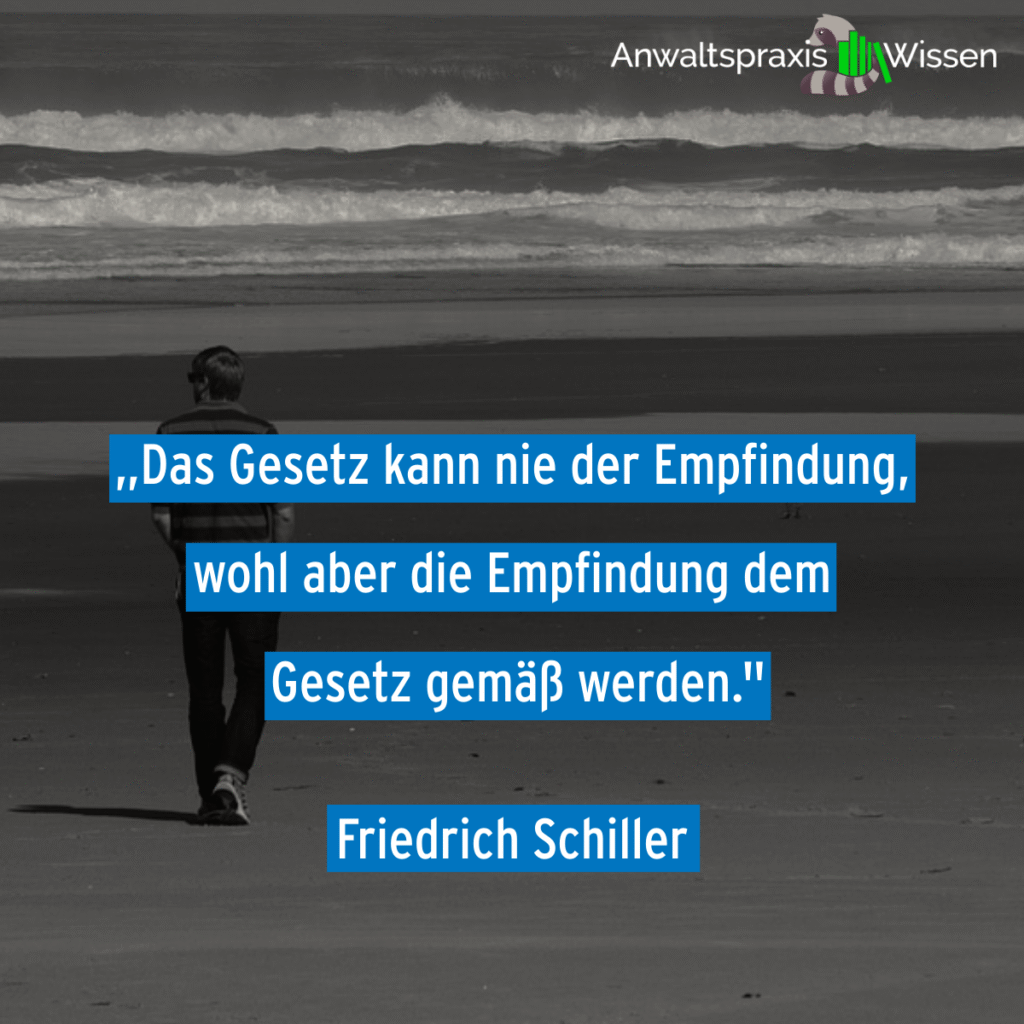
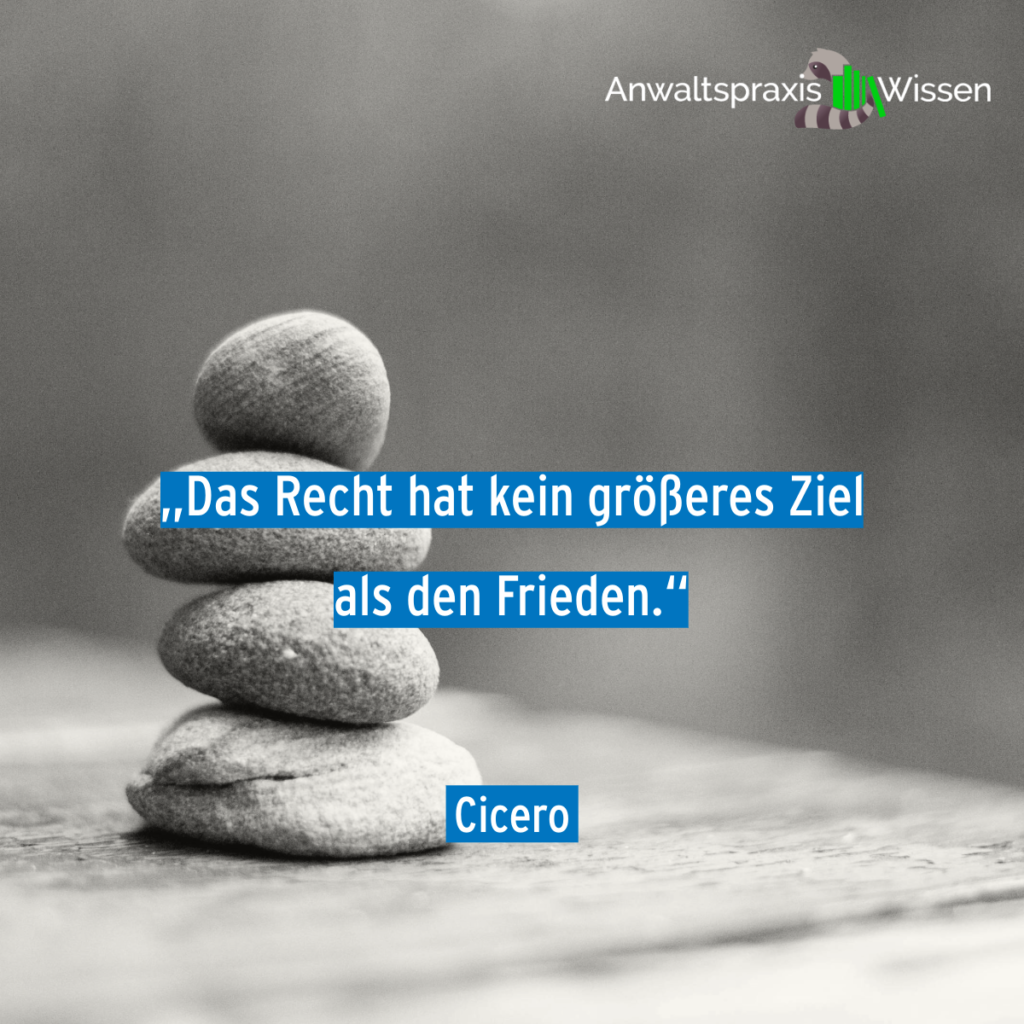

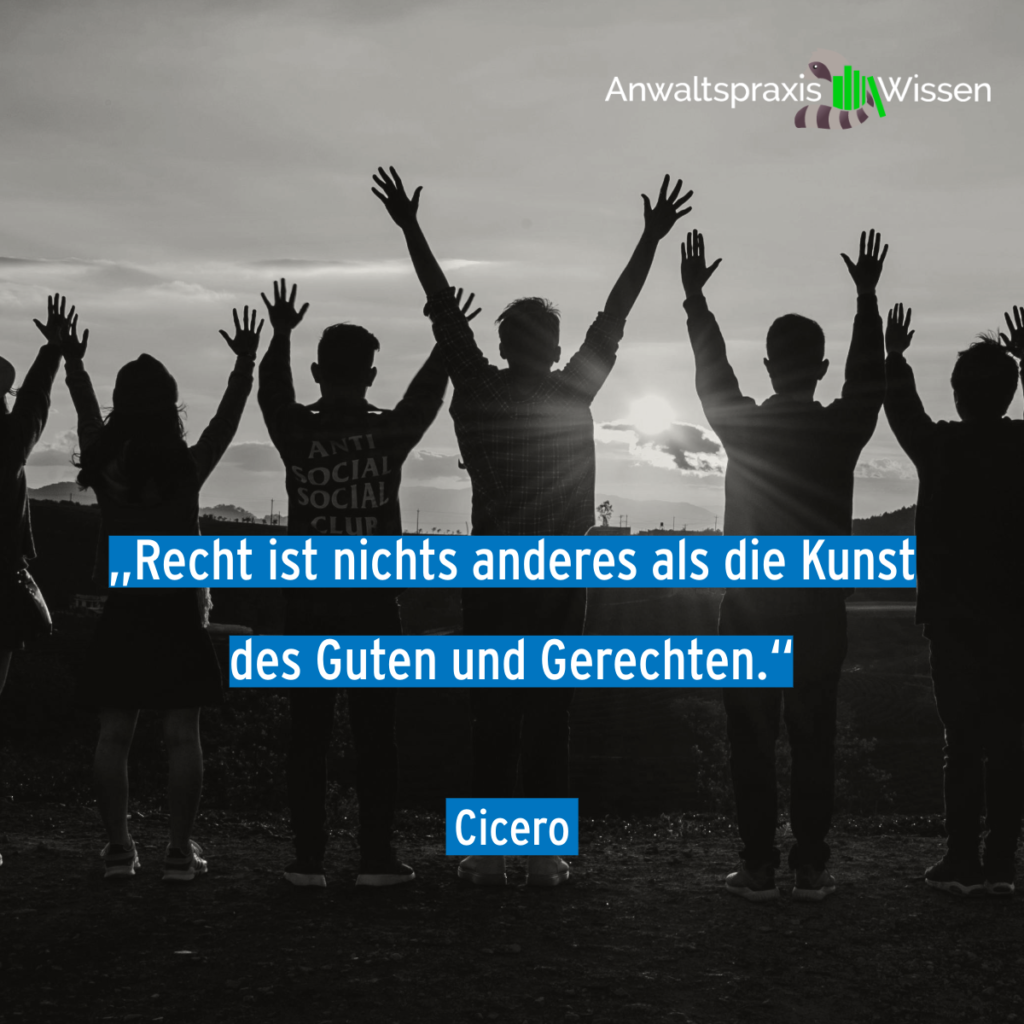
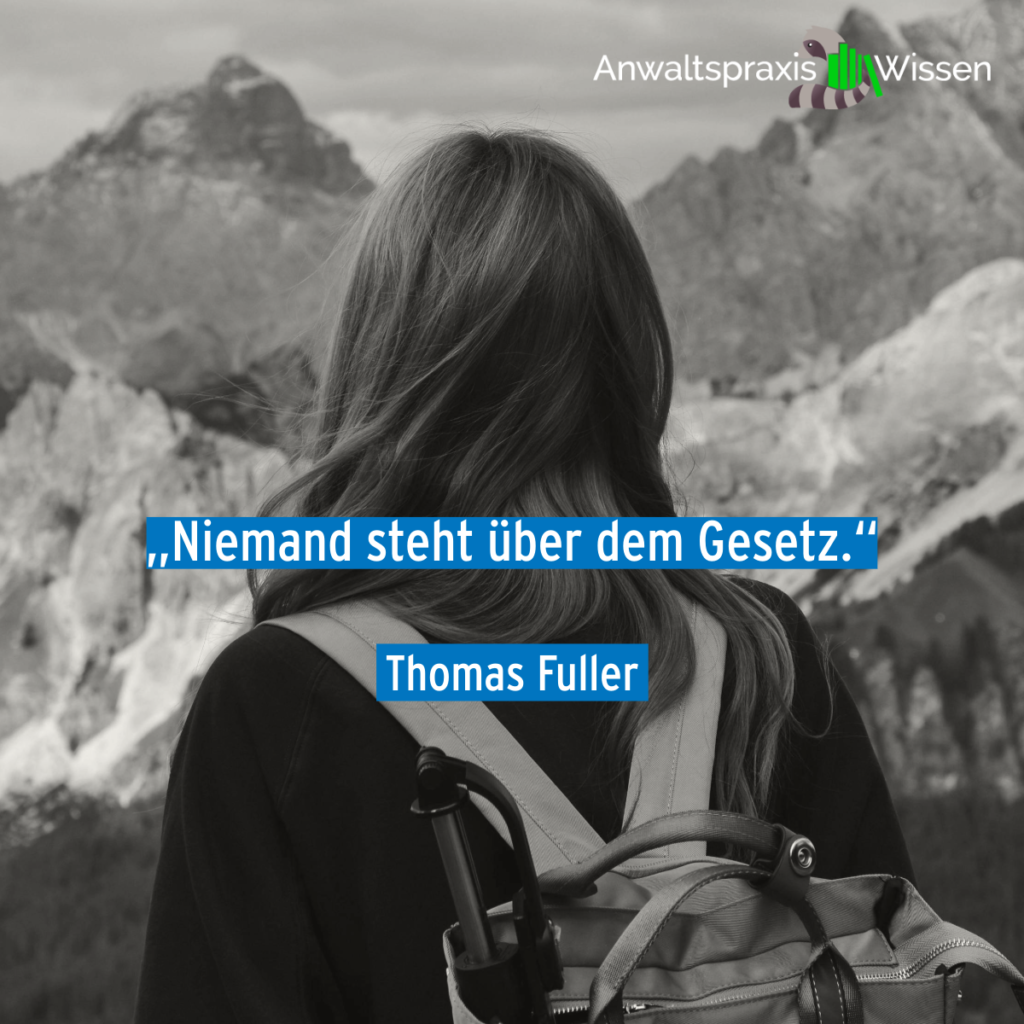
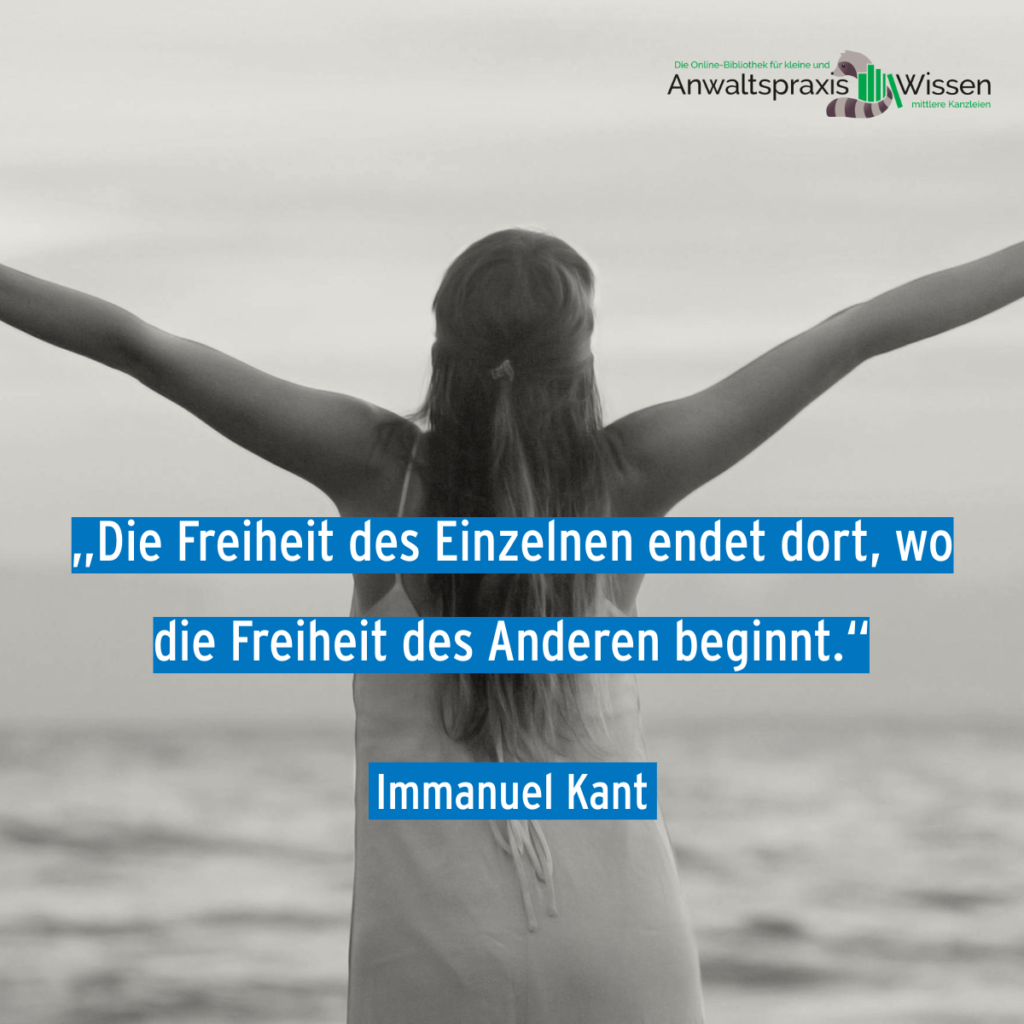
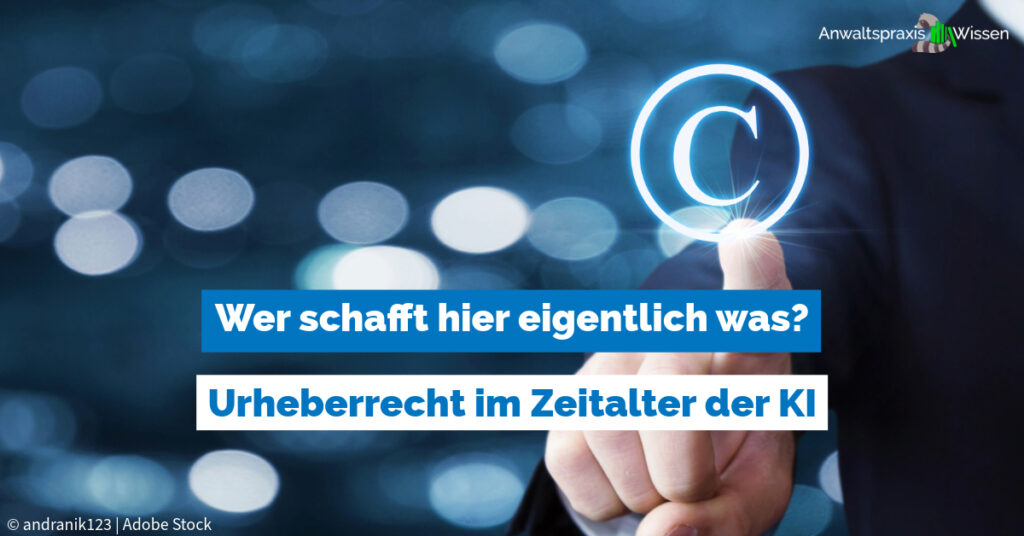

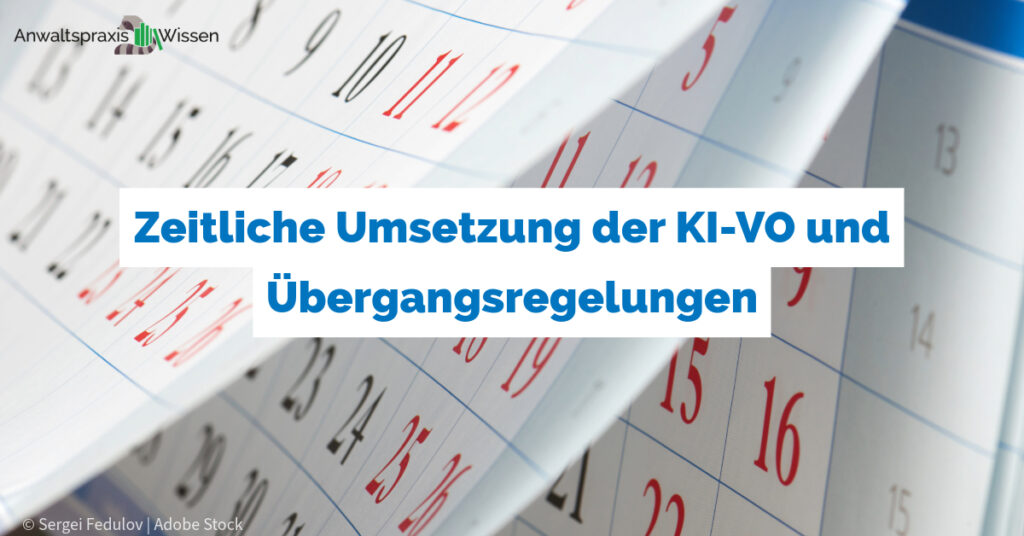




![Erbrecht im Gespräch: Kurze[s] Update: #15 Die Rechte des Erben vor dem Erbfall – mit Walter Krug](https://anwaltspraxis-magazin.de/wp-content/uploads/2025/05/Erbrecht-im-Gespraech-15-1024x536.jpeg)

