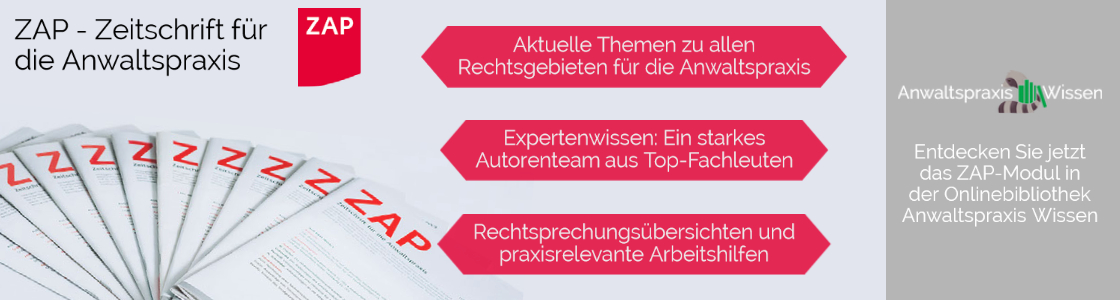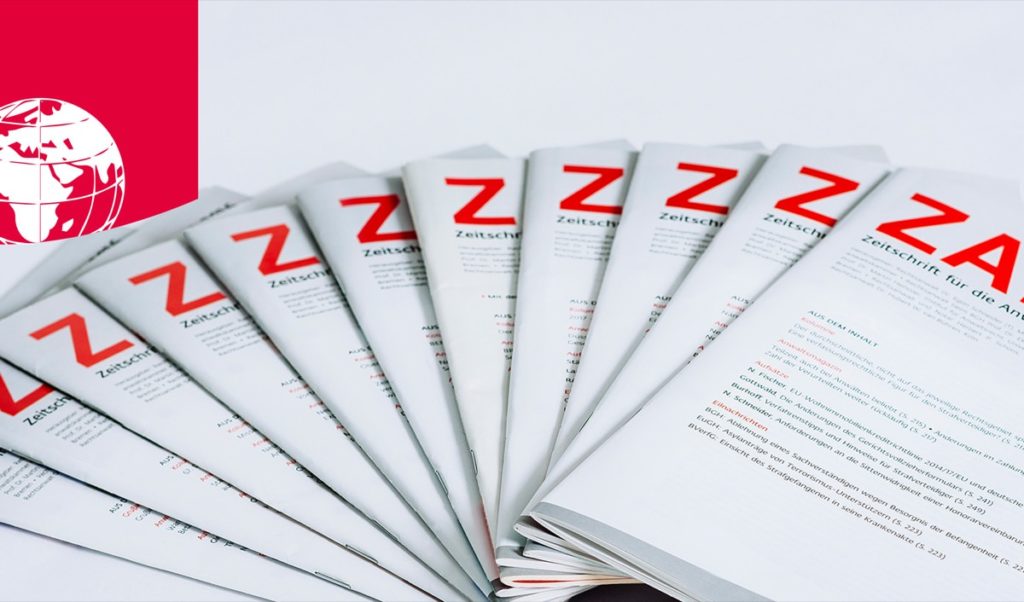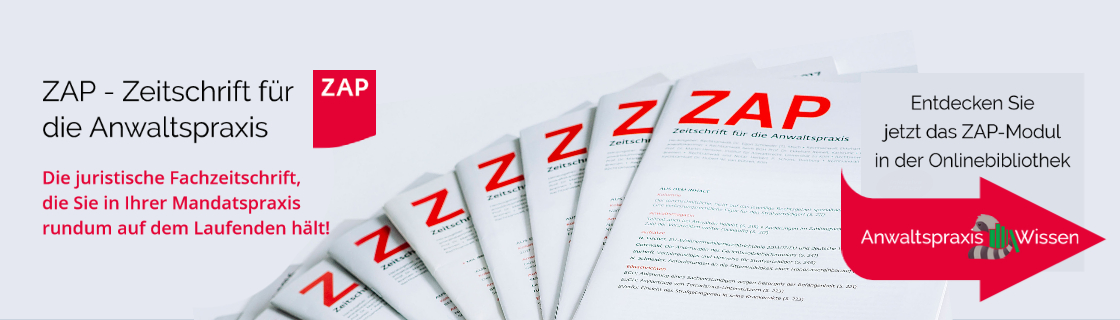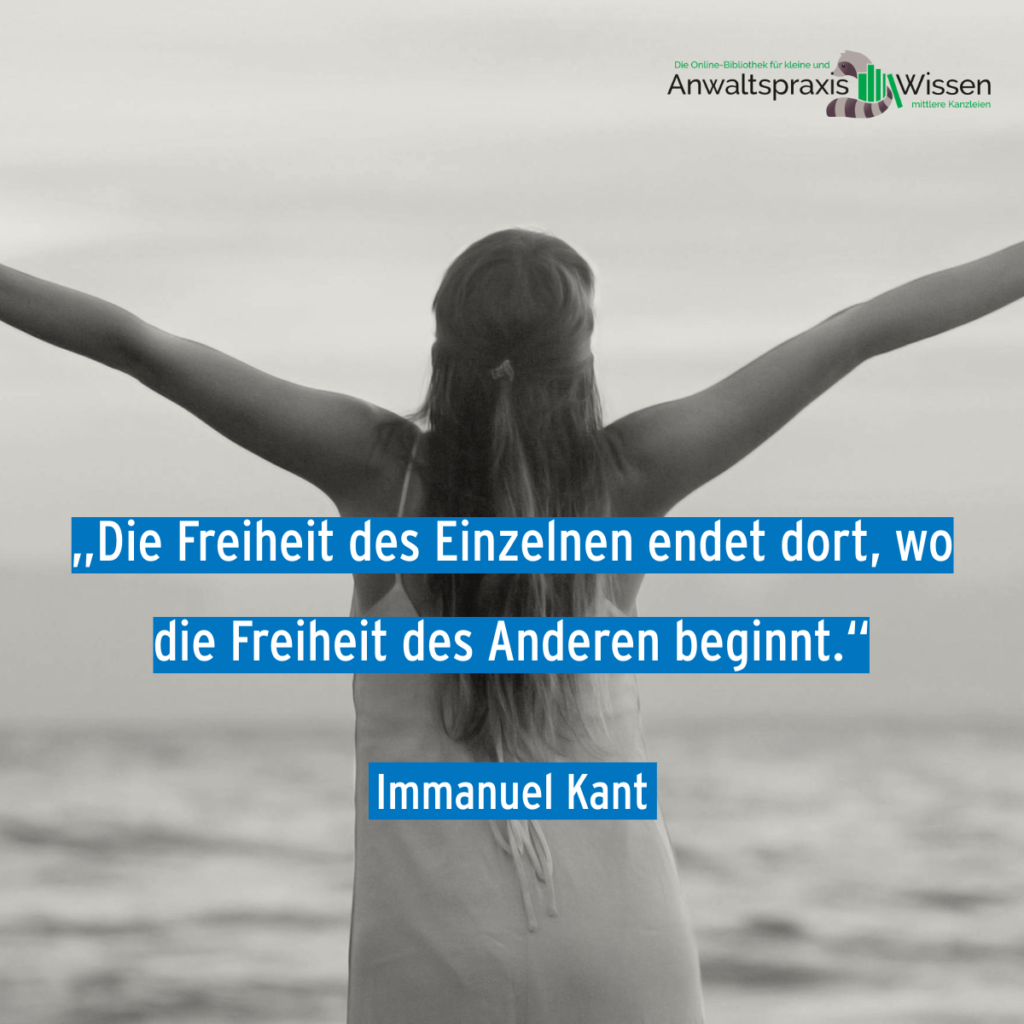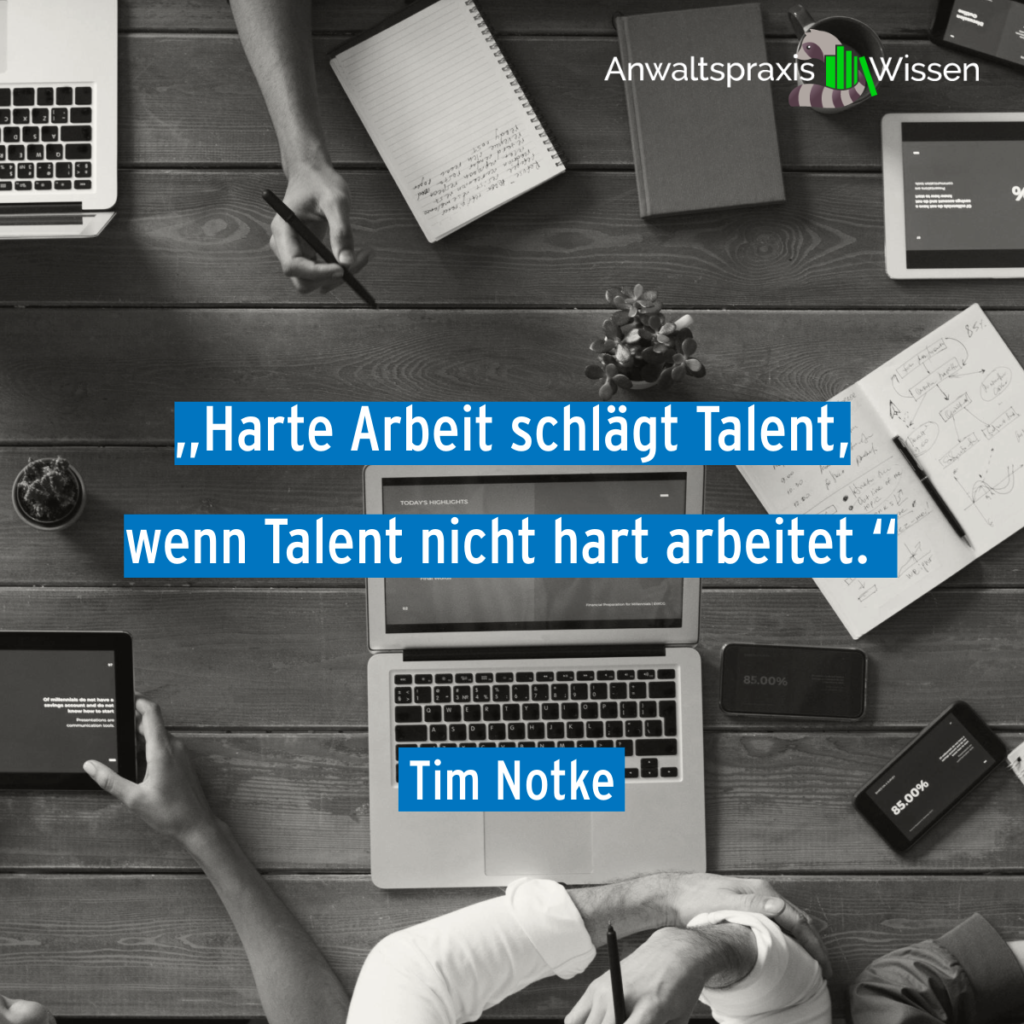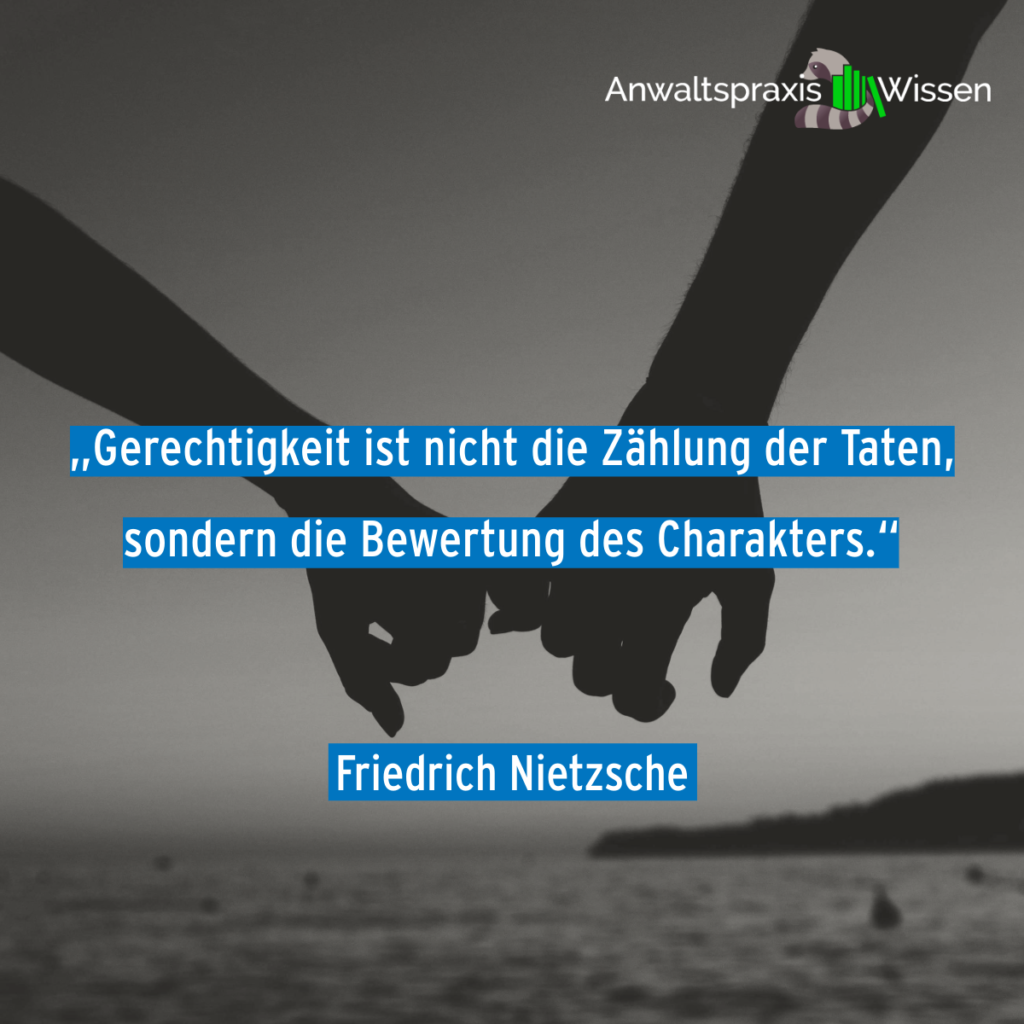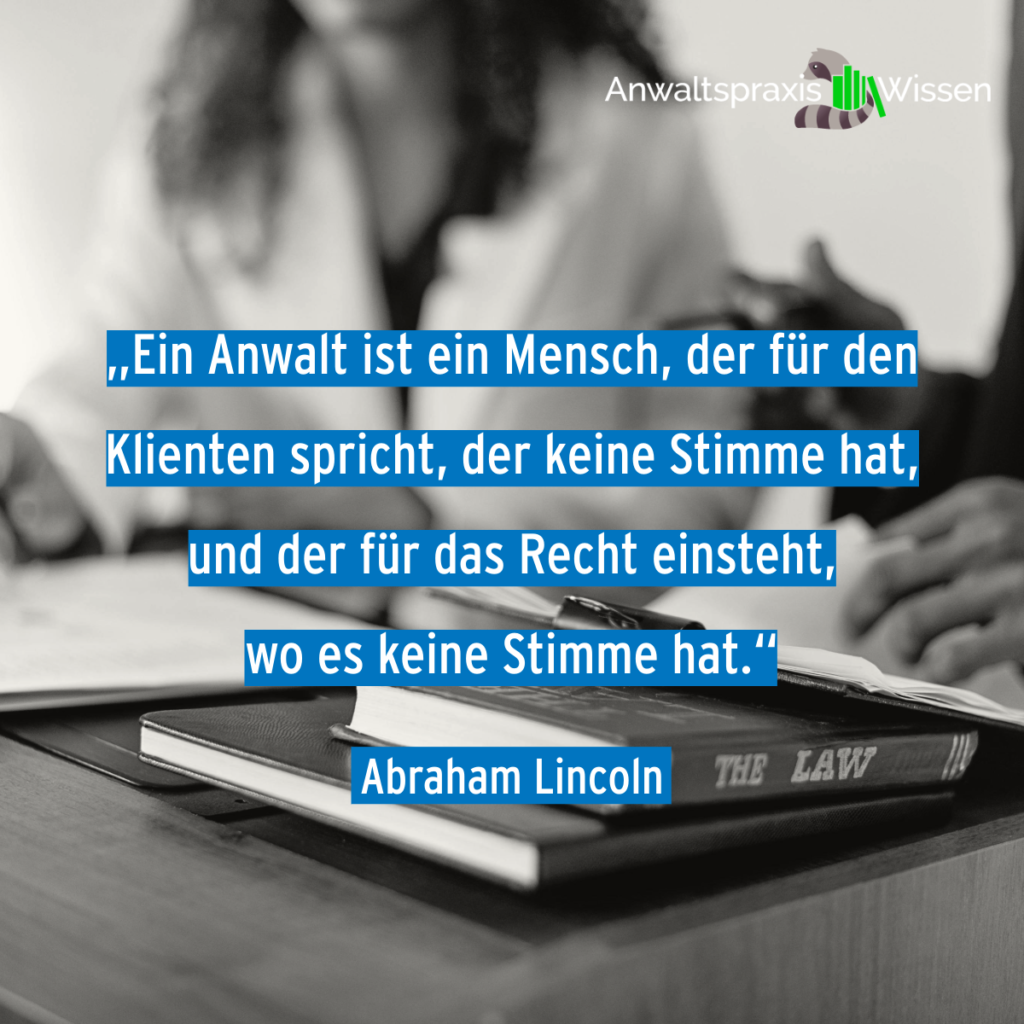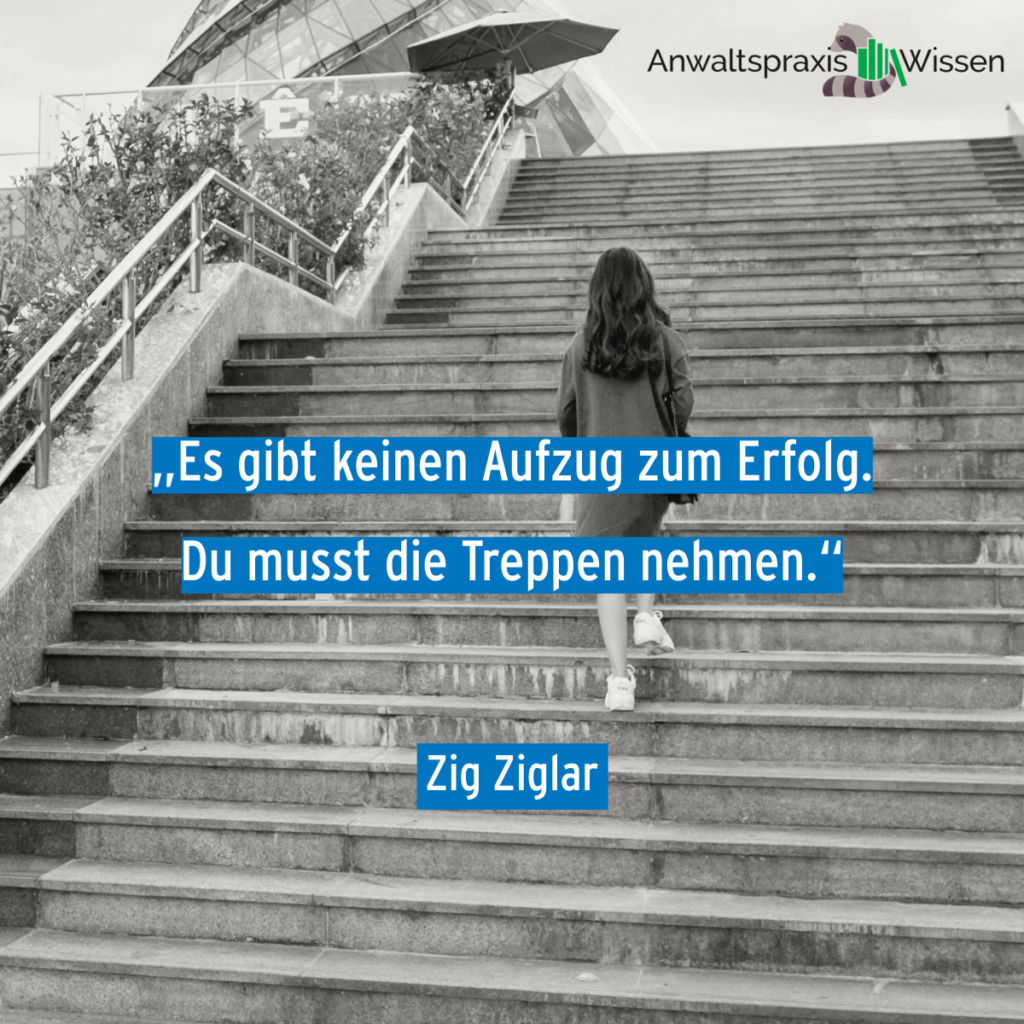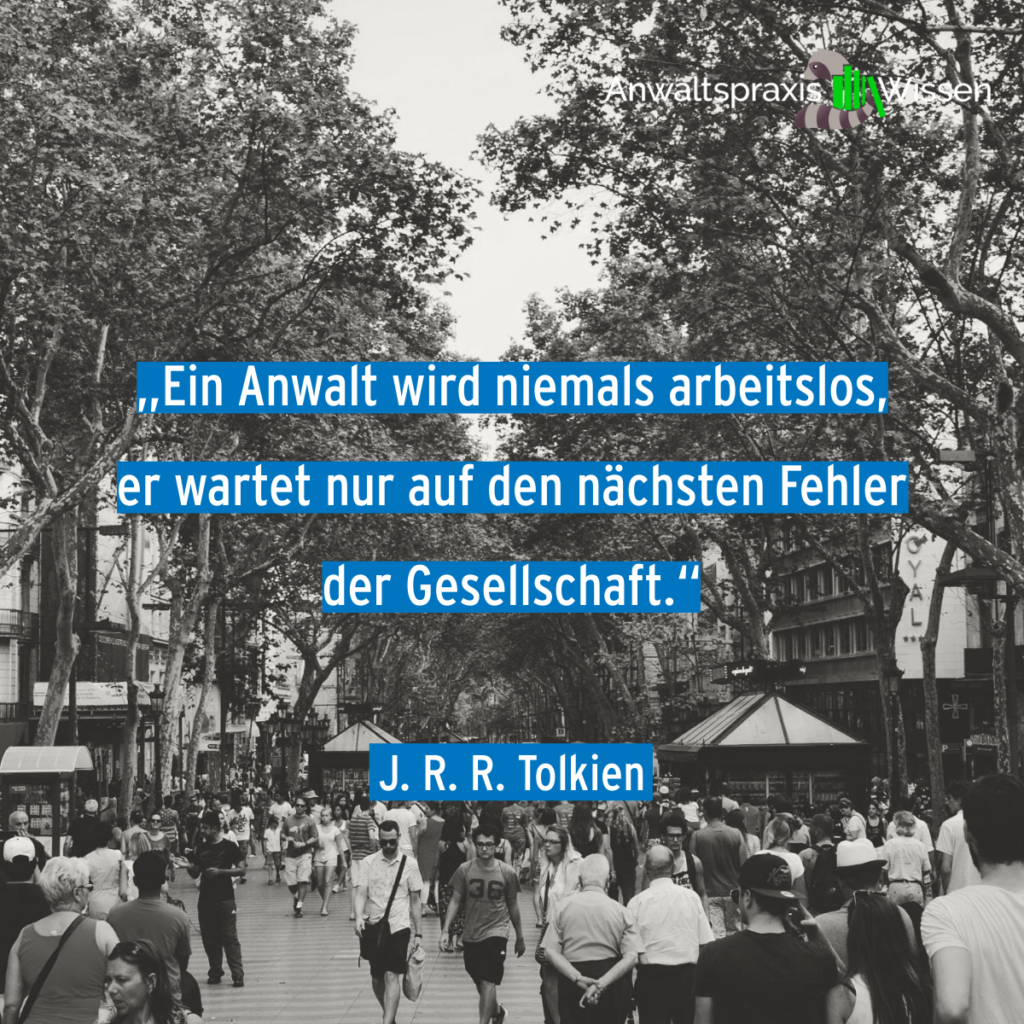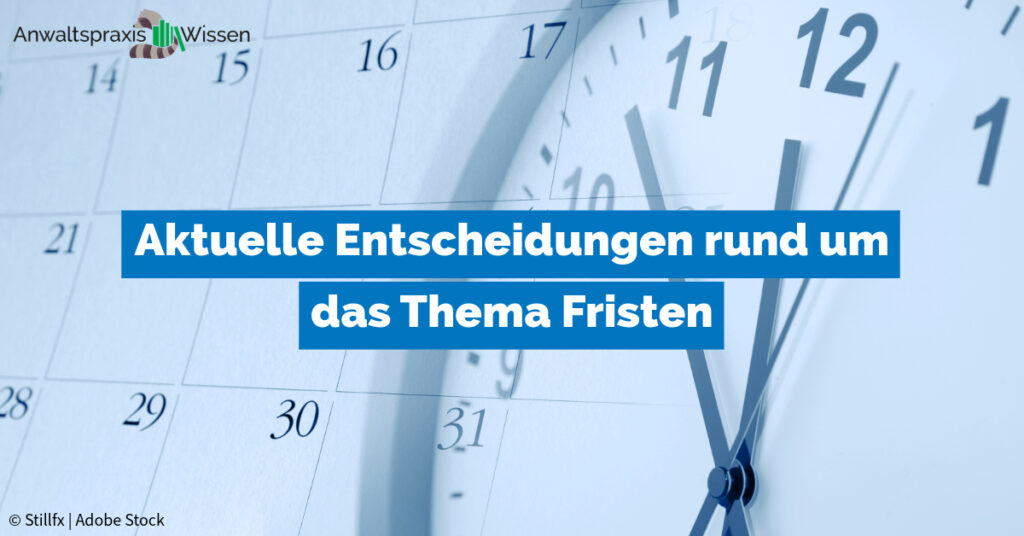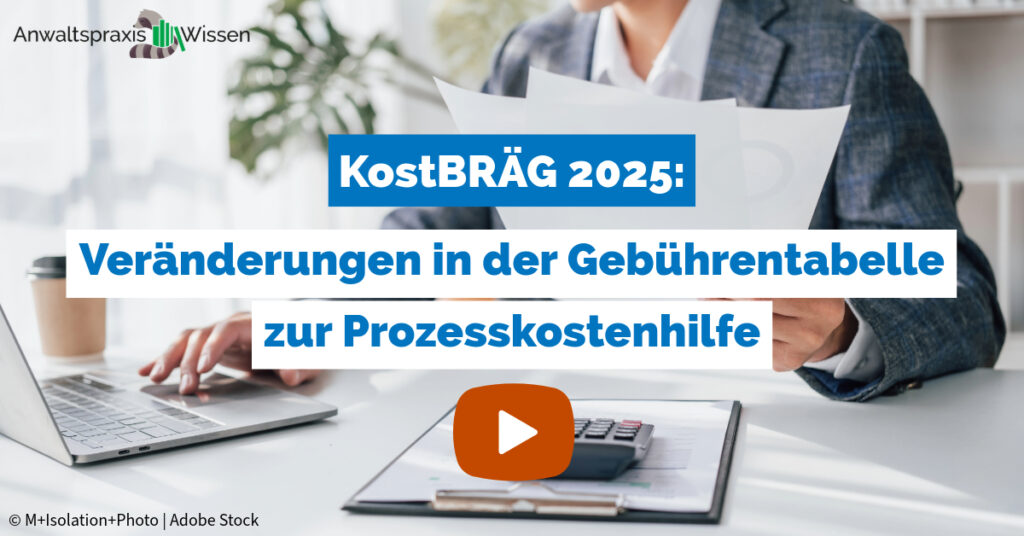Anfang April haben CDU/CSU und SPD den zwischen ihnen ausgehandelten Koalitionsvertrag veröffentlicht. Auf 146 Seiten legen die Vertragsparteien darin dar, was sie an gesetzgeberischen Maßnahmen für die aktuelle Legislaturperiode planen. Einen verhältnismäßig breiten Raum nehmen darin die Themen ein, die auch den Wahlkampf bestimmt haben: Wirtschaft, Sicherheit und Migration. Der Bereich „Recht“ macht im Koalitionspapier gerade einmal sechs Seiten aus; allerdings findet sich eine Reihe rechtspolitischer Vorhaben auch in anderen Kapiteln des Vertrags, etwa unter den Stichworten „Leistungsfähiger Staat“, „Innen“ oder „Familien“.
Aus Sicht der Rechtsanwaltschaft finden sich im Vertrag viele Punkte wieder, die in den letzten Wochen und Monaten auch in Forderungs- und Positionspapieren von BRAK und DAV standen. Etliche Anliegen der Anwaltschaft sind jedoch unerwähnt geblieben, etwa die Dokumentation der Hauptverhandlung im Strafprozessrecht, die Reform des Abstammungsrechts im Familienrecht, Änderungen im anwaltlichen Berufsrecht einschließlich einer Verstetigung der Gebührenanpassung sowie auch die lange angemahnte Reform der Juristenausbildung; bei allen diesen Punkten ist daher unklar, ob sie überhaupt noch auf der Agenda der Politiker stehen. Bei einigen der angekündigten Reformen müssen sich Rechtsanwälte und ihre Mandanten zudem auf Überraschungen einstellen, etwa was die Beschneidung von Rechtsmitteln angeht. Im Folgenden werden die aus Anwaltssicht interessanten rechtspolitischen Vorhaben der neuen Koalition zusammengefasst.
-
Verwaltung und Justiz
Den kürzlich veröffentlichten Appell der „Initiative für einen handlungsfähigen Staat“ (s. dazu auch ZAP 2025, 315) haben die Rechtspolitiker von CDU/CSU und SPD zweifelsfrei vernommen; dies geht eindeutig aus dem Koalitionsvertrag hervor, der davon spricht, dass er die Vorschläge aufgreifen will. Bereits im laufenden Jahr soll eine „ambitionierte Modernisierungsagenda für Staat und Verwaltung“ erarbeitet werden, mit dem Ziel, staatliche Entscheidungen, Prozesse und Strukturen zu verschlanken und zu erneuern. Im Mittelpunkt soll eine „digitale Verwaltung mit antragslosen Verfahren“ stehen, die die Anträge und Ansprüche von Bürgern und Unternehmen online über eine zentrale Plattform abwickelt.
Modernisiert werden soll hierbei auch die Justiz, für die gemeinsam mit den Ländern „ein neuer Pakt für den Rechtsstaat“ geschlossen werden soll. Medienbrüche sollen in der neuen, digital aufgestellten Justiz der Vergangenheit angehören – so sollen z.B. aus den Gerichten die „klassischen Akten“ verschwinden. Eine Bundesjustizcloud soll ebenso kommen wie ein Justizportal mit digitaler Rechtsantragsstelle für Bürger und Unternehmen, einem Vollstreckungsregister sowie weiteren Dienstleistungen. Offenbar in mehreren oder sogar allen Gerichtszweigen soll die Verfahrensdauer verkürzt werden, indem die Möglichkeiten der richterlichen Verfahrensstrukturierung ausgebaut und Präklusionsfristen verschärft werden. Zudem will die neue Koalition – ohne nähere Konkretisierung im Vertrag – „den Zugang zur zweiten Tatsacheninstanz begrenzen“.
In der Zivilgerichtsbarkeit sollen die Amtsgerichte durch eine „deutliche Erhöhung des Zuständigkeitsstreitwertes“ gestärkt werden; ob mit diesem Punkt die von der Ampel-Koalition bereits geplante, zuletzt aber der Diskontinuität anheimgefallene 8.000-€-Streitwertgrenze gemeint ist, wird im Koalitionspapier nicht weiter erläutert. Auch sollen die Rechtsmittelstreitwerte – offenbar generell – erhöht werden.
-
Zivil- und Wirtschaftsrecht
Während die angekündigten Änderungen bei den staatlichen Strukturen und im Verfahrensrecht eher unscharf und teils wolkig anmuten, sind die geplanten Neuerungen im Zivilrecht überraschend kleinteilig zu Papier gebracht worden. Hier gibt es insb. im Bereich des Vertragsrechts und des Wirtschaftsrechts eine Reihe konkreter Projekte, die der künftige Gesetzgeber angehen will. So soll es künftig u.a. eine „generelle Bestätigungslösung“ für telefonisch angebahnte Dauerschuldverhältnisse geben. Schriftformerfordernisse sollen weiter abgebaut werden, insb. im Arbeitsvertragsrecht. Auf dem Gebiet des Mietvertragsrechts werden zum einen die Mietpreisbremse um weitere vier Jahre verlängert und zum anderen Indexmieten stärker reguliert. Besucher von Sport- und Kulturveranstaltungen sollen besser auf dem sog. Ticketzweitmarkt geschützt sein. Entschädigungs- und Ausgleichszahlungen – etwa bei Buchung über eine App – sollen beschleunigt und vereinfacht werden. Immobilienkäufer werden nach dem Willen der neuen Koalition demnächst besser vor der Insolvenz des Bauträgers geschützt sein. Wohngebäudeversicherungen dürfen in Zukunft nur noch zusammen mit einer Elementarschadensversicherung angeboten werden. Nicht zuletzt soll das AGG nachgeschärft werden, um Diskriminierungen besser als bisher entgegenzuwirken.
Im Bereich des Wirtschaftsrechts steht die Reform des aktienrechtlichen Beschlussmängelrechts ganz oben auf der Liste. Modernisiert werden soll aber auch das Genossenschaftsrecht, zudem wird eine neue Rechtsform der „Gesellschaft mit gebundenem Vermögen“ eingeführt. Im Urheberrecht streben die Koalitionäre vor allem eine fairere Vergütung der Kreativen an, u.a. beim Einsatz von generativer KI und bei Verwertung von Inhalten über Streaming-Plattformen.
Bei den Projekten zum Familienrecht wird der Koalitionsvertrag wieder deutlich einsilbiger: Welche der vielen Vorarbeiten aus den vergangenen Jahren (s. dazu auch ZAP 2025, 317 und 364) aufgegriffen werden sollen, sagt das Papier nicht, lediglich dass man sich „bei Reformen des Familienrechts und Familienverfahrensrechts […] vom Wohl des Kindes leiten“ lassen will. Immerhin: Im Unterhaltsrecht soll es eine stärkere Verzahnung mit dem Steuer- und dem Sozialrecht geben, das Namensrecht soll neu strukturiert werden und Gewalt gegen Frauen und Kinder soll stärker als bisher Berücksichtigung finden. Auch gegen missbräuchliche Vaterschaftsanerkennungen soll verschärft vorgegangen werden.
-
Strafrecht
Einen verhältnismäßig breiten Raum im Koalitionsvertrag nehmen die Pläne zur Sicherheit ein. Hier wollen CDU/CSU und SPD den „multiplen Bedrohungen von außen und im Innern mit einer Zeitenwende“ begegnen. Dazu zählen vor allem erweiterte Befugnisse der Ermittlungsbehörden, aber auch punktuelle Verschärfungen im Strafrecht. Eine europa- und verfassungsrechtskonforme dreimonatige Speicherpflicht für IP-Adressen soll ebenso kommen wie eine Quellen-TKÜ für die Bundespolizei. Im „verfassungsrechtlich zulässigen Rahmen“ wird den Ermittlern künftig der biometrische Abgleich mit öffentlich zugänglichen Internetdaten erlaubt, wobei auch KI eingesetzt werden darf. Im Straßenverkehr sollen automatisierte Kennzeichenlesesysteme eingeführt werden. Das Waffenrecht wird nach dem Willen der Koalitionäre bereits bis 2026 verschärft; Ziel ist es vor allem, Extremisten und psychisch Erkrankten den legalen Waffenbesitz zu verweigern.
Im Strafrecht steht u.a. ein verbesserter Schutz von Einsatz- und Rettungskräften, Polizisten, Angehörigen der Gesundheitsberufe und Kommunalpolitikern weit oben auf der Agenda. Schutzlücken hat die neue Koalition auch im Cyberstrafrecht ausgemacht, etwa bei sog. Deep-Fakes. Bei mehrfacher Verurteilung wegen Volksverhetzung soll der Entzug des passiven Wahlrechts ermöglicht werden; diese Verschärfung ist in letzter Zeit auch unter dem Stichwort „Lex Höcke“ heiß diskutiert worden.
Der Deutsche Anwaltverein hat zu dem Koalitionsvertrag bereits ein gemischtes Fazit gezogen: Zwar werde von der neuen Koalition tatsächlich eine modernere Justiz angestrebt; es würden an vielen Stellen allerdings auch Freiheiten und Rechtsschutzmöglichkeiten geopfert.
[Red.]