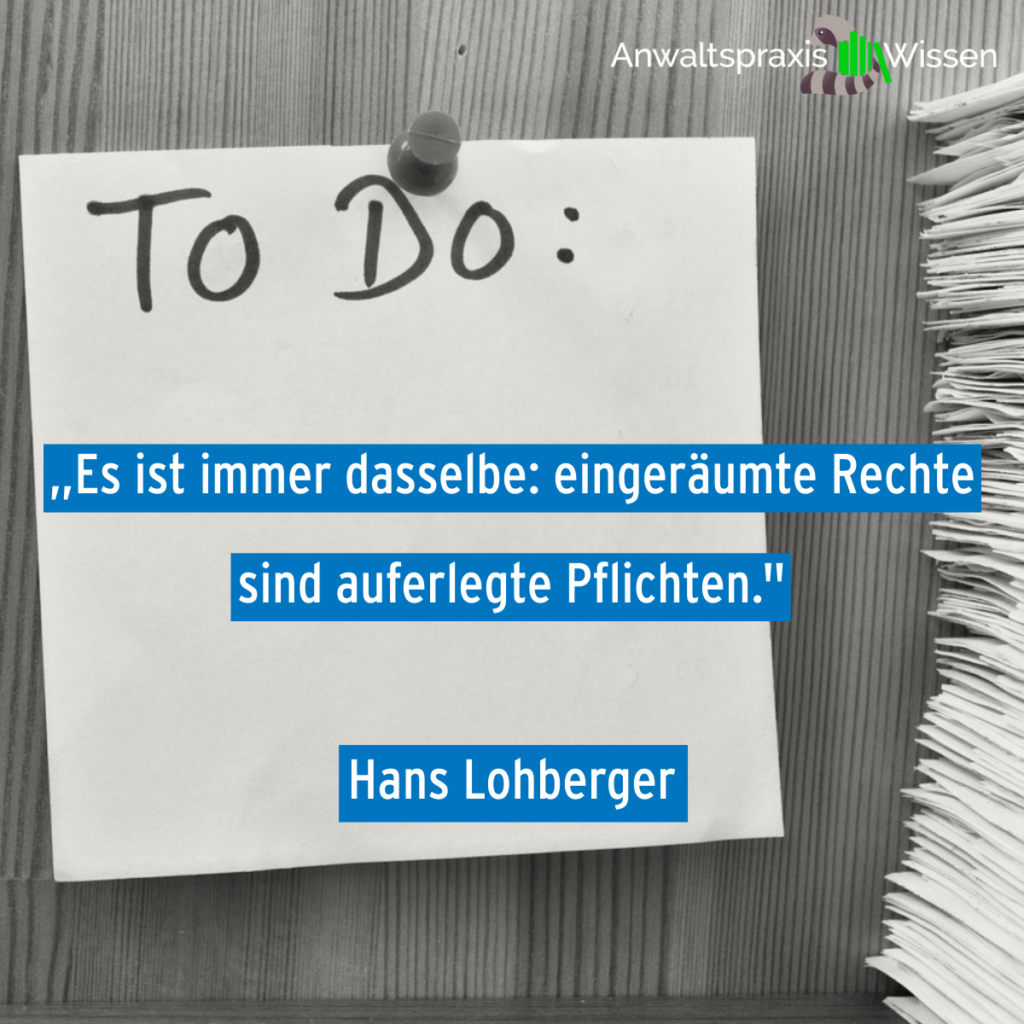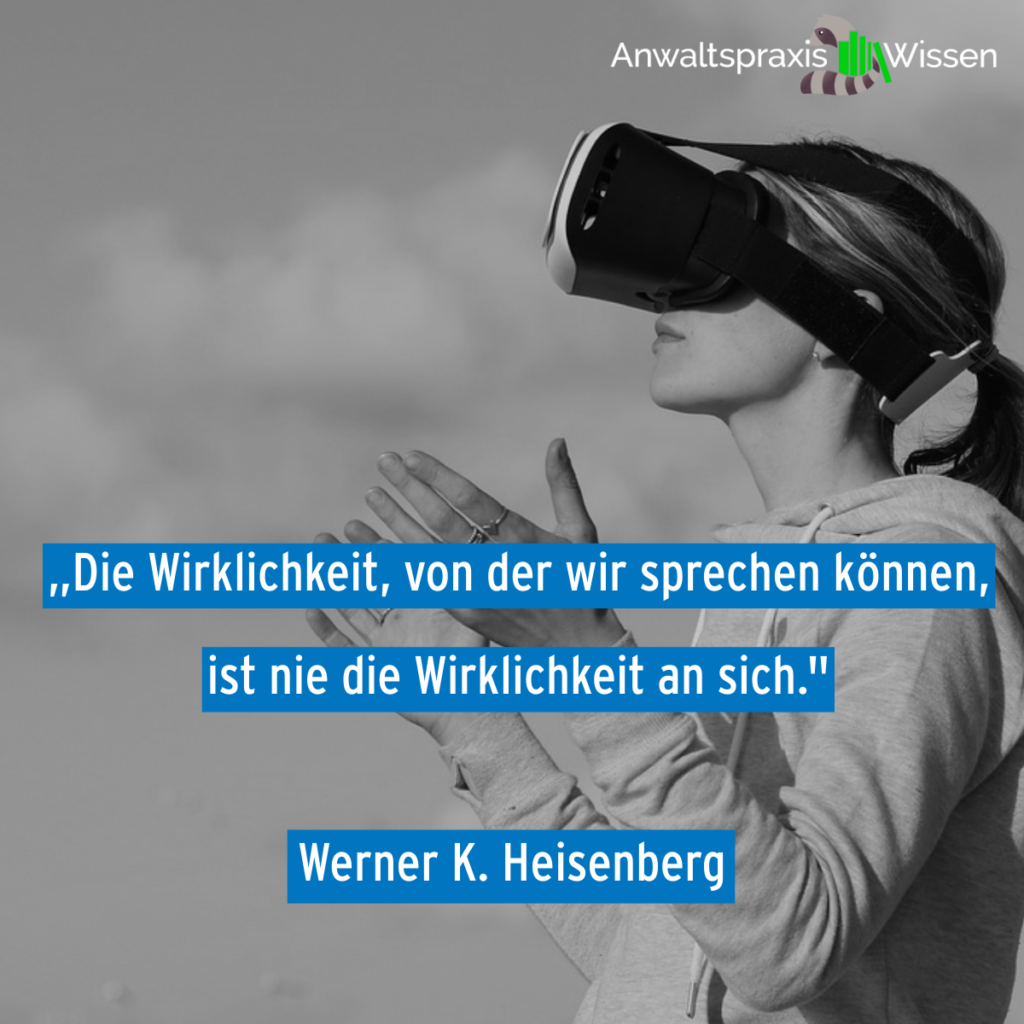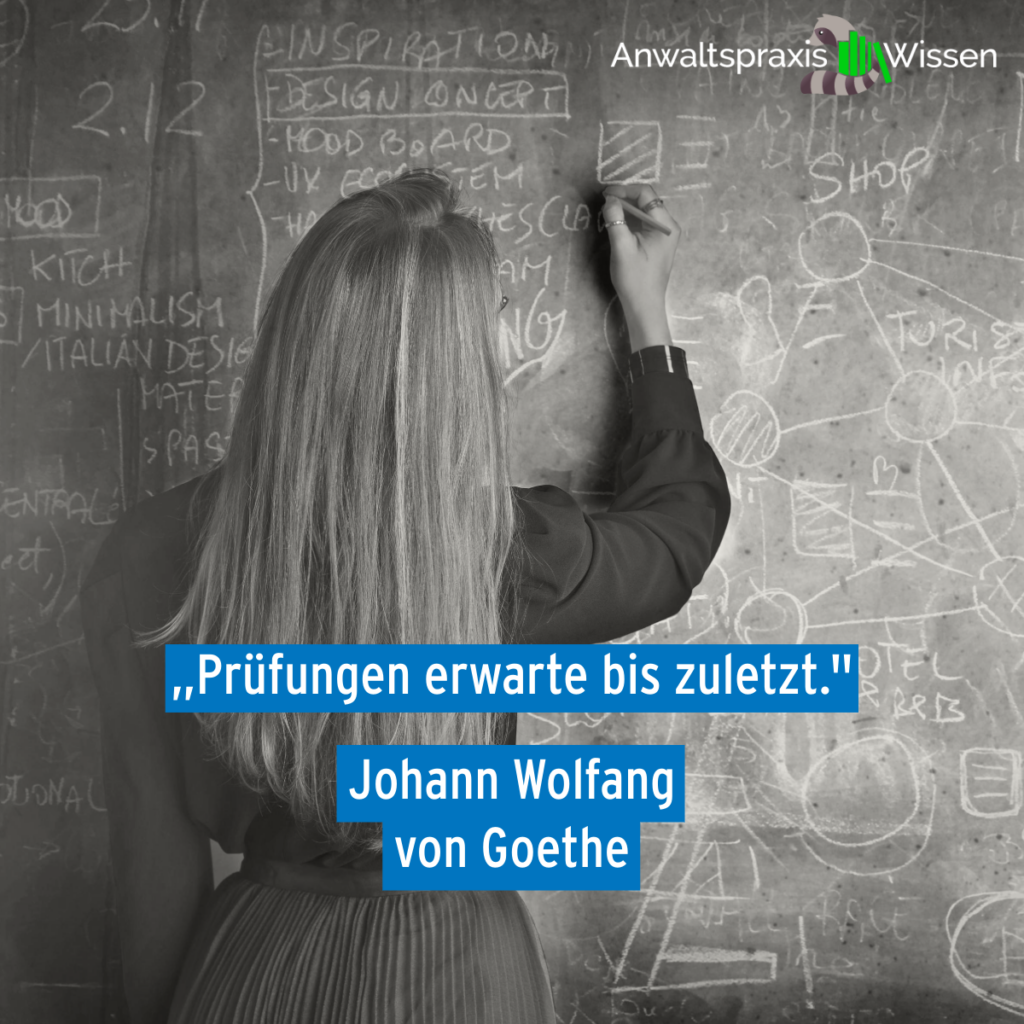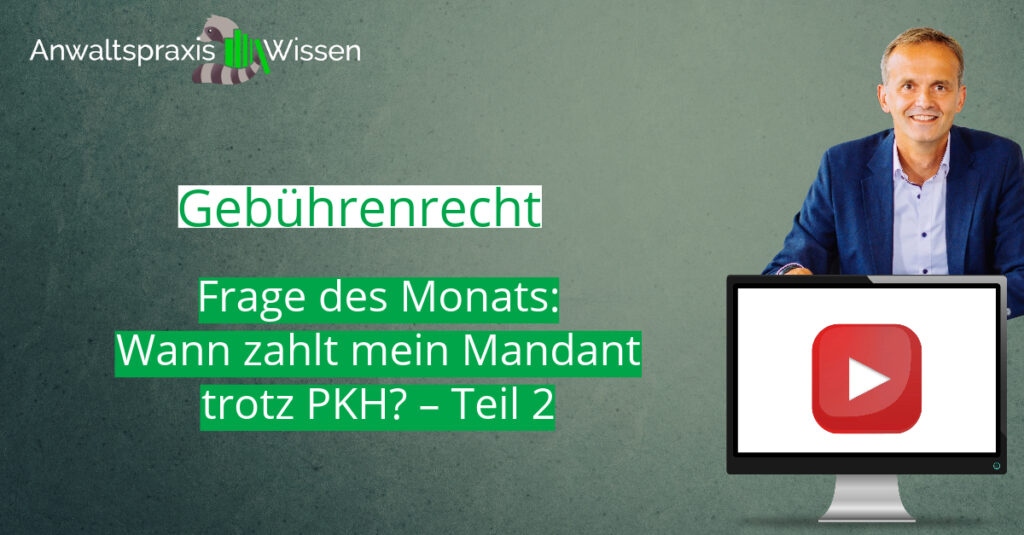Bundesrat billigt letzte Gesetzgebungsvorhaben der Legislaturperiode
Am 17. September hat der Bundesrat in seiner 1008. Sitzung – der letzten vor der Bundestagswahl – noch einige Gesetzgebungsvorhaben in dieser Legislaturperiode behandelt. Auf seiner Agenda standen insgesamt 56 Tagesordnungspunkte, darunter auch eine Reihe wichtiger rechtspolitischer Vorhaben. Die wohl bedeutendsten aus anwaltlicher Sicht betreffen die Digitalisierung der Justiz, die Erhöhung der Gerichtsvollziehergebühren und die Möglichkeit der Wiederaufnahme nach rechtskräftigem Freispruch im Strafverfahren. Daneben hatte sich die Länderkammer u.a. auch mit Nebeneinkünften von Abgeordneten und dem Werbeverbot für Abtreibungen zu beschäftigen. Im Einzelnen:
- Digitalisierung der JustizBürgerinnen und Bürger, Verbände, Organisationen und Unternehmen sollen künftig einfacher elektronisch, medienbruchfrei, kostenneutral und sicher mit den Gerichtsbehörden kommunizieren können. Das Gesetz enthält eine Fülle von Änderungen der Prozessordnungen der verschiedenen Gerichtszweige. Zentrale Neuerung ist das sog. besondere elektronische Bürger- und Organisationenpostfach (eBO), das schriftformwahrend den Versand elektronischer Dokumente zu den Gerichten und von diesen zurück an die Postfachinhaber ermöglicht. Das hat auch Auswirkungen auf die Vollstreckung gerichtlicher Entscheidungen. Vorgesehen ist zudem, die nach dem Onlinezugangsgesetz zu errichtenden Nutzerkonten des Portalverbundes in die Kommunikation mit den Gerichten einzubinden. Das Gesetz soll – zumindest in Teilen – noch in diesem Jahr in Kraft treten.
- Erhöhung der GerichtsvollziehergebührenDer Bundesrat hat auch einer Erhöhung der Gerichtsvollziehergebühren um linear 10 % zugestimmt. In Kraft treten soll diese Neuerung noch im Laufe des Herbstes 2021.
- Wiederaufnahme nach rechtskräftigem FreispruchBei schwersten Straftaten ist es künftig möglich, einen Strafprozess noch einmal aufzurollen, auch wenn er zuvor mit einem Freispruch rechtskräftig abgeschlossen worden war. Der Bundesrat hat dieses Vorhaben der Regierungskoalition jetzt dadurch gebilligt, dass er – trotz heftiger Kritik von vielen Seiten – auf ein Vermittlungsverfahren verzichtet hat. Voraussetzung für die Wiederaufnahme ist, dass sich aus nachträglich verfügbaren Beweismitteln die hohe Wahrscheinlichkeit einer Verurteilung des oder der Freigesprochenen ergibt. Nach geltender Rechtslage ist die Wiederaufnahme zuungunsten einer rechtskräftig freigesprochenen Person ohne deren Geständnis nicht möglich, selbst wenn nachträglich neue Beweise oder Tatsachen vorliegen, die einen eindeutigen Nachweis der Täterschaft erlauben. Dies führe v.a. bei schwersten Straftaten wie Mord und Völkermord sowie Verbrechen gegen die Menschlichkeit zu unbefriedigenden Ergebnissen, heißt es in der Gesetzesbegründung. Neue belastende Informationen könnten insb. dann entstehen, wenn es nach dem Freispruch neue Untersuchungsmethoden gebe – wie dies bspw. seit den späten 1980er-Jahren mit der Analyse von DNA-Material der Fall gewesen oder es künftig auch durch die digitale Forensik zu erwarten sei. Ein weiterer Aspekt des Gesetzes betrifft die zivilrechtliche Verjährung: Zivilrechtliche Ansprüche der Opfer gegen Täter schwerster, nicht verjährbarer Verbrechen verjähren in Zukunft nicht mehr wie bisher nach 30 Jahren. Bezüglich dieser Regelung hat der Bundesrat die Regierung allerdings per „begleitender Beschließung“ gebeten, sie noch einmal zu überdenken; er begründete seine Bedenken mit dem Umstand, dass etwa trotz des Todes des Täters künftig die Erben unbegrenzt mit Ansprüchen der Opfer konfrontiert werden könnten. Insgesamt ist das Gesetzesvorhaben gegen heftige Kritik seitens vieler Verfassungsrechtler, Strafrechtler, beider Anwaltsverbände und sogar aus dem Bundesministerium der Justiz zustande gekommen. Der rheinland-pfälzische Justizminister Herbert Mertin bezeichnet es schlicht als verfassungswidrig; es sei die Gefahr eines „Dammbruchs“ gegeben. Viele Beobachter rechnen mit einer Anrufung des Bundesverfassungsgerichts.
- Transparenzregeln für BundestagsabgeordneteGrünes Licht hat die Länderkammer auch für Änderungen am Abgeordnetengesetz gegeben. Diese sollen Regelungslücken schließen, die insb. im Zuge der sog. Maskenaffäre zutage getreten sind. Anzeigepflichtige Einkünfte von Abgeordneten aus Nebentätigkeiten und Unternehmensbeteiligungen sind künftig betragsgenau zu veröffentlichen. Die Anzeigepflicht gilt, wenn die Einkünfte im Monat 1.000 € oder bei ganzjährigen Tätigkeiten im Kalenderjahr in der Summe den Betrag von 3.000 € übersteigen. Beteiligungen der Abgeordneten sowohl an Kapitalgesellschaften als auch an Personengesellschaften sind bereits ab 5 % statt wie bislang ab 25 % der Gesellschaftsanteile anzuzeigen und zu veröffentlichen. Erstmals erfassen die Regelungen auch indirekte Beteiligungen. Einkünfte aus anzeigepflichtigen Unternehmensbeteiligungen wie etwa Dividenden oder Gewinnausschüttungen werden ebenso anzeige- und veröffentlichungspflichtig. Gleiches gilt für die Einräumung von Optionen auf Gesellschaftsanteile, die als Gegenleistung für eine Tätigkeit gewährt werden. Schließlich verbietet das Gesetz auch bezahlte Lobbytätigkeit von Bundestagsabgeordneten sowie Honorare für Vorträge im Zusammenhang mit der parlamentarischen Tätigkeit. Bei Verstößen gegen diese Bestimmungen droht ein Ordnungsgeld. Das Gesetz beinhaltet überdies eine deutliche Verschärfung im Strafrecht: Die Tatbestände der Bestechlichkeit und Bestechung von Mandatsträgern in § 108e StGB sind künftig mit Freiheitsstrafe von einem Jahr bis zu zehn Jahren bedroht statt wie bislang mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe.
- Abtreibungs-WerbeverbotKeine Mehrheit im Bundesrat fand sich am 17. September allerdings für die Abschaffung des Werbeverbots für Abtreibungen, das derzeit in § 219a StGB enthalten ist und bereits zu einer Reihe entsprechender Verurteilungen von Ärzten geführt hat. Fünf Bundesländer hatten beantragt, ein Gesetz in den Bundestag einzubringen, um die Strafvorschrift, die ursprünglich aus dem Jahr 1933 stammt und 2019 verändert wurde, gänzlich zu streichen. Jedoch fand dieser Vorschlag nicht die erforderliche Mehrheit von 35 Stimmen und gilt damit als abgelehnt.
[Quelle: Bundesrat]