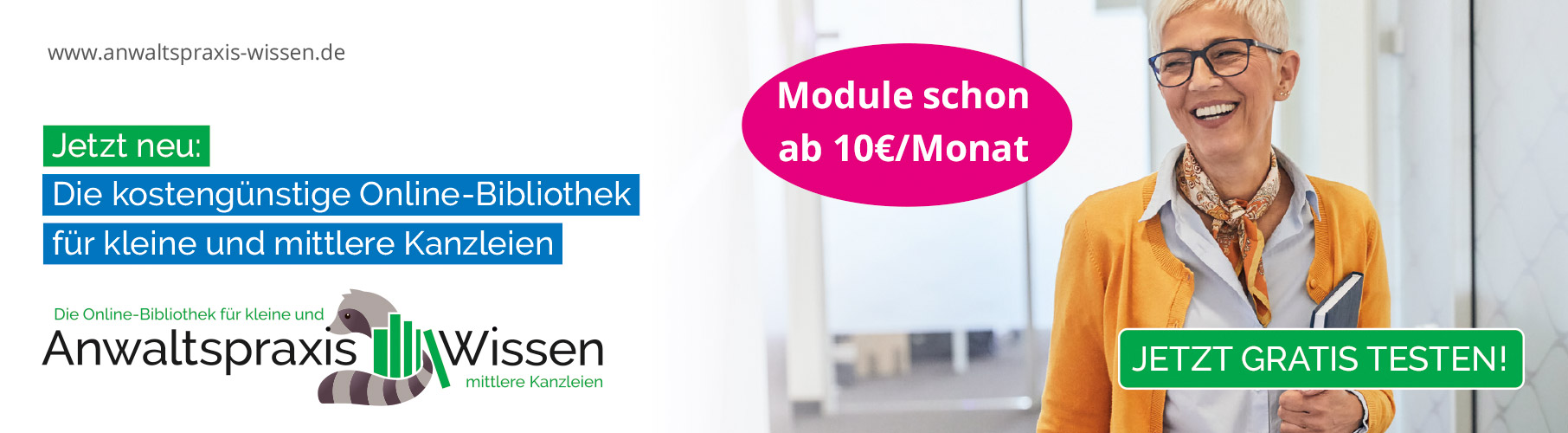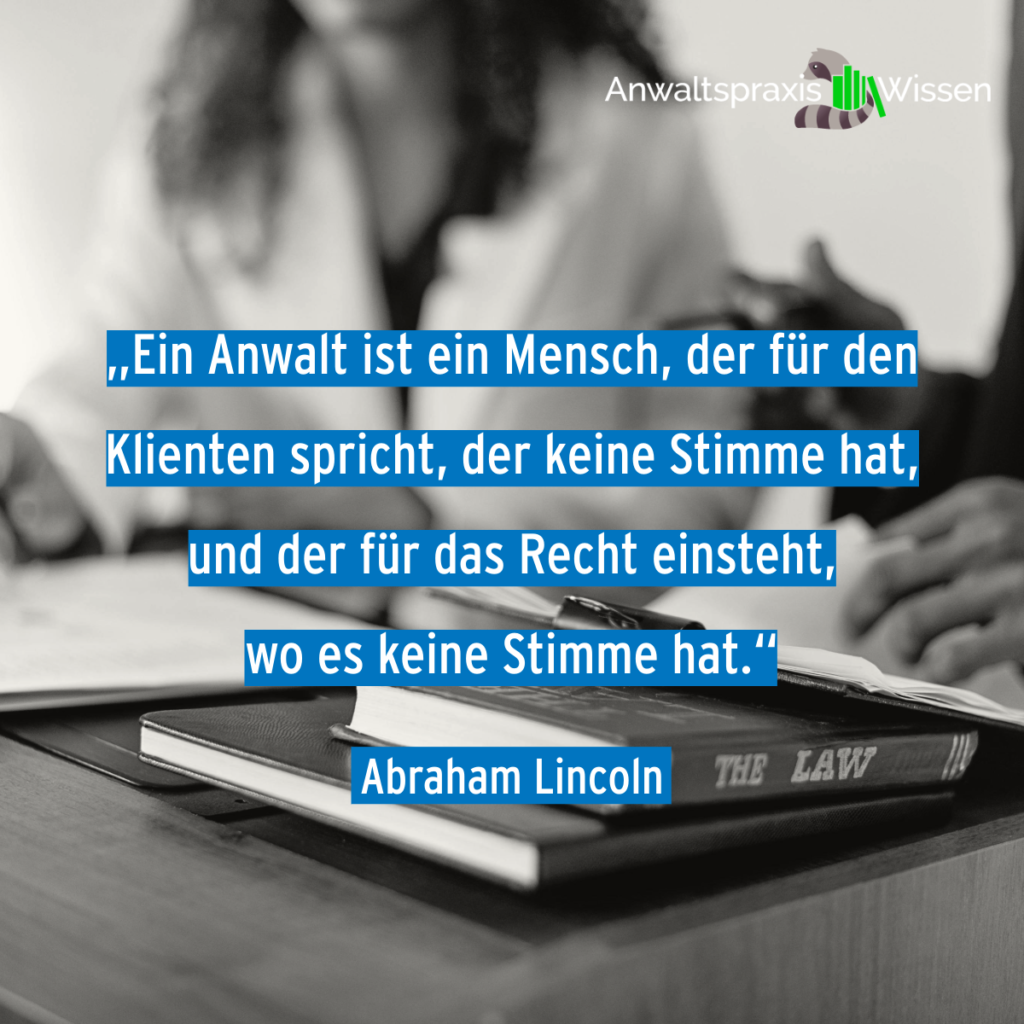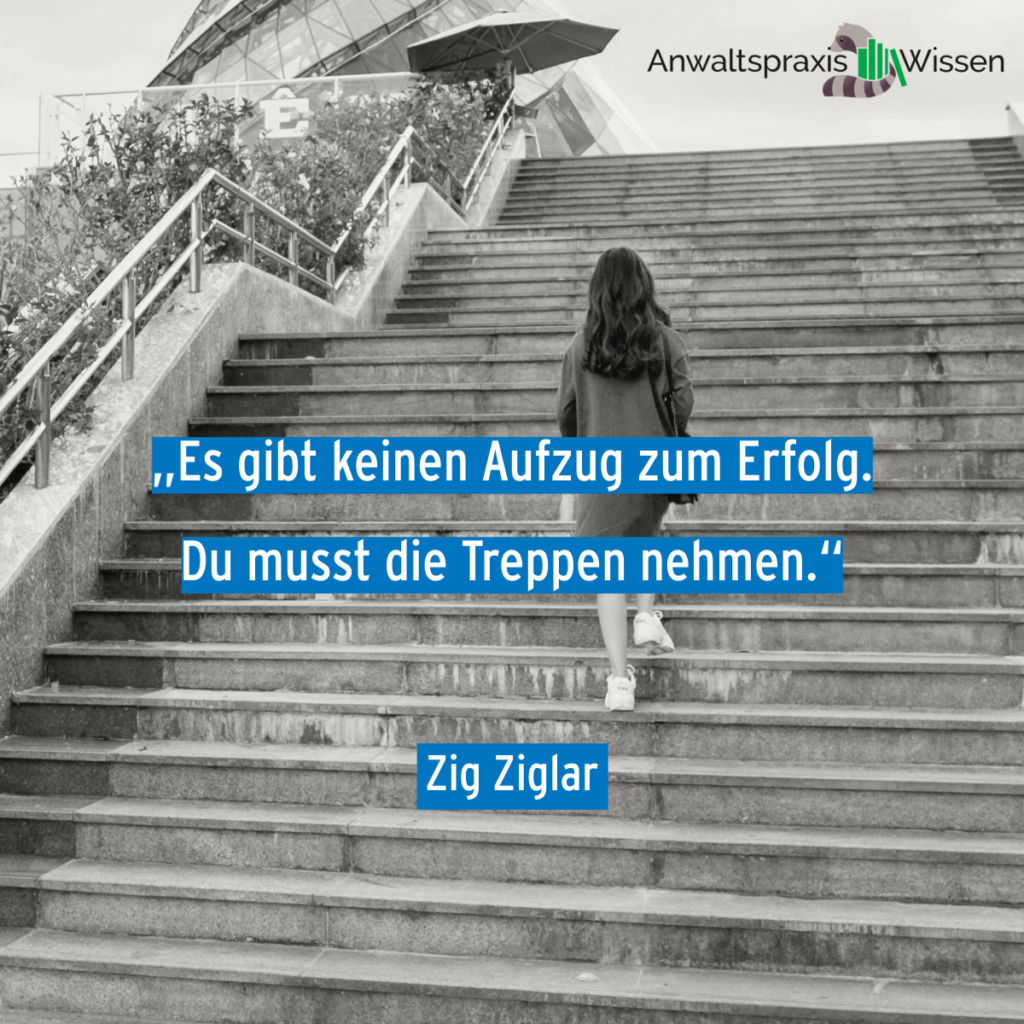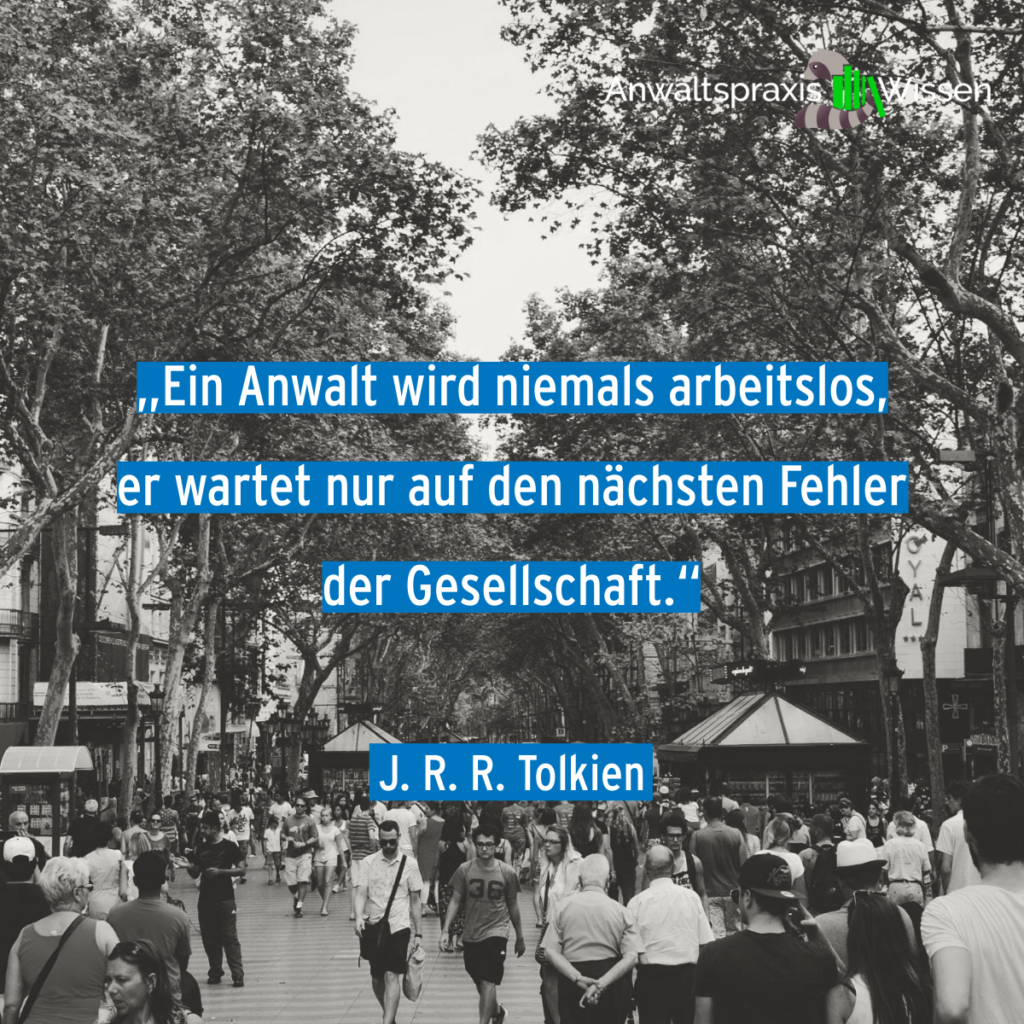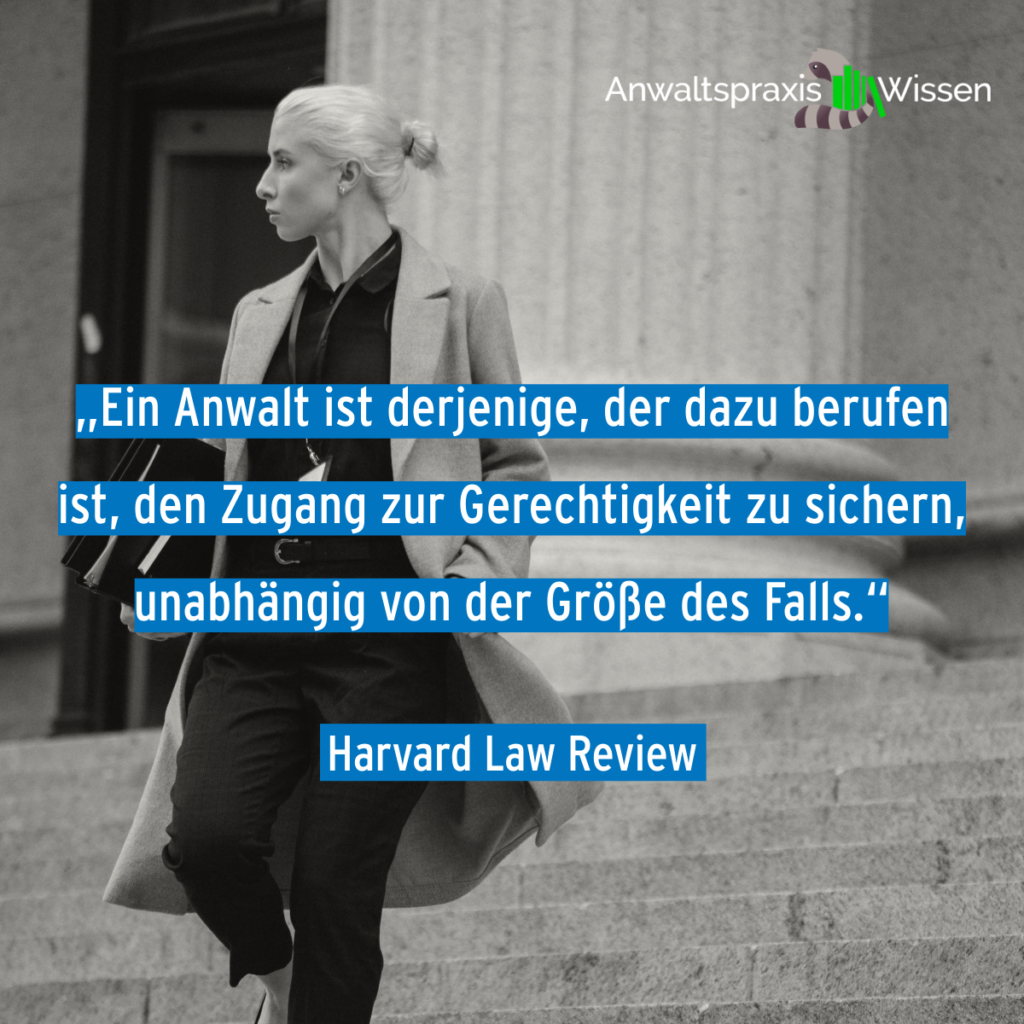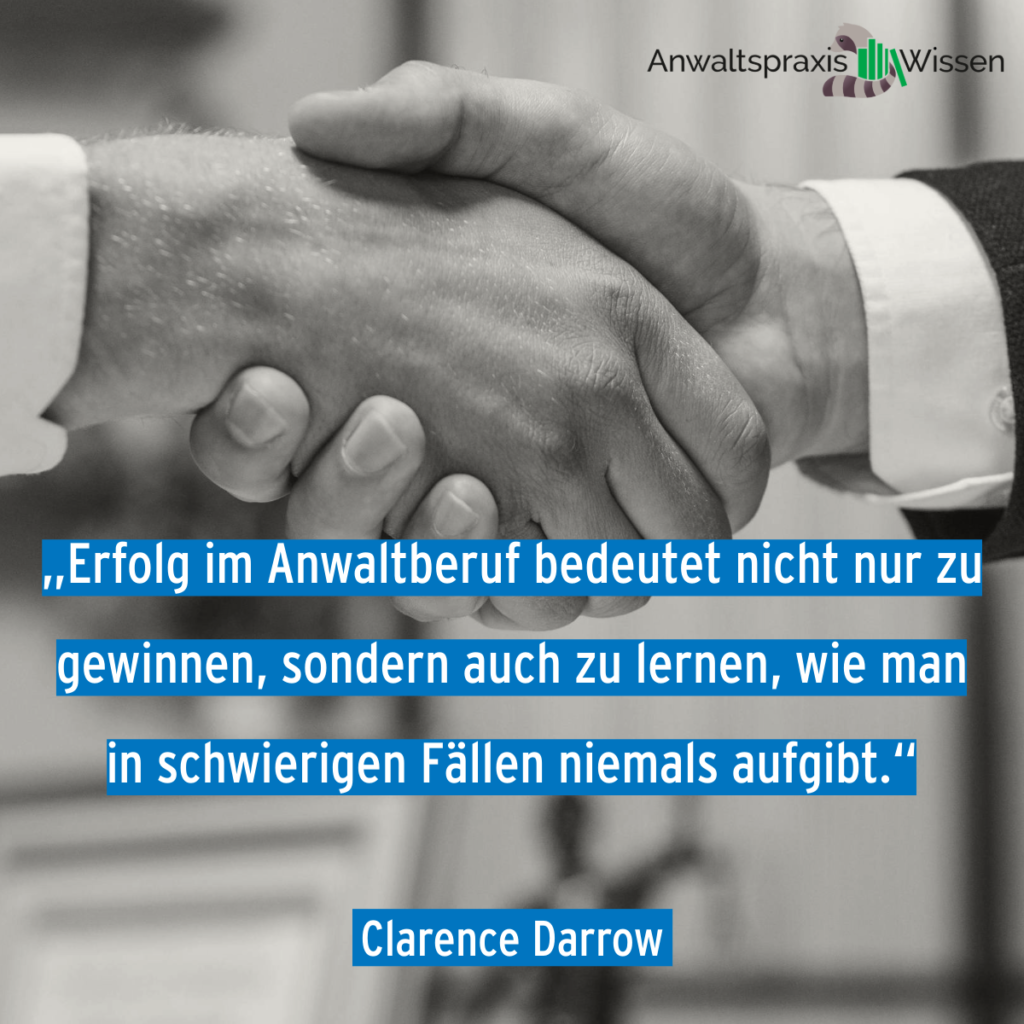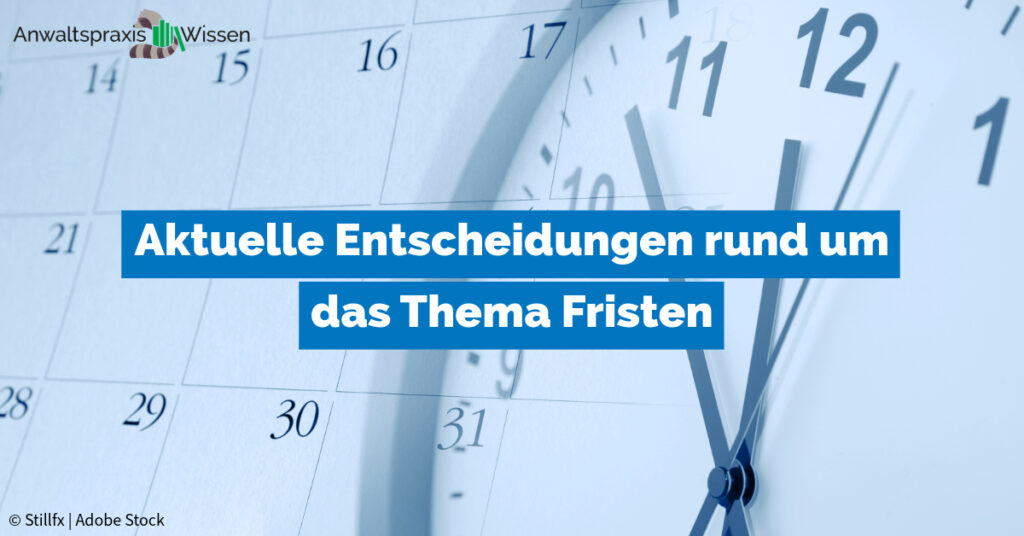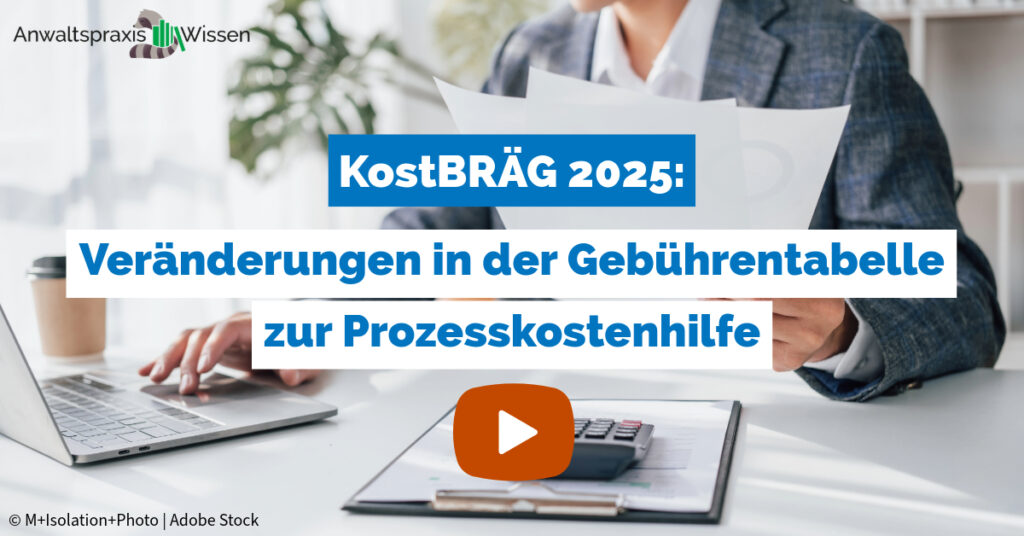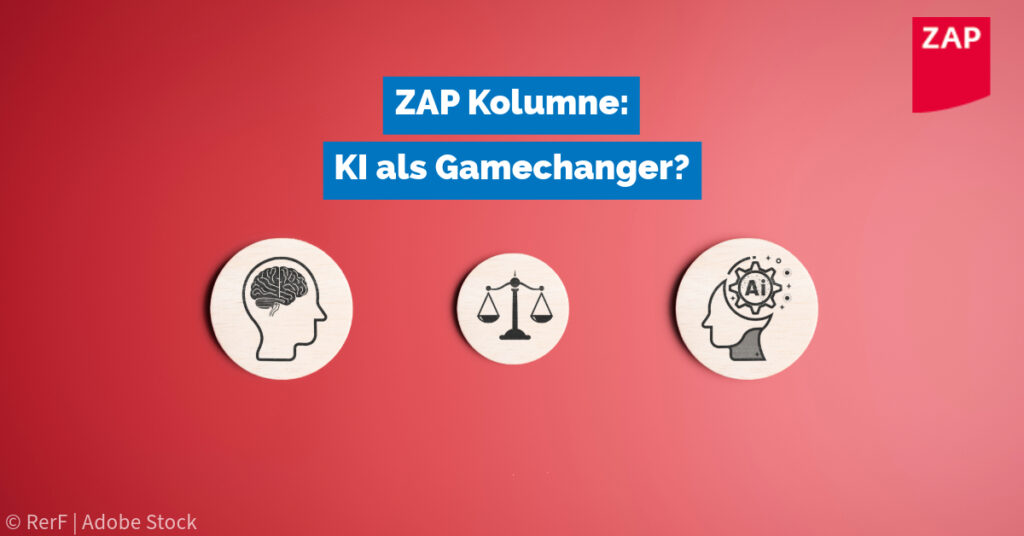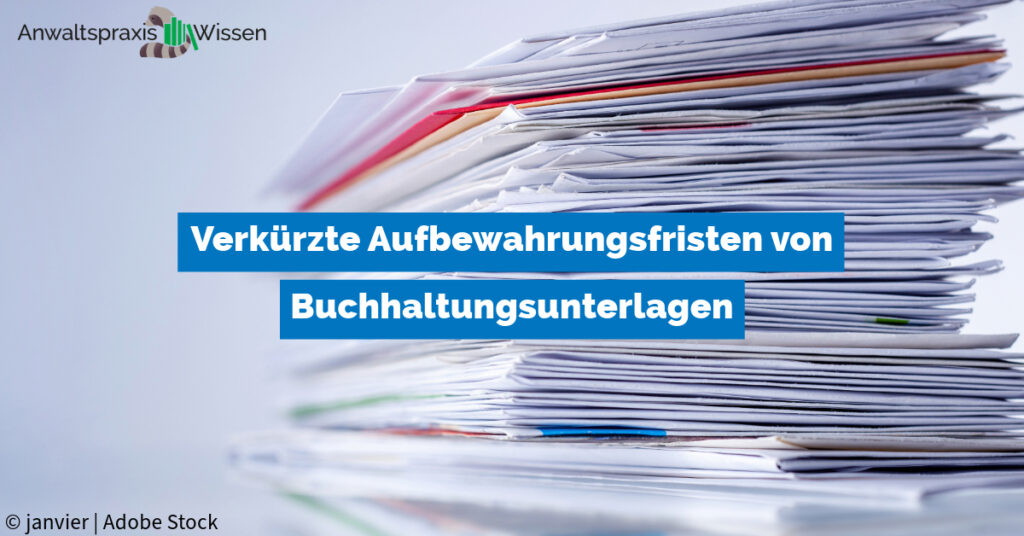Ausgehend von dem Fall, dass ein Gläubiger trotz intensivster Recherche keine Informationen über seinen Schuldner wie Bankverbindungen, Arbeitgeber, Versicherungen, etc. in Erfahrung bringen kann, bleibt letztlich nichts anderes übrig als zur „Informationsbeschaffung“ den Gerichtsvollzieher mit der Zwangsvollstreckung mittels des Pflichtformulars „Vollstreckungsauftrag an den Gerichtsvollzieher“ nach GVFV zu beauftragen. Dagegen ist grundsätzlich nichts einzuwenden, jedoch stellt sich vielfach die Frage nach dem „sinnvollen Ausfüllen und Ankreuzen“ der beabsichtigten Vollstreckungsmodule.
Diese Serie soll praktische Hinweise zu den einzelnen Modulen geben und in Einzelfällen auch die Sinnhaftigkeit der Kombination einzelner Module miteinander hinterfragen.
Zu Beginn dieser Serie beschäftigen wir uns mit dem Modul E „gütliche Erledigung“:
Dabei ist zunächst schon einmal klarzustellen, dass nach überwiegender Rechtsprechung immer dann, wenn der Gläubiger weder das Modul E noch das Modul F ankreuzt oder dieses seinem Vollstreckungsauftrag beifügt, konkludent eine gütliche Erledigung beauftragt wird. Dies hat zur Folge, dass auch der Gerichtsvollzieher die Gebühr nach Nummer 208 GvKostG abrechnen kann. Will der Gläubiger Derartiges vermeiden, muss er zwingend die Zahlungsvereinbarungen mittels Modul F ausdrücklich ausschließen (OLG Oldenburg 25.1.2019 – 2 W 59/18; LG Osnabrück 8.10.2018 – 2 T 164/18; LG Lüneburg 22.11.2017 – 5 T 66/17; aA: LG Verden 8.2.2018 – 6 T 103/17).
Nun stellt man sich vielleicht die Frage, weshalb man unbedingt eine Zahlungsvereinbarung über den Gerichtsvollzieher ausschließen sollte, frei nach dem Motto „lieber den Spatz in der Hand, als die Taube auf dem Dach“ . Diese grundsätzliche Überlegung ist aufgrund womöglich negativer Erfahrungen in der Zwangsvollstreckung durchaus nachvollziehbar, jedoch darf die umgekehrte Frage gestellt werden, ob es nachvollziehbar wäre, wenn ein Schuldner trotz mehrfacher Mahnungen und außergerichtlicher Anwaltstätigkeit nicht zahlt, man im Anschluss Zeit und Kosten in einen Prozess investiert, diesen gewinnt und dann als ersten Schritt der Zwangsvollstreckung den Schuldner fragt, ob er denn nicht lieber Raten zahlen möchte? Hätte ein Gläubiger die Wahl zwischen Vollzahlung und Ratenzahlung dürfte Einigkeit darüber bestehen, dass sich der Gläubiger immer für die Vollzahlung entscheiden würde. Insoweit signalisiert nach Auffassung des Verfassers die Beauftragung zur gütlichen Erledigung in dieser Phase des Zwangsvollstreckungsverfahrens, nämlich an der ersten Stelle, eine gewisse Verzweiflung des Gläubigers, der offenbar bereits zu Beginn seiner Zwangsvollstreckung nicht an den Erfolg glaubt.
Auch bei der Kombination der gütlichen Erledigung mit einer anderen Vollstreckungsmaßnahme beispielsweise dem Antrag auf Abgabe der Vermögensauskunft muss die Sinnhaftigkeit hinterfragt werden. So mag es durchaus sein, dass Raten durch den Schuldner bezahlt werden. Es stellt sich allerdings die Frage, ob diese Raten aufgrund des Versuchs der gütlichen Erledigung erfolgen oder ob sich das Verfahren nicht mittlerweile im Stadium „Vermögensauskunft“ befindet und der Schuldner weniger wegen des Angebots des Gläubigers auf gütliche Erledigung die Raten bezahlt, sondern vielmehr zur Abwendung der beantragten Vermögensauskunft, schlicht und ergreifend deshalb, weil der Schuldner zum jetzigen Zeitpunkt oder überhaupt nicht die Vermögensauskunft abgeben will. Ist dem so, dann ist mit hoher Wahrscheinlichkeit davon auszugehen, dass der Schuldner auch ohne Angebot des Gläubigers auf gütliche Erledigung zur Vermeidung der von ihm nicht gewünschten Abgabe der Vermögensauskunft Ratenzahlungen oder Vergleichslösungen anbietet.
In diesem Zusammenhang muss sich der Gläubiger natürlich auch fragen, wer aus seiner Sicht geeigneter erscheint, einen Zahlungsplan zu überwachen. Geht man davon aus, dass Ratenzahlungszusagen der Schuldner nicht oder nur unregelmäßig eingehalten werden, so ist nach der Erfahrung des Verfassers die Feststellung der Nichtzahlung der Rate beim Gerichtsvollzieher oftmals dann gegeben, wenn der Gläubiger sich seinerseits beim Gerichtsvollzieher nach dem Verbleib der Rate erkundigt. Dies bedeutet, dass in einer Vielzahl von Fällen die Feststellung, ob der Schuldner seiner regelmäßigen Ratenzahlung auch tatsächlich nachkommt, beim strukturierten Gläubiger wesentlich schneller möglich ist. Aufgrund des Umstandes, dass auch im Falle eines Zahlungsplans beim Gerichtsvollzieher, die Überwachung der regelmäßigen Ratenzahlung gleichwohl indirekt beim Gläubiger bleibt, wäre der direkte Abschluss einer Ratenzahlungsvereinbarung durch den Gläubiger auch wirtschaftlich sinnvoller im Hinblick auf die sodann entstehende Einigungsgebühr. Hinzu kommt, dass im Falle der Ratenzahlungsverhandlungen zwischen Gläubiger und Schuldner weitaus mehr Sicherungsrechte zwischen den Parteien vereinbart werden könnten, so beispielsweise ein Schuldbeitritt einer dritten Person, Abtretungen von Lohnansprüchen oder Kundenforderungen, welche auch im Falle einer Insolvenz des Schuldners zahlreiche Vorteile nach sich ziehen, ungeachtet des Wegfalls der Streitwertbegrenzung bei Vereinbarungen, welche über eine reine Ratenzahlung hinaus gehen. Damit sollte nach Auffassung des Verfassers durchaus oberstes Ziel sein, durch die Vollstreckung den Schuldner dazu zu bewegen, direkt den Kontakt mit dem Gläubiger aufzunehmen und ggf. eine direkte Vereinbarung zwischen Gläubiger und Schuldner zu schließen.
Dies gelingt wohl am wahrscheinlichsten mit dem Ausschluss der Zahlungsvereinbarung durch Modul F. Die wohl überwiegende Rechtsprechung hat entschieden, dass der Gläubiger berechtigt ist, eine gütliche Erledigung auszuschließen und der Gerichtsvollzieher hieran gebunden ist. Beispielhaft dürfen folgende Entscheidungen genannt werden:
- LG Hannover 25.7.2017 – 55 T 43/17
- OLG Stuttgart 14.1.2019 – 8 W 275/18
- OLG Düsseldorf 13.7.2017 – I-10 W 372/17
- LG Kiel 28.5.2018 – 4 T 34/18
- AG Stuttgart-Bad Cannstatt 29.3.2018 – 6 M 10905/18
- OLG Dresden 29.8.2018 – 3 W 437/18
- LG Arnsberg 10.7.2018 – 5 T 120/18
- LG Krefeld 22.5.2017 – 7 T 79/17
Zusammenfassend ist daher eine Kombination der gütlichen Erledigung mit anderen Modulen aus Sicht des Verfassers wenig zielführend, zumal auch gebührenrechtlich für den Gläubiger uninteressant. Wie der BGH mit Beschl. v. 18.7.2019 – 1 ZB 104/18 festgestellt hat, stellt der Auftrag zur gütlichen Erledigung keine besondere Angelegenheit im Sinne des § 18 Abs. 1 Nr. 1 RVG dar, für die dem Gläubigervertreter eine 0,3 Verfahrensgebühr nach Nr. 3309 VV-RVG zusteht, wenn er den Auftrag zur gütlichen Erledigung mit einer anderen Vollstreckungsmaßnahme, so beispielsweise dem Sachpfändungsauftrag oder den Antrag auf Abgabe der Vermögensauskunft kombiniert. Insoweit handelt es sich bei der gütlichen Erledigung um eine sogenannte vorbereitende Maßnahme.
Gebührenrechtlich und ggf. auch strategisch interessanter ist der Fall der isolierten gütlichen Erledigung. Der isolierte Antrag auf gütliche Erledigung stellt eine besondere Angelegenheit dar und der Gläubigervertreter erhält sodann eine 0,3 Gebühr aus der zu vollstreckenden Forderung. Selbstverständlich macht es wenig Sinn, als erste „Vollstreckungsmaßnahme“ einen Antrag auf isolierte gütliche Erledigung zu stellen. Der Verfasser sieht allerdings diese Möglichkeit als echte Alternative zu dem mehrfachen/wiederholten Antrag auf Abgabe der Vermögensauskunft nach Ablauf der Schutzfrist des § 802d ZPO, zumal dies auch für den Schuldner eine Gelegenheit wäre, keinen neuerlichen Eintrag im Schuldnerverzeichnis zu erhalten und damit mittelfristig auch wieder über eine „saubere Schufa“ zu verfügen. Hinzu kommt, dass als gütliche Erledigung nicht ausschließlich die Zahlungsvereinbarung/Ratenzahlungsvereinbarung zu sehen ist, sondern dass denkbar auch beispielsweise ein Teilverzicht des Gläubigers, z.B. im Hinblick auf Zinsen/Hauptsache wäre.
So hat beispielsweise auch das Amtsgericht Langenfeld mit Beschl. v. 11.1.2019 – 95 M 3548/18 festgestellt, dass die Ratenzahlung nicht die einzige Möglichkeit der gütlichen Erledigung darstellt. Natürlich bedarf es diesbezüglich des klaren Gläubigerauftrags an den Gerichtsvollzieher, der den Willen des Gläubigers an den Schuldner übermittelt. Insoweit ist auch die isolierte gütliche Erledigung neben den gebührenrechtlichen Vorteilen, auch insolvenzrechtlich nicht uninteressant. Im Falle der isolierten gütlichen Erledigung, also ohne der Androhung weiterer kombinierter Vollstreckungsmöglichkeiten im Falle des Scheiterns, dürfte auch die Anwendbarkeit des § 131 InsO fraglich sein, da Zahlungen des Schuldners gerade nicht aufgrund des Drucks einer Zwangsvollstreckung erfolgen, sondern aufgrund der gütlichen Erledigung. Diese Argumentation wird dann allerdings obsolet, wenn der Gläubiger seinerseits im Falle der gütlichen Erledigung wieder Folgevollstreckungsmaßnahmen kombiniert, da zumindest der Druck der Zwangsvollstreckung sodann im Raume steht.
Im nächsten Teil der Serie beschäftigen wir uns mit dem Modul G – Abnahme der Vermögensauskunft.