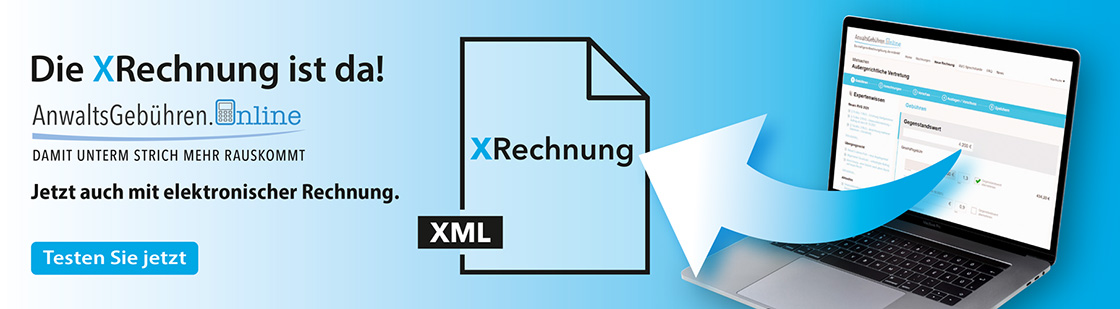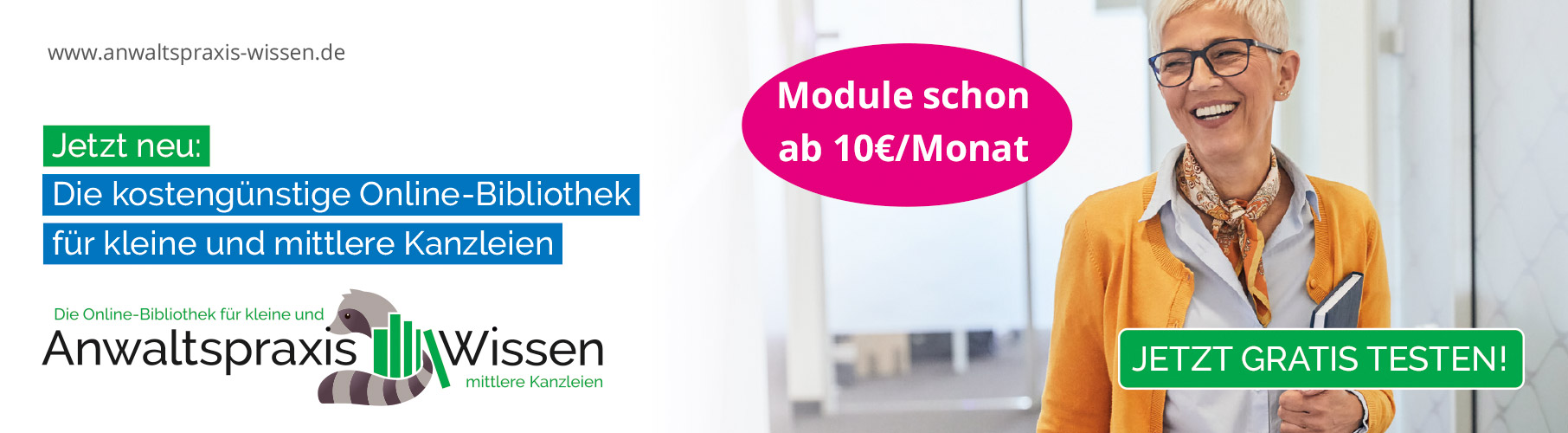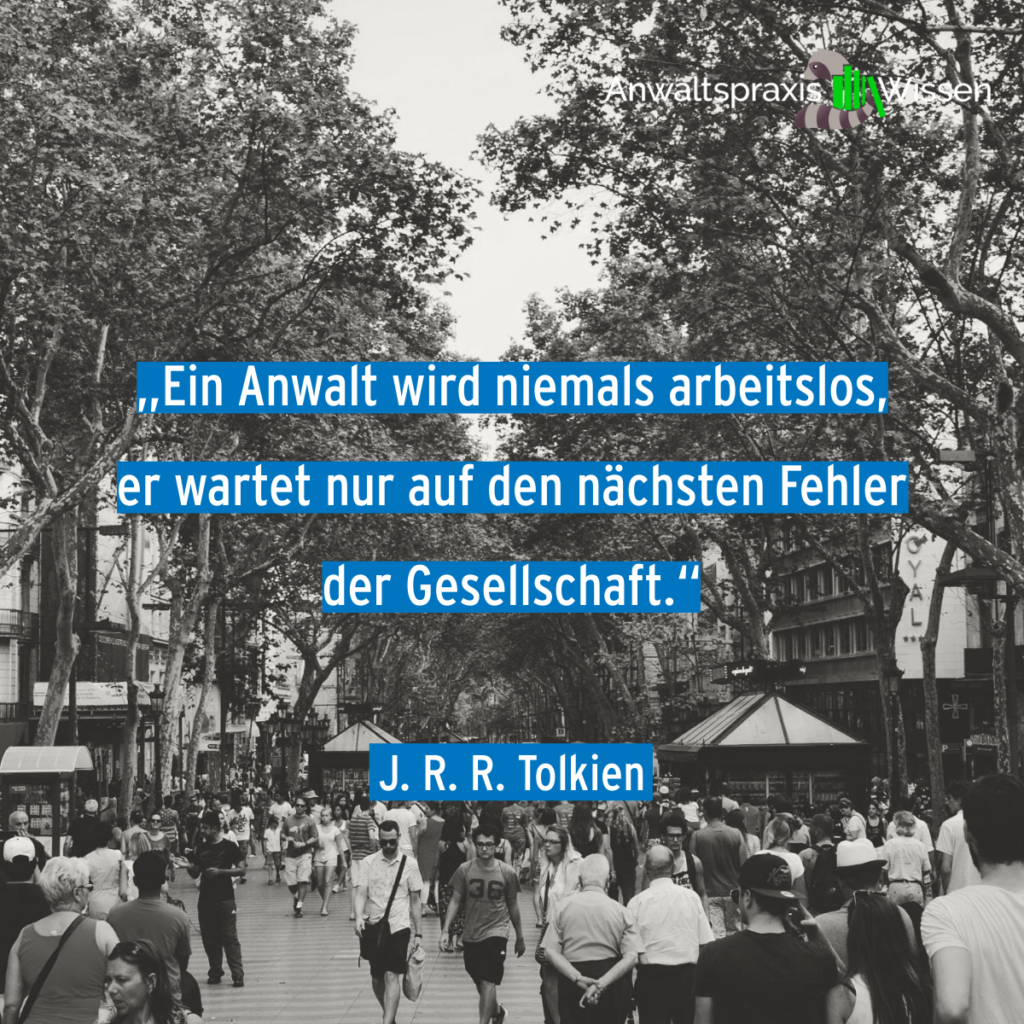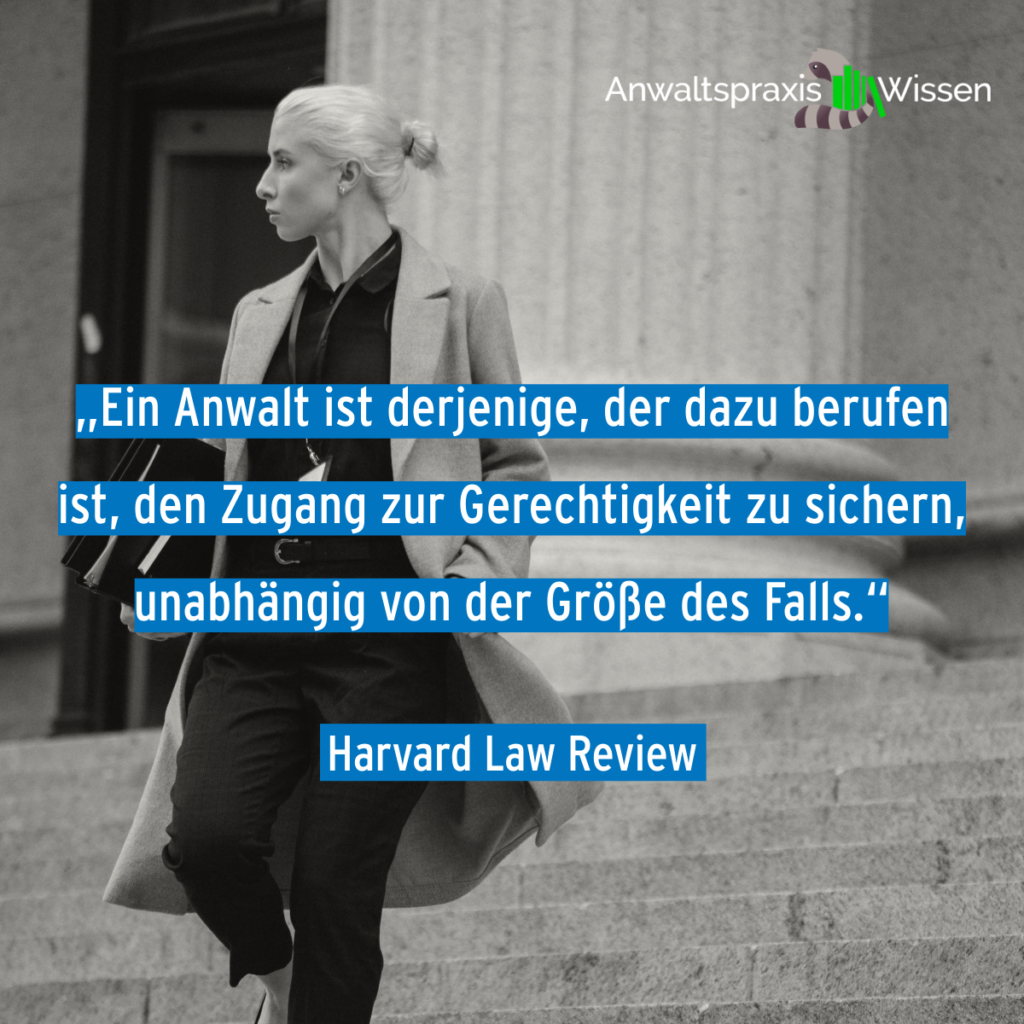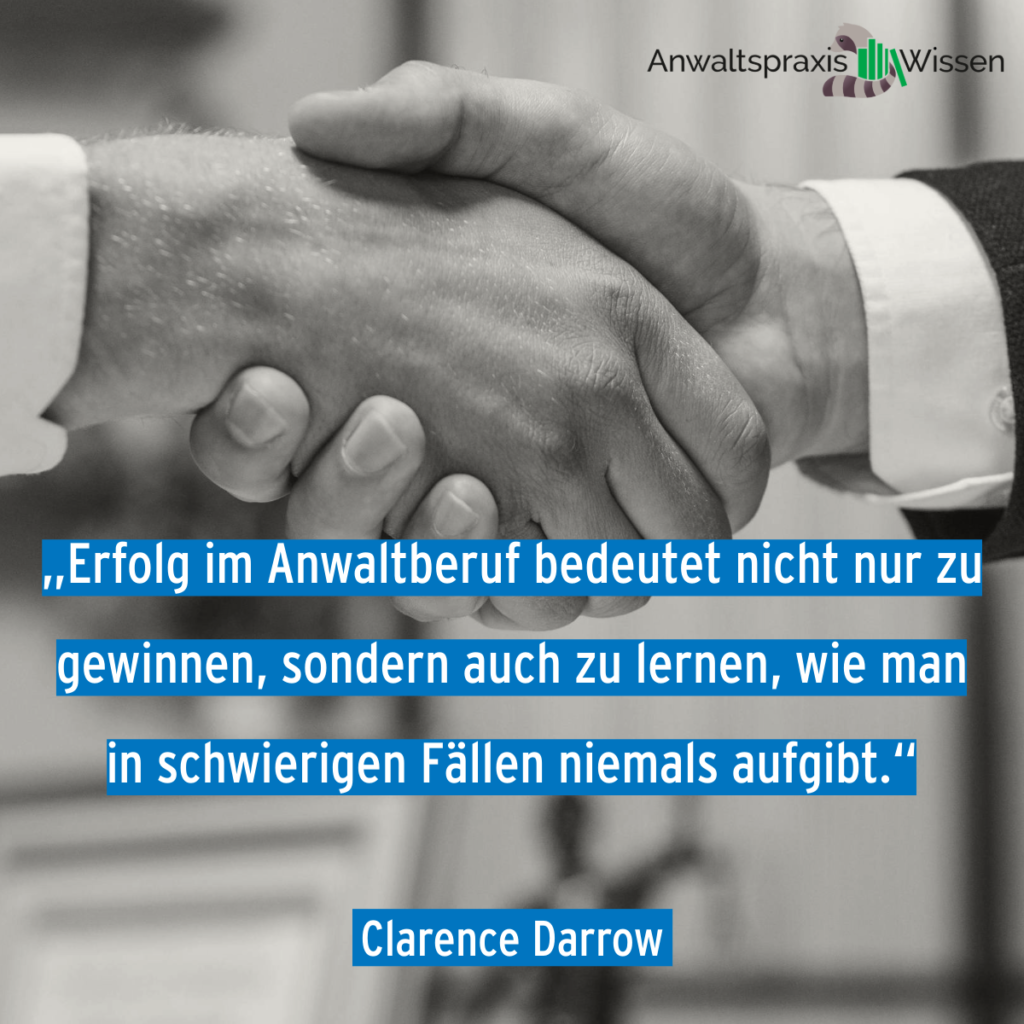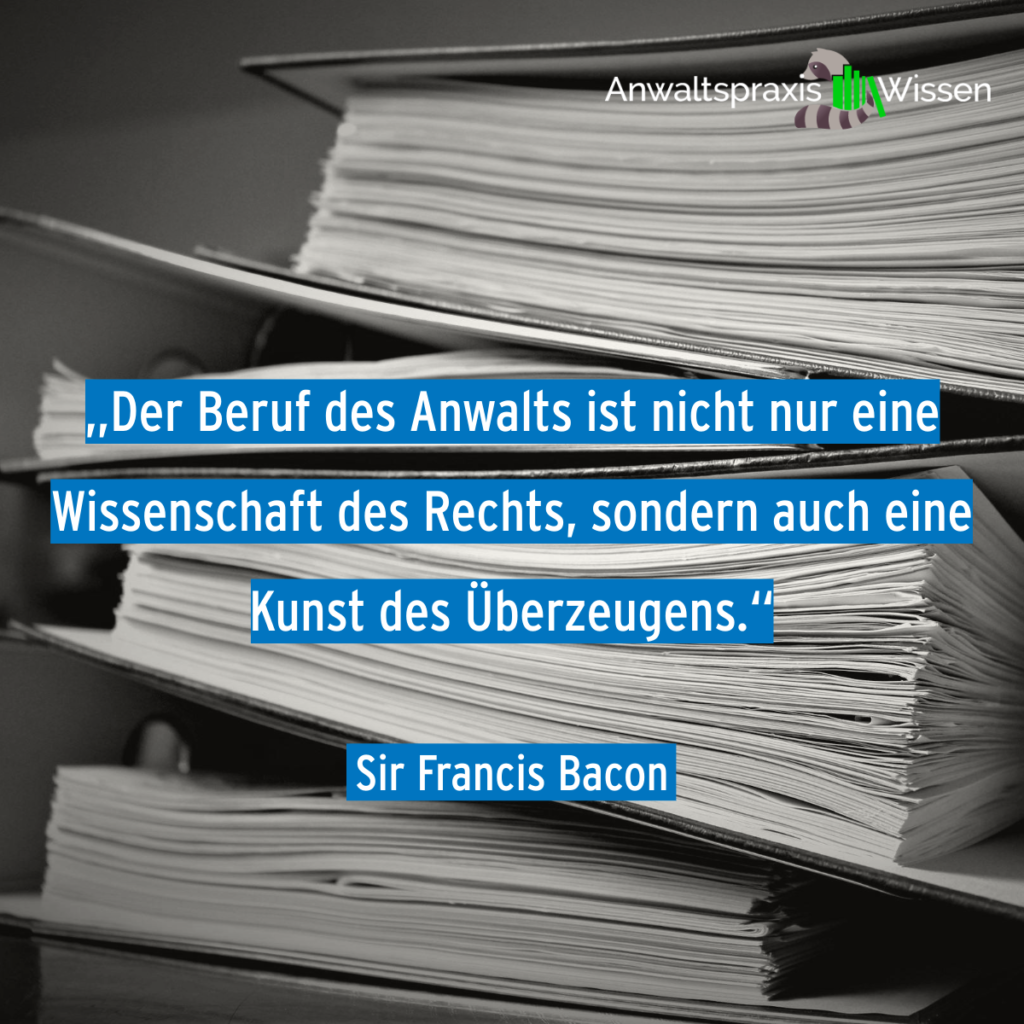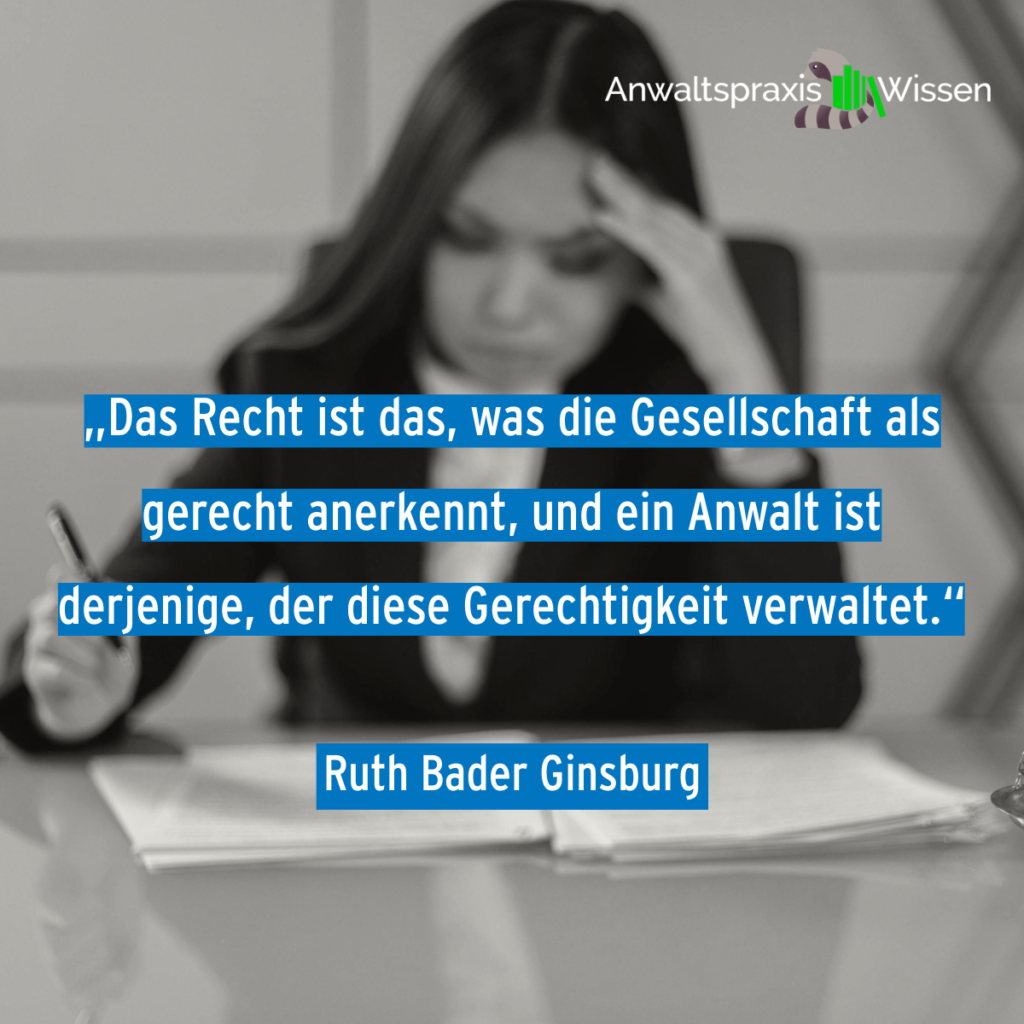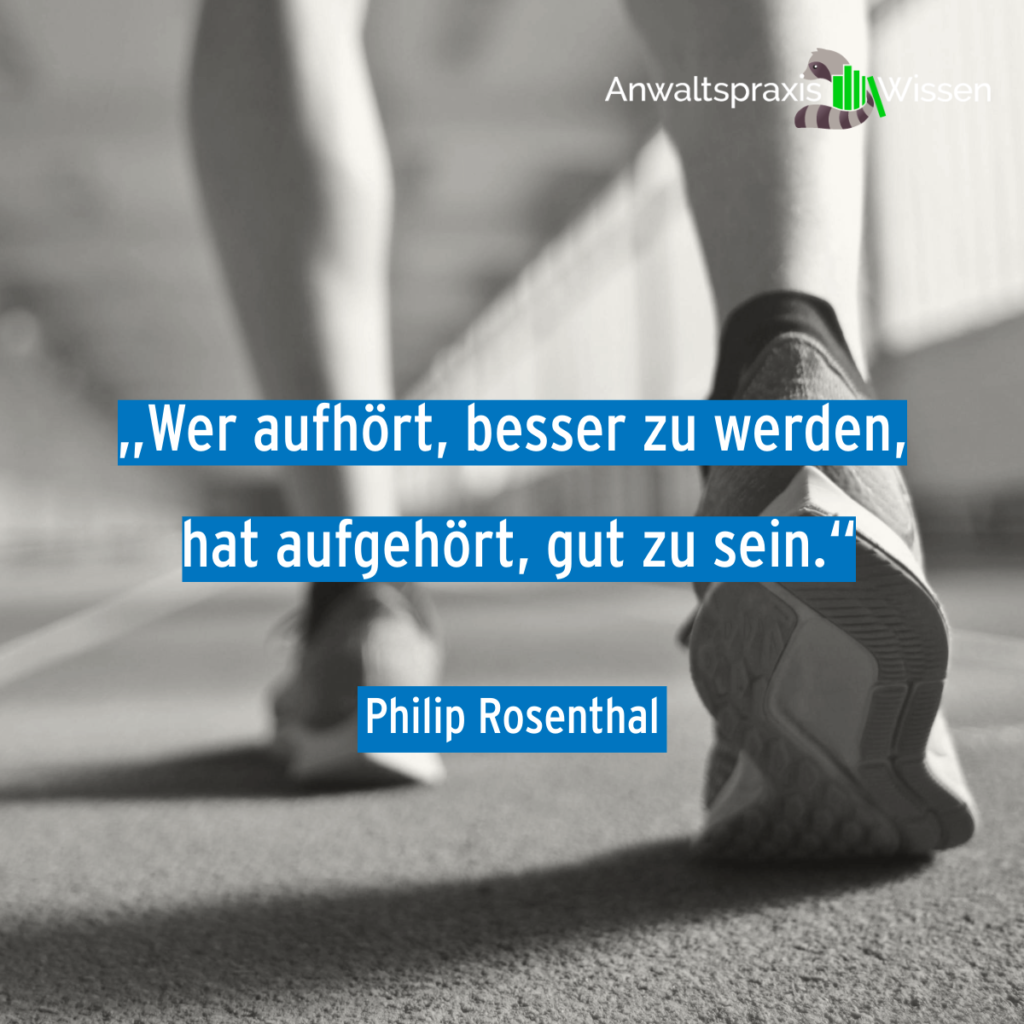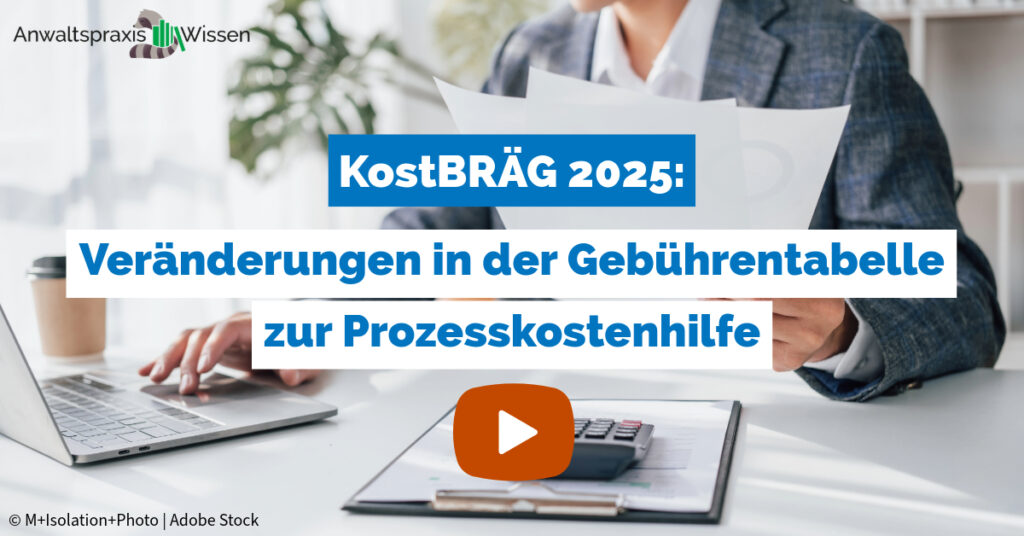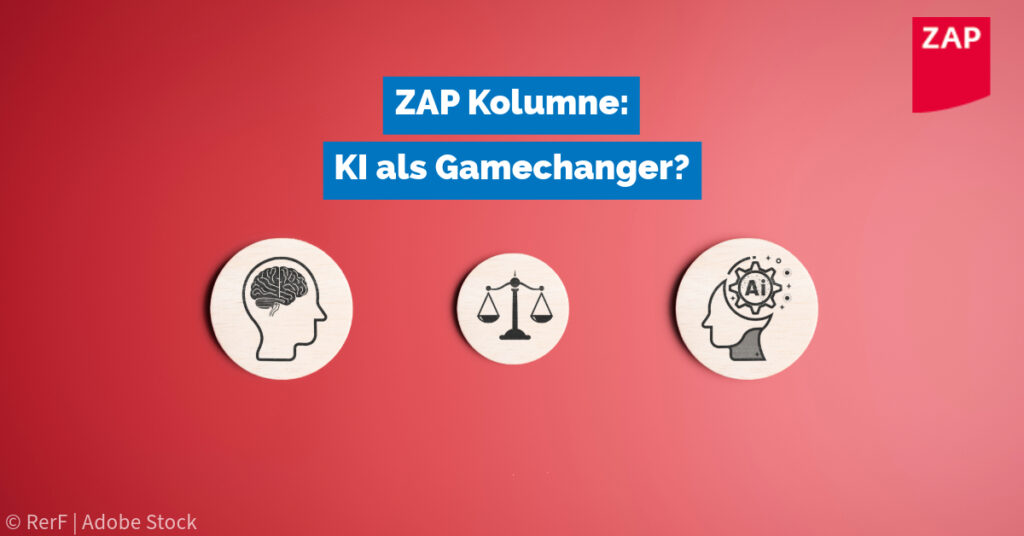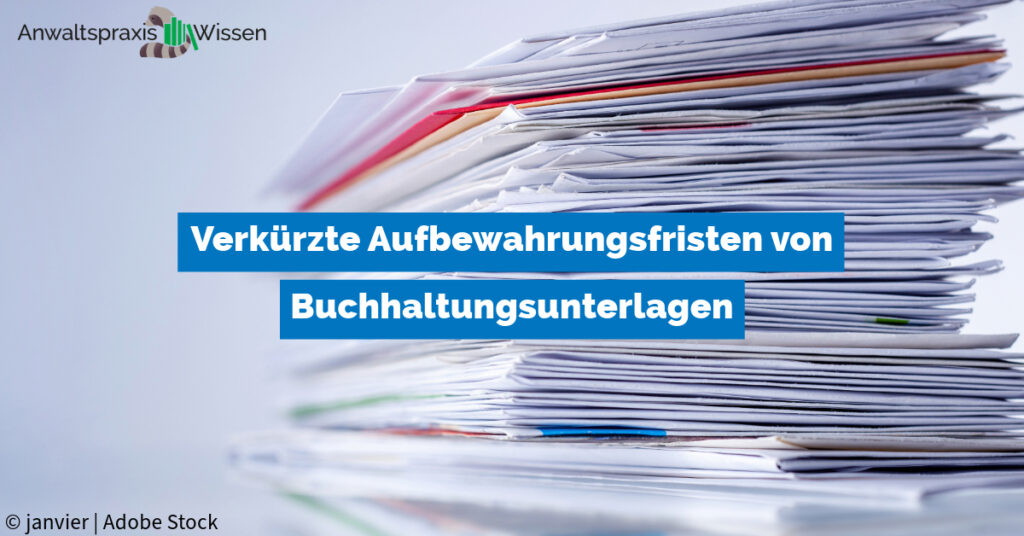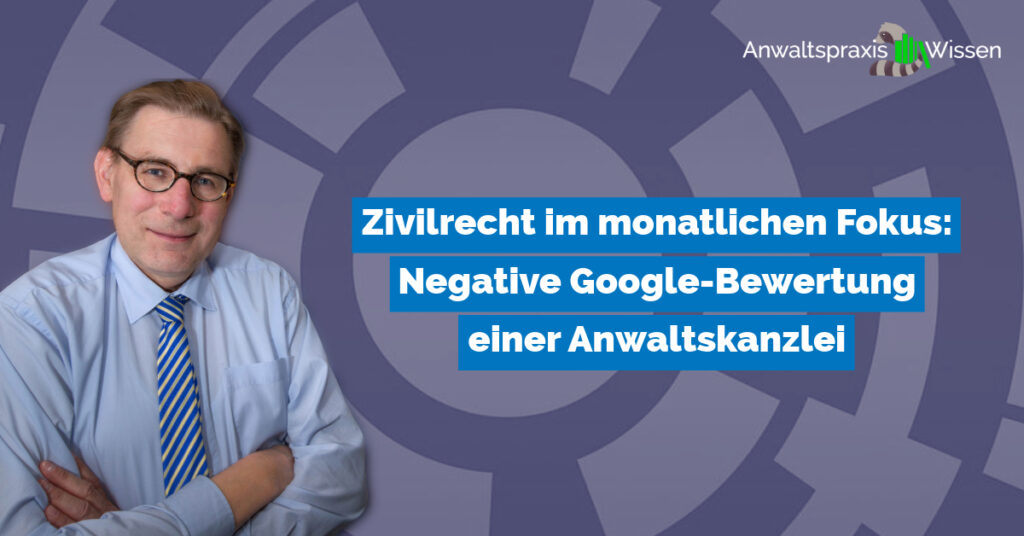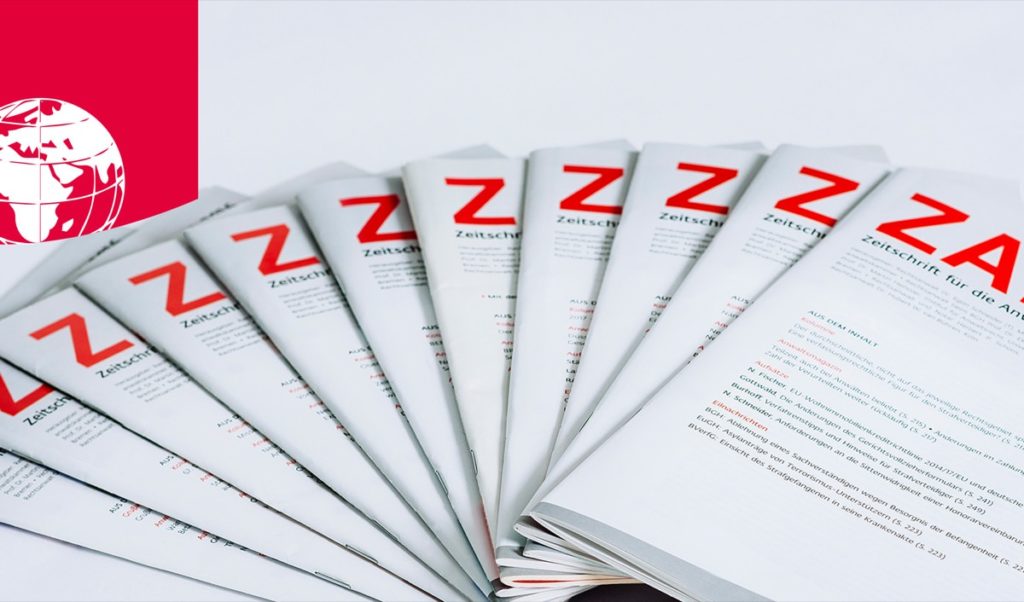Ein Rechtsanwalt, der einen Termin bei Gericht verpasst, weil er die Fahrzeit von seiner Kanzlei zum Gericht zu knapp kalkuliert, seinen Anwaltsausweis nicht bei sich führt und sich dann auch noch auf dem Weg zum Gerichtssaal verläuft, hat die Anreise zum Termin unzulänglich geplant. Das Versäumen des Termins ist dann nicht unverschuldet. (Leitsatz des Verfassers)
I. Sachverhalt
Berufungsverwerfung im AGH-Verfahren
Gestritten wird um Wiedereinsetzung in den vorigen Stand In dem Verfahren hatte eine Rechtsanwältin Berufung gegen ein Urteil des AnwG eingelegt. Die ist vom AGH durch Urteil wegen Versäumung der Berufungshauptverhandlung durch die Rechtsanwältin verworfen worden. Die angeschuldigte Rechtsanwältin hat Wiedereinsetzung in den vorigen Stand beantragt. Der Antrag hatte keinen Erfolg:
II. Entscheidung
Keine Wiedereinsetzung
Die Voraussetzungen für Wiedereinsetzung nach § 116 Abs. 1 S. 2 BRAO i.V.m. § 45 StPO lagen nach Auffassung des AGH nicht vor. Der Antrag sei zumindest unbegründet. Deshalb könne dahinstehen on die Einreichung des Wiedereinsetzungsantrags per Telefax und ausschließlich mit einer anwaltlichen Versicherung zur Glaubhaftmachung zulässig gewesen t. Denn er ist in jedem Falle nicht begründet.
Sehr mangelhafte Planung
Eine Rechtsanwältin, die wisse, um 13.00 Uhr in Hamm (Westf.) zu einem Termin erscheinen zu müssen, handele sorgfaltswidrig, wenn sie erst 75 Minuten zuvor mit dem Pkw von C. aus zu diesem Termin aufbreche. Für eine Autofahrt von 75 Kilometern zwischen Kanzlei und Gerichtsgebäude nur 75 Minuten Fahrtzeit einzuplanen, setze für ein rechtzeitiges Erreichen des Zielortes schon rein rechnerisch eine Durchschnittsgeschwindigkeit von 60 km/h voraus. Innerstädtisch sei diese Geschwindigkeit nicht gestattet; dortige Verzögerungen müssten also außerorts vollständig kompensiert werden, was an einem Freitagmittag – quer durch das gerichtsbekannt aktuell zusätzlich von Baustellen durchzogene Ruhrgebiet – von vornherein ausgeschlossen erscheine. Eine solche Planung der Anfahrzeit sei namentlich dann unzureichend, wenn die Rechtsanwältin – wie der Antragstellerin nach eigenem Vortrag schon bei Fahrtantritt positiv bekannt gewesen sei – nicht über ein funktionsfähiges Mobiltelefon zu verfügen, mit dem sie eine etwaige unvorhersehbare Verzögerung an das Gericht hätte mitteilen können. Zu den zumutbaren Maßnahmen für den Rechtsanwalt zähle im Übrigen auch, notfalls eine Tankstelle oder ein Rastplatz anzufahren, um das Gericht von dort aus über eine drohende verspätete Ankunft telefonisch zu unterrichten (vgl. OLG Celle, Urt. v. 24.6.2004 – 11 U 57/04, NJW 2004, 2534). Eine solche potenzielle Verzögerung für das Erreichen des Gerichtssaales habe zudem auch in dem Umstand gelegen, dass die bloße Anfahrt an das Gerichtsgebäude mit einem Zutritt zu dem Gerichtssaal notwendig nicht identisch sei. Für das Parken des eigenen Pkw und für den Fußweg von dem Parkplatz in den Saal hätte eine sorgfältige Planung weitere Zeiträume berücksichtigen müssen. Zu einer weiteren mehrminütigen Verzögerung im Eingangsgereich zum Gerichtsgebäude an einer Gerichtspforte komme es infolge Personenprüfung für Rechtsanwälte gerichtsbekannt überdies nur dann, wenn sie ihren Anwaltsausweis nicht präsentieren können. Das Mitführen des Rechtsanwaltsausweises sei eine Sorgfaltspflicht, die auch dem hindernisfreien und mithin rechtzeitigen Zugang zu dem Gerichtssaal zu dienen bestimmt sei. Wisse ein Rechtsanwalt, dass er seinen Rechtsanwaltsausweis nicht bei sich führe, habe er dies bei seiner Anreiseplanung zeitlich einzukalkulieren. Führe er seinen Ausweis unwissentlich nicht bei sich, habe er sich vorhalten zu lassen, insoweit nicht ordnungsgerecht für den Zutritt zu Gericht vorbereitet gewesen zu sein. Das gelte namentlich dann, wenn der Rechtsanwalt nicht einmal hoffen könne, Bediensteten in der Sicherheitsschleuse von Person bekannt zu sein. Genau hiervon sei im vorliegenden Fall aber für die Antragstellerin auszugehen, die nach eigenem Vortrag im Anschluss an das Betreten des Gerichtsgebäudes zunächst noch fußläufig in einen unzutreffenden Gebäudetrakt gegangen sei, bis sie den Saal schlussendlich mit knapp dreiviertelstündiger Verspätung gegenüber der Ladungszeit erreicht habe. Nur der Ortsunkundige verlaufe sich in einem Gerichtsgebäude. Ortsunkundige seien bei Gericht aber denknotwendig nicht erwartbar von Person bekannt. Folglich habe für die Antragstellerin auch a priori ausgeschieden, eine ausweislos zügige Zugangsabwicklung in das Gerichtsgebäude erhoffen zu können. Dass sie allerdings auch ihr persönlich unbekannte Justizmitarbeiter in der Sicherheitsschleuse hätte fragen können, wie sie den angezielten Saal schnellstens würde erreichen können, liege zusätzlich auf der Hand. Nach allem kann dahinstehen, ob die Antragstellerin mithin tatsächlich bereits – wie sie versichert – um 11.45 Uhr zu ihrer Anreise aufgebrochen sei oder ob sie die später noch an das Gericht und ihren Pflichtverteidiger faxschriftlich versandten Schriftsätze in C. selbsthändig verschickt haben könnte.
III. Bedeutung für die Praxis
Geltung auch in anderen Verfahren
1. Die Ausführungen des AGH zur Begründetheit kann man auch auf Rechtsanwälte in anderen Verfahren anwenden, und zwar immer dann, wenn das Verschulden des Rechtsanwalts dem Mandanten zugerechnet wird, also z.B. beim Nebenklagevertreter. Sie können aber auch Bedeutung erlangen, wenn es um Verspätung des Angeklagten oder des Betroffenen geht, dessen Berufung oder Einspruch ggf. deshalb verworfen worden ist (dazu u.a. Burhoff (Hrsg.), Handbuch für die strafrechtliche Hauptverhandlung, 11. Aufl., 2025, Rn 837 m.w.N.).
In der Sache sind die Ausführungen des AGH m.E. zudem zutreffend. Die Rechtsanwältin war hier nun wirklich in jeder Hinsicht unvorbereitet.
Anwendung beim Abwesenheitsgeld
2. Als Rechtsanwalt sollte man diese Entscheidung ggf. auch immer dann anführen, wenn bei der Vergütungsfestsetzung um das Abwesenheitsgeld (Nr. 7005 VV RVG) gestritten wird. Nicht selten wird dabei ja von den Vertretern der Staatskasse für die Berechnung der (erforderlichen) Abwesenheitszeit einfach die Angaben von z.B. Google Maps zugrunde gelegt. Die Entscheidung zeigt aber mehr als deutlich, dass das für die Berechnung eben nicht reicht und auf die so ermittelte Fahrzeit sicherlich ein Zuschlag zu machen ist.
Einlegung per beA
3. Zur Zulässigkeit hatte der AGH die Frage erörtert, ob der Wiedereinsetzungsantrag nicht hätte per beA eingelegt werden müssen. Dazu hat er darauf hingewiesen, dass eine zwingende Verpflichtung zur Einreichung per beA für die Einhaltung der Schriftform i.S. einer Wirksamkeitsvoraussetzung sich ausschließlich aus § 32d Satz 2 StPO für die dort abschließend aufgezählten Anträge und Erklärungen ergebe (Meyer-Goßner/Schmitt, StPO, 67. Aufl. 2024, § 32d Rn 1). Ein Wiedereinsetzungsantrag werde von dieser Enumeration erkennbar nicht umfasst. Eine Verpflichtung zur Einreichung von Wiedereinsetzungsanträgen per beA bestünde nach Auffassung des AGH im anwaltsgerichtlichen Verfahren mithin nur dann, wenn die „entsprechende“ Anwendung dieser Vorschrift nach § 116 BRAO über ihren gesetzlich abschließend formulierten Katalog hinaus Ausdehnung erfordere. Soweit § 32d Satz 1 StPO bestimme, dass Verteidiger und Rechtsanwälte u.a. schriftlich einzureichende Anträge und Erklärungen als elektronisches Dokument übermitteln „sollen“, sei dies – im abgrenzenden Lichte des dortigen Satz 2 – nicht zwingende Wirksamkeitsvoraussetzung (vgl. Meyer-Goßner/Schmitt, a.a.O., „Regelfall“). Denn auch wenn im Übrigen – getreu der Regel „soll heißt muss, wenn kann“ – grundsätzlich ein „Sollen“ im Sinne eines „Müssen“ zu verstehen sei, so könnte namentlich der prozessuale Ausnahmefall des Wiedereinsetzungsgesuches als einer Art Notmaßnahme zur Rückerlangung einer dem Anschein nach bereits verloren gegangenen Rechtsposition der gerichtlichen Fairness halber zu einer weniger formenstrengen Auslegung Veranlassung geben. Dies gelte namentlich in Ansehung des Umstandes, dass die Einlegung der Berufung selbst nach der Rechtsprechung des Senates einer Nutzung des beA nicht zwingend bedürfe. Mithin liege nicht nahe, für den bloßen Wiedereinsetzungsantrag strengere Regeln zur Anwendung zu bringen als für das den Rechtszug ursprünglich eröffnende Rechtsmittel. Auch § 32a Abs. 1 StPO spreche ersichtlich nur davon, dass elektronische Dokumente bei u.a. Gerichten nach Maßgabe der folgenden Absätze eingereicht werden „können“. Letztlich sprecht also gesamthaft eher mehr dafür als dagegen, dass die erforderliche Schriftform auch durch ein Telefax gewahrt werden könne (Meyer-Goßner/Schmitt, a.a.O. § 45 Rn 1 i.V.m. Einl Rn 128). Diese Frage hat der AGH dann aber letztlich offen gelassen, obwohl die Tendenz seiner Auffassung sehr deutlich wird. Dennoch: lieber per beA.
Reichte anwaltliche Versicherung?
4. Ebenso hat der AGH dahinstehen lassen, ob es (im anwaltsgerichtlichen Verfahren) für die nötige Glaubhaftmachung der dem Wiedereinsetzungsgesuch zugrundeliegenden Tatsachen hinreicht, sie anwaltlich als richtig zu versichern. Im Strafprozess reiche eine eigene eidesstattliche Versicherung des Angeklagten nicht als Mittel der Glaubhaftmachung aus, da sie nicht über den Wert einer eigenen (einfachen) Erklärung hinausgehe (Meyer-Goßner/Schmitt, a.a.O., § 45 Rn 8 mit Verweis auf BGH, Beschl. v. 2.3.2014 – 1 StR 74/14). In diesem Verständnis müsste vorliegend also bereits von einer Unzulässigkeit des Wiedereinsetzungsantrages ausgegangen werden. Gegen eine solche schematische Übertragung der strafprozessualen Regel auf das anwaltsgerichtliche Verfahren spreche indes, dass der beschuldigte Rechtsanwalt Organ der Rechtspflege sei. Er lege also mit einer etwaigen anwaltlichen Versicherung infolge der ihm bekannten Rechtsfolgen einer unrichtigen Versicherung regelhaft mehr in die Waagschale der Glaubwürdigkeitsabwägung als der strafprozessual Angeklagte. Auch hier: Lieber nicht.