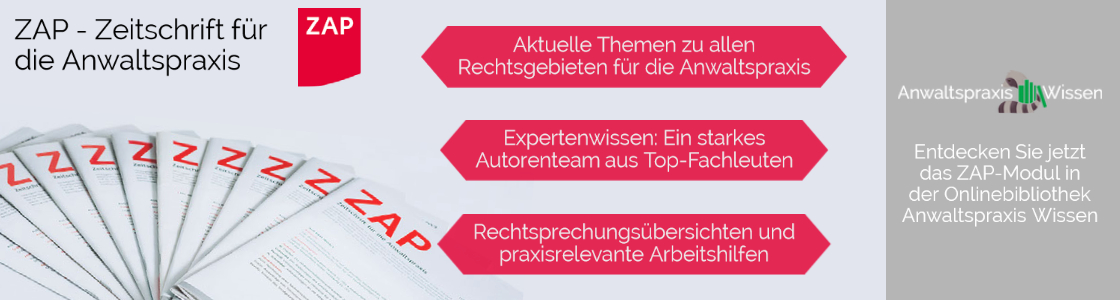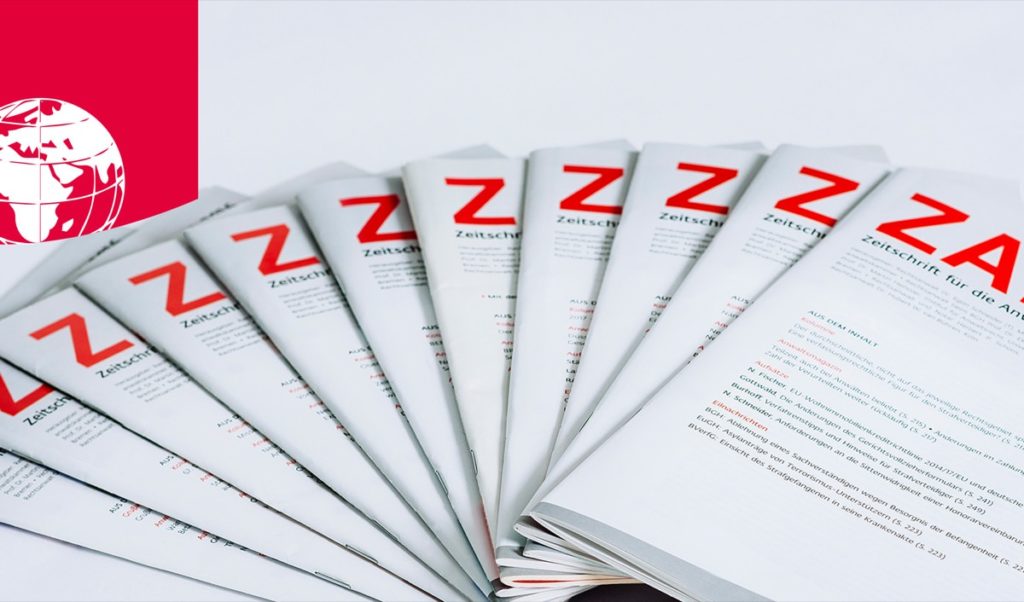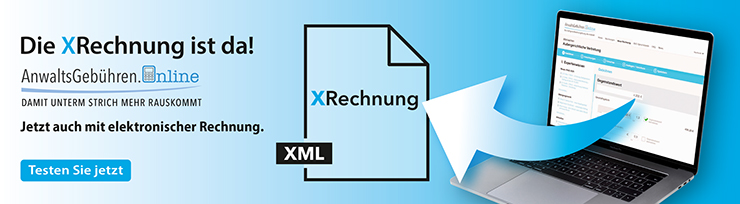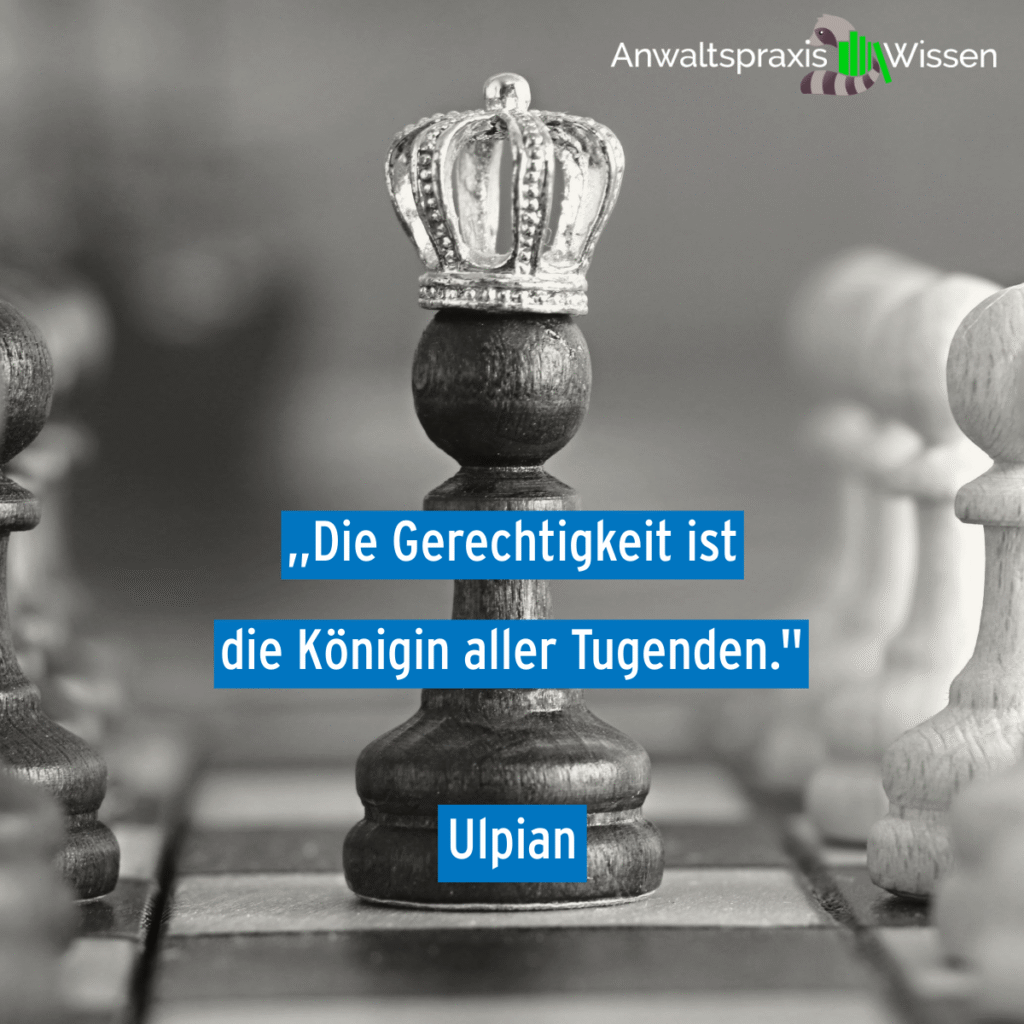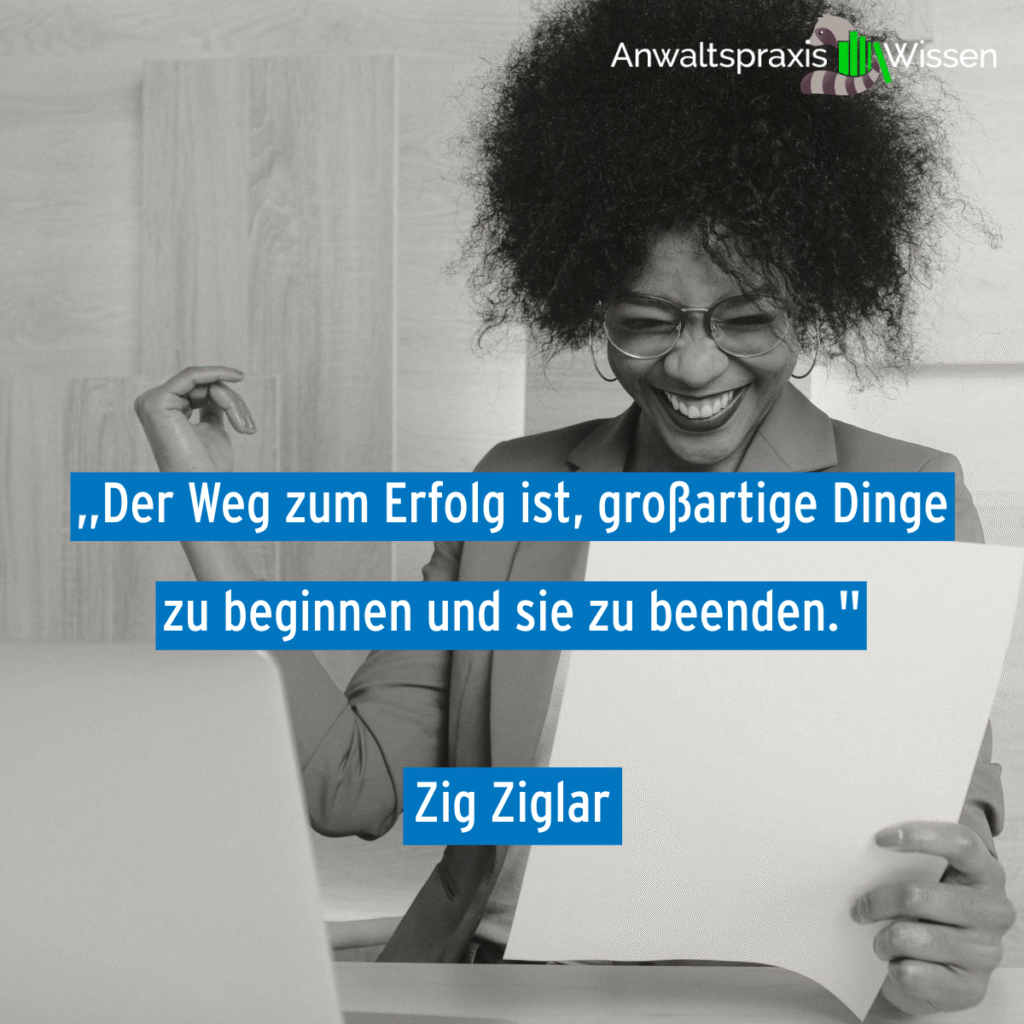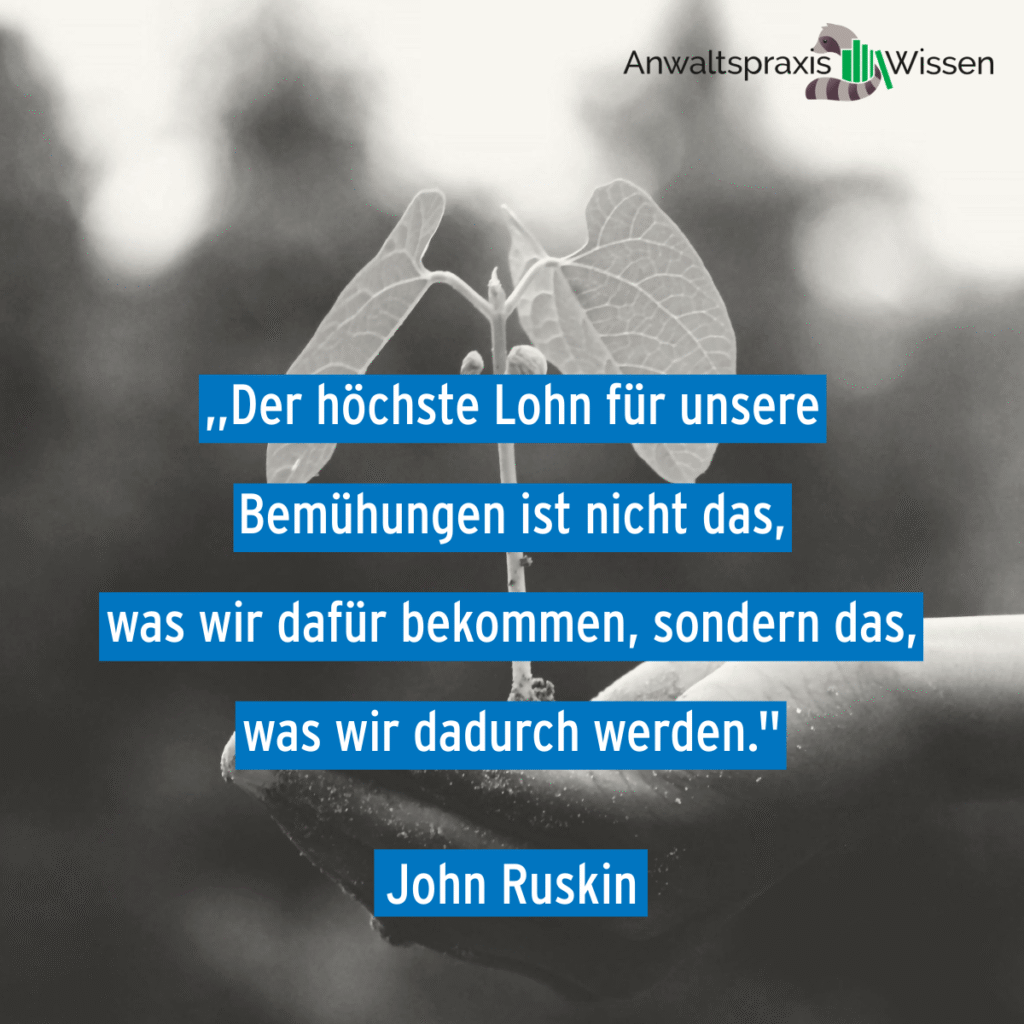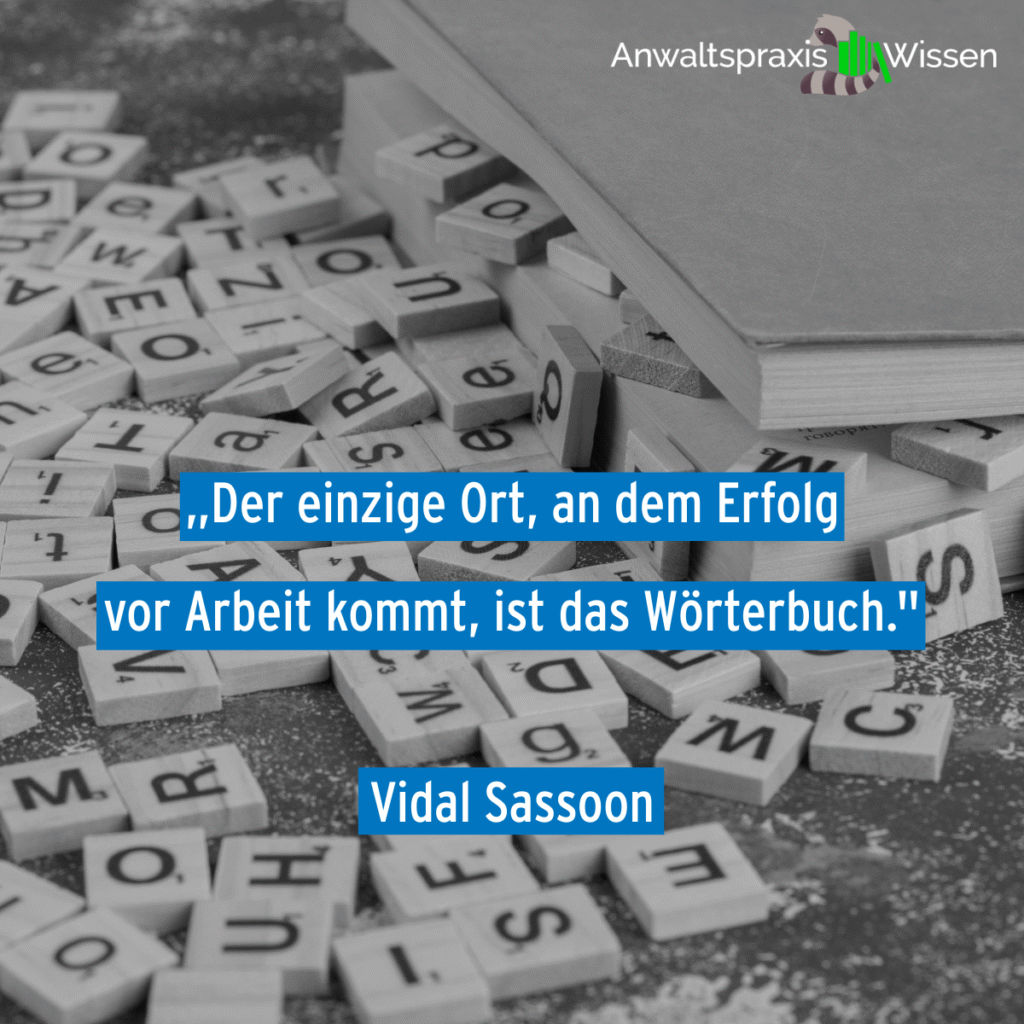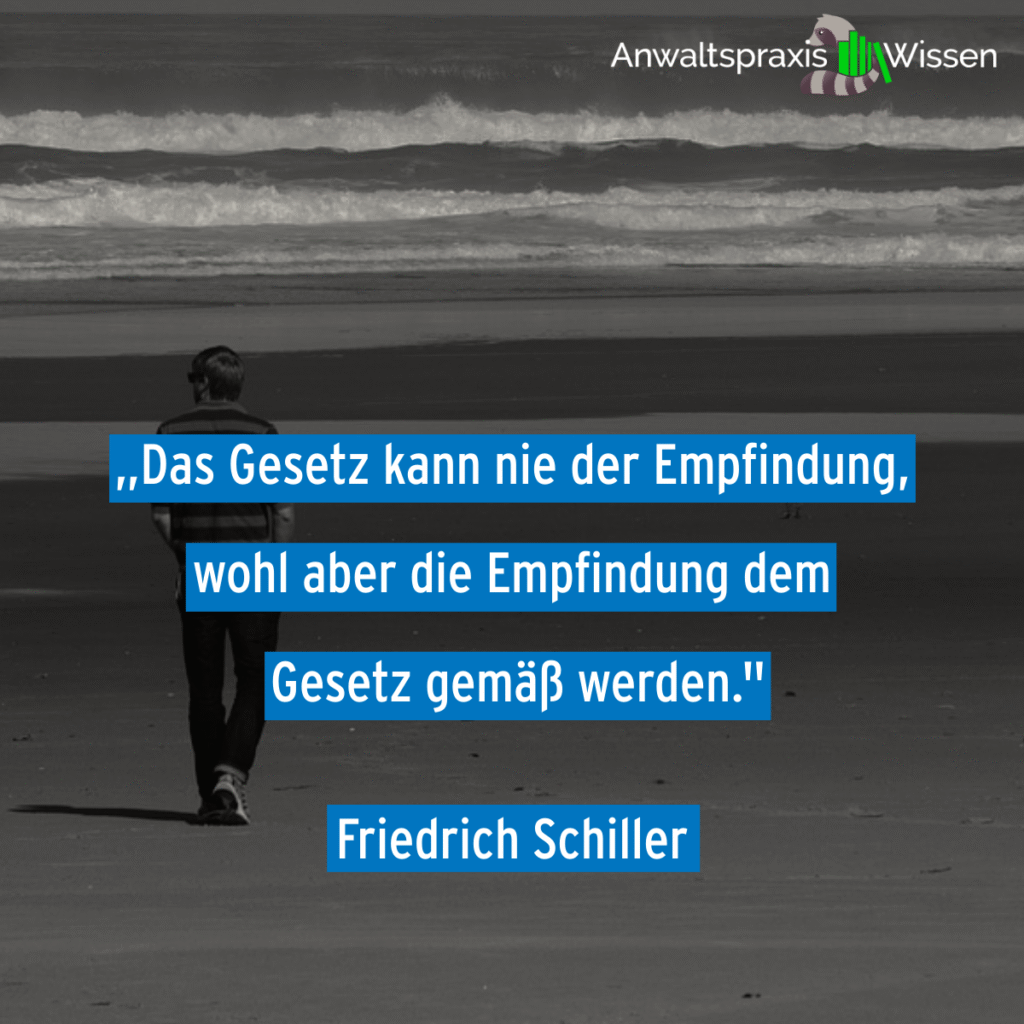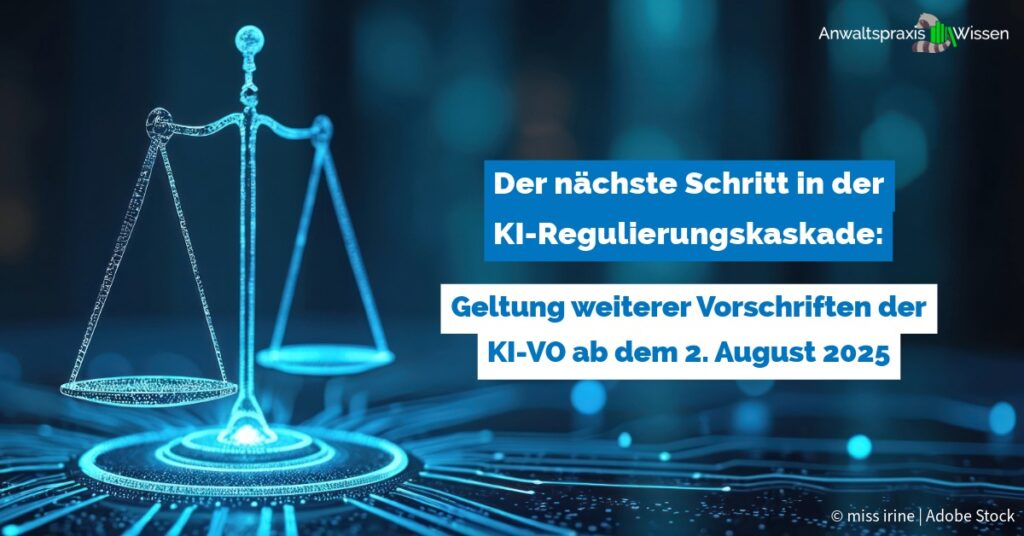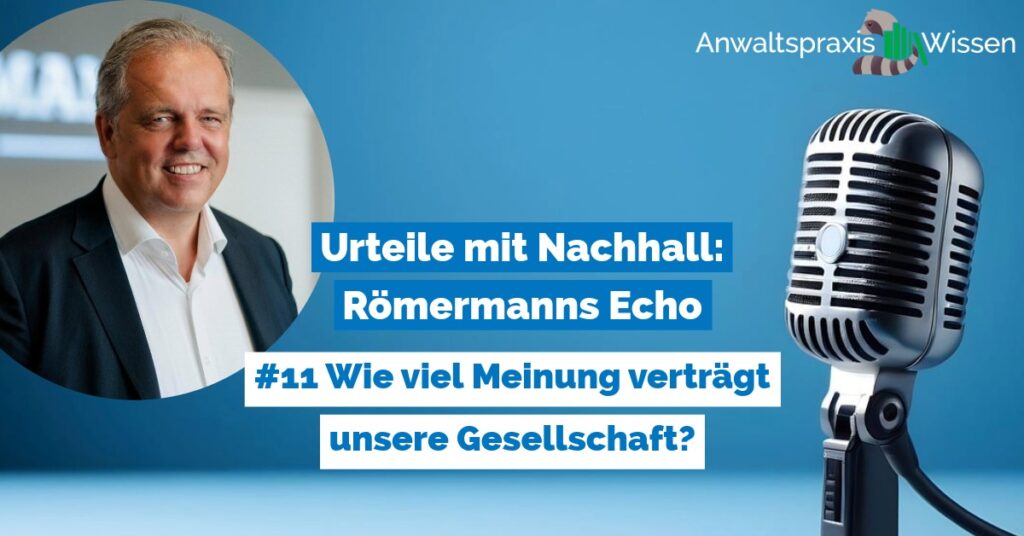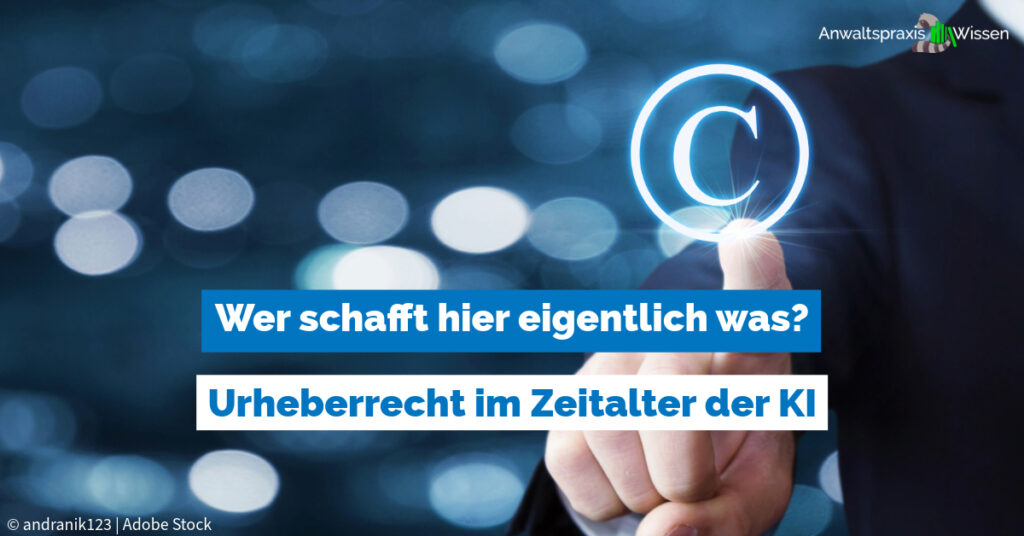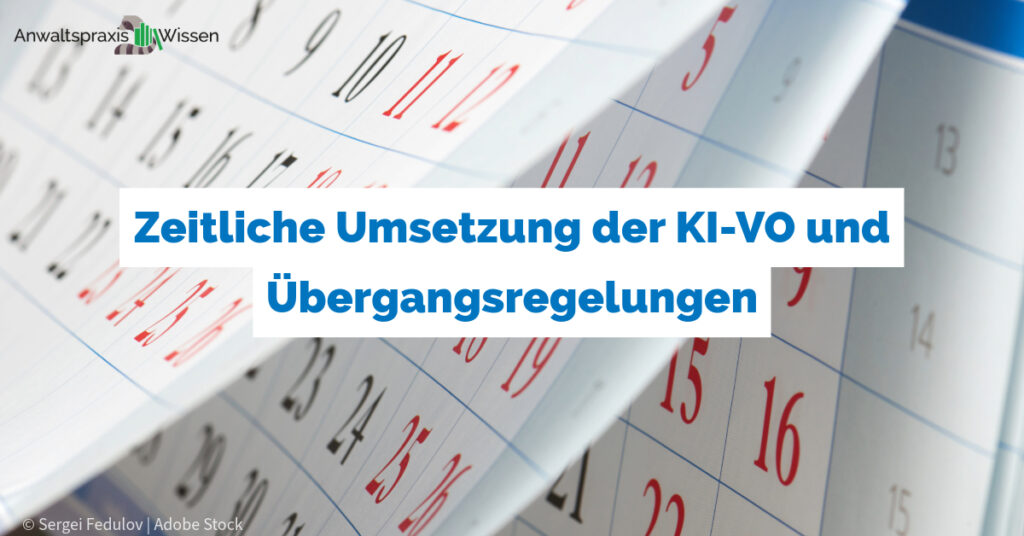Der Gesetzentwurf des Bundesjustizministeriums zur Neuordnung der Zuständigkeiten der Amts- und Landgerichte (s. dazu näher ZAP 2025, 676) hat bei den Berufsverbänden der Rechtsanwälte und Richter ein zwiespältiges Echo hervorgerufen. Zwar signalisierten diese grds. Zustimmung zum Vorhaben, die Amtsgerichte zu stärken; auch gab es keine Einwände dagegen, den Amts- und Landgerichten weitere Spezialzuständigkeiten zuzuweisen. Im Detail äußerten die Berufsvertreter aber eine Reihe von Änderungswünschen sowie die Mahnung, rechtzeitig Vorsorge für eine ausreichende, insb. personelle, Ausstattung der Amtsgerichte zu treffen. Die Bundesrechtsanwaltskammer zeigte sich darüber hinaus sogar teilweise verärgert über den Entwurf. Im Einzelnen:
Der kürzlich vorgelegte Referentenentwurf des Gesetzes zur Änderung der Zuständigkeitsstreitwerte sieht vor, die Streitwertgrenze für die sachliche Zuständigkeit der Amtsgerichte von bisher 5.000 € auf künftig 10.000 € zu erhöhen; darüber hinaus sollen bestimmte Spezialmaterien – wie das Heilbehandlungsrecht, das Vergaberecht sowie Veröffentlichungsstreitigkeiten – streitwertunabhängig den Landgerichten zugewiesen werden, um die Spezialisierung der Justiz zu stärken. Als Hauptgrund für die beabsichtigte Neuregelung führt das BMJ ins Feld, dass die letzte Anpassung der Streitwertgrenze im Jahr 1993 mittlerweile mehr als 30 Jahre zurückliegt und die zwischenzeitlich eingetretene Geldentwertung i.H.v. ca. 88 % zu einem starken Rückgang der Eingangszahlen bei den Amtsgerichten geführt hat. Die Berufsverbände Deutscher Richterbund (DRB), Deutscher Anwaltverein (DAV) und Bundesrechtsanwaltskammer (BRAK) sehen dies genauso; gegen die Anhebung der Streitwertgrenze gibt es von ihnen keine Einwände.
Sowohl der Deutsche Richterbund als auch die BRAK weisen allerdings warnend darauf hin, dass mit der Übertragung zusätzlicher Verfahren auf die Amtsgerichte bereits zum Stichtag 1.1.2026 ein „strukturell bedeutsamer Ausbau“ der personellen und sachlichen Ausstattung an den Gerichten vonnöten sein wird, der im Entwurf bislang nicht flankierend vorgesehen ist. Dass an den Landgerichten durch die Neuregelung Richterstellen frei würden, die auf die Amtsgerichte übertragen werden könnten, bestreitet der DRB in seiner offiziellen Stellungnahme zum Gesetzentwurf ganz entschieden: Die Landgerichte seien derzeit durch die kontinuierlich steigende Zahl in der Personalbedarfsberechnung „unzureichend bewerteter komplexer Strafsachen“ ohnehin überlastet. Darüber hinaus erfordere auch in Zivilsachen die Zunahme der Berufungen und die Bearbeitung der verbleibenden Verfahren angesichts der höheren Streitwerte einen höheren durchschnittlichen Bearbeitungsaufwand. Die Erwartung, so die Richtervertreter, dass die Reform zu einem Personalabbau bei den Landgerichten führen werde, sei daher verfehlt.
Die des Weiteren im Entwurf vorgesehenen streitwertunabhängigen Zuweisungen spezieller Sachgebiete an die Amts- und Landgerichte wird von den Berufsverbänden ebenfalls im Grundsatz positiv gesehen. Der Deutsche Richterbund sowie auch der Deutsche Anwaltverein wünschen sich über die vom BMJ avisierten Materien aber weitere Sachgebiete, die den Landgerichten zugewiesen werden sollten. Der DAV nennt vor allem das Bau- und Architektenrecht. Für diese Spezialmaterie, so der DAV, gebe es an den Landgerichten seit 2018 bundesweit spezialisierte Baukammern gem. § 72a GVG. Die Einrichtung dieser neuen Kammern sei aus gutem Grund erfolgt: Baustreitigkeiten seien regelmäßig durch eine hohe technische, wirtschaftliche und rechtliche Komplexität gekennzeichnet und erforderten besondere Erfahrung und Fachkenntnisse im Bau- und Architektenrecht. Die jetzt geplante Anhebung der Streitwertgrenze würde allerdings dazu führen, dass künftig zahlreiche Bau- und Architektensachen wieder von Amtsgerichten entschieden würden, die keine spezialisierten Spruchkörper für Bausachen hätten. Dies würde den erreichten Fortschritt konterkarieren und wäre zudem ein Rückschritt für die gewünschte Spezialisierung und Effizienz der Justiz. Auch der Deutsche Richterbund wünscht sich eine Ausweitung der Spezialzuweisungen; er verweist auf die Empfehlungen der Reformkommission „Zivilprozess der Zukunft“ (s. dazu auch ZAP 2025, 267), die angeraten hatte, die Sachgebietskategorien der §§ 72a, 119a GVG entsprechend den Fachanwaltsgebieten maßvoll zu erweitern. Auf diesen Gebieten seien bereits „hochspezialisierte Rechtsanwälte“ tätig, denen auch eine entsprechende Spezialisierung aufseiten der Gerichte gegenüberstehen sollte, so der DRB.
Auf Bedenken gegen weitere Spezialzuweisungen weist allerdings die BRAK hin. Die Schaffung weiterer streitwertunabhängiger Spezialzuständigkeiten müsse stets differenziert betrachtet werden, führt die Kammer in ihrer Stellungnahme an das BMJ aus. Damit werde nämlich punktuell eine Abkehr vom bislang streitwertzentrierten Zuständigkeitsmodell vorgenommen. Dies könne zwar der gewünschten Spezialisierung der Gerichte Rechnung tragen, was grds. zu begrüßen sei; gerade für rechtsunkundige Bürgerinnen und Bürger, die ohne anwaltliche Vertretung Rechtsschutz suchten, erhöhe sich durch derartige Spezialzuweisungen aber das Risiko, das sachlich oder örtlich zuständige Gericht fehlerhaft zu bestimmen. Hier bedürfe es deshalb flankierender Regelungen, die etwa durch eine fristwahrende Weiterleitung oder eine allgemeine Heilungsvorschrift verhindern könnten, dass Rechtsverluste allein aus Zuständigkeitsirrtümern entstünden.
Ausgesprochen verärgert zeigt sich die BRAK über die Ausführungen des BMJ im Gesetzentwurf, dass die Bürger eine finanzielle Entlastung von Anwaltskosten i.H.v. rund 14,5 Mio. € erwarten dürfen. Die „Bewerbung des Wegfalls von Anwaltskosten“ und damit von anwaltlicher Beratung und Vertretung zeuge von einem unzureichenden Verständnis für die Rolle und Bedeutung der Anwaltschaft im Rechtsstaat und ihrer Rechtsschutzzugang gewährenden Funktion, kritisiert die Kammer. Die Rolle einer unabhängigen Anwaltschaft in einem Rechtsstaat sowie mit Blick auf die Gewährung und Sicherung des Zugangs zum Recht, insb. für marginalisierte Gruppen, könne nicht auf einen bloßen Kostenposten reduziert werden (s. zur Kritik der BRAK auch die Kolumne von Fuhrmann, ZAP 2025, 721).
Aus diesen Gründen spricht sich die BRAK auch für eine Beibehaltung des Anwaltszwanges ab einem Streitwert von 5.000 € aus. Der Anwaltszwang sei „keine zwecklose Erfindung“, sondern diene gleichermaßen dem öffentlichen Interesse an einer geordneten Rechtspflege wie auch dem Interesse der Prozessparteien, so die Kammer. Ein Wegfall berge das Risiko verfahrensverzögernder Fehler, erhöhe mittelbar die Verfahrenskosten und könne zu einer stärkeren Belastung der Gerichte führen.
[Quellen: DRB/DAV/BRAK]