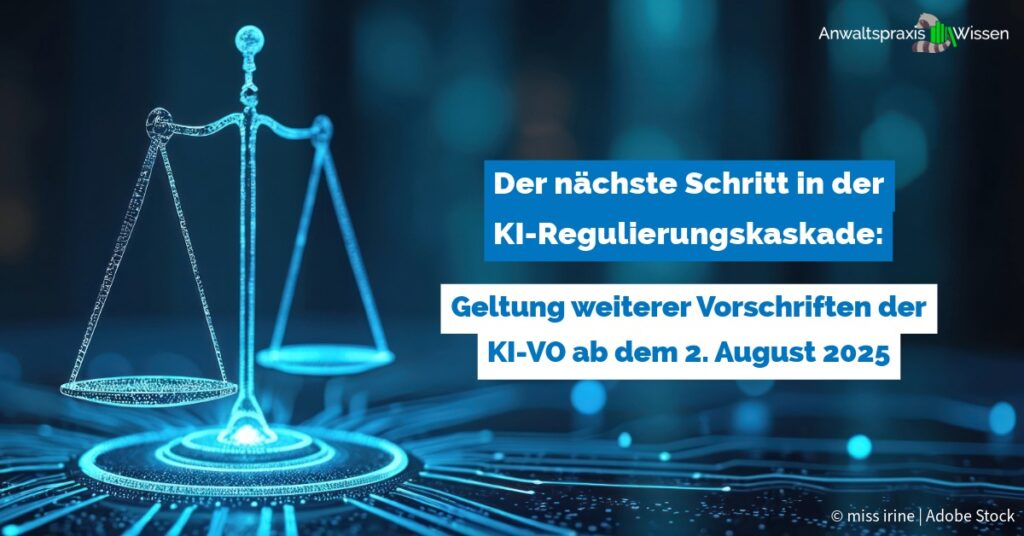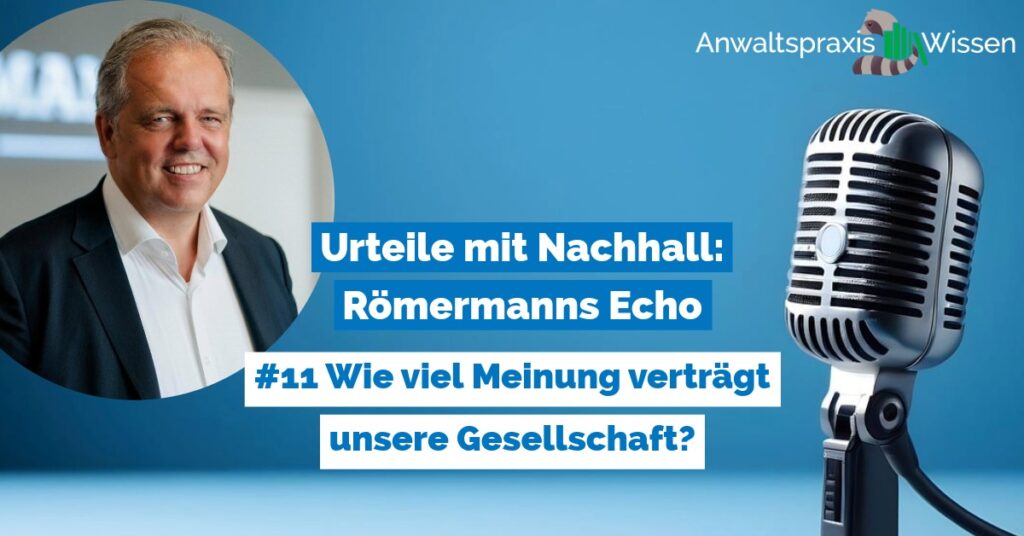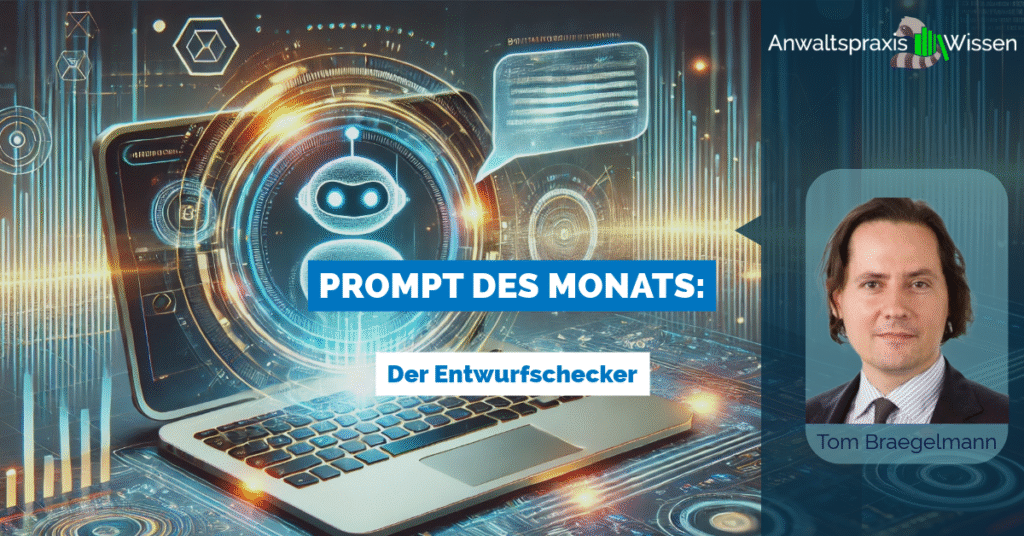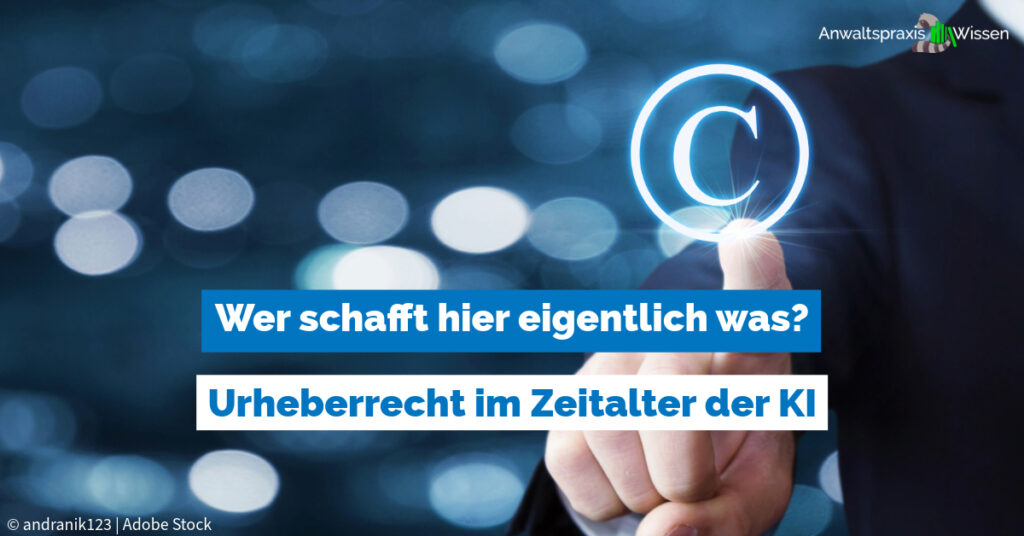Grundsätzlich ist bei einer Geschwindigkeitsmessung, wenn sich im Rahmen der Verfolgung der Verkehrsordnungswidrigkeit keine besonderen Anhaltspunkte auf Messfehler oder sonstige Unregelmäßigkeiten ergeben, die Einholung eines Sachverständigengutachtens nicht angebracht. Etwas anderes kann jedoch der Fall sein, wenn es sich um einen erheblichen Verkehrsverstoß gehandelt hat und die Messunterlagen nicht vollständig waren. (Leitsatz des Verfassers)
I. Sachverhalt
Verfahren wegen einer Geschwindigkeitsüberschreitung
Gegen den Betroffenen war ein Bußgeldverfahren wegen einer Geschwindigkeitsüberschreitung anhängig. Durch den Bußgeldbescheid waren eine Geldbuße von 400,00 EUR sowie ein einmonatiges Fahrverbot verhängt worden. Ferner wurde die Tat mit zwei Punkten im Fahreignungsregister bewertet.
Nach Einlegung des Einspruchs durch den Betroffenen hat am AG das gerichtliche Verfahren stattgefunden. Die Hauptverhandlung wurde zweimal ausgesetzt, bevor das Verfahren schließlich wegen Verjährung eingestellt worden ist. Die Kosten des Verfahrens und die notwendigen Auslagen des Betroffenen sind der Staatskasse auferlegt worden.
AG setzt SV-Kosten nicht fest
Der Verteidiger hat mit seinem Kostenfestsetzungsantrag u.a. auch die Aufwendungen in Höhe von 1.655,94 EUR brutto für ein außergerichtlich eingeholtes Sachverständigengutachten geltend gemacht. Das AG hat diese nicht festgesetzt. Die sofortige Beschwerde des Verteidigers hatte vollen Erfolg.
II. Entscheidung
Sachverständigenkosten ausnahmsweise erstattungsfähig
Zu Recht gehe der Verteidiger davon aus, dass für eine effektive Verteidigung die Einholung eines privaten Sachverständigengutachtens notwendig gewesen sei. In erster Instanz habe er bereits vorgetragen, dass dies verfassungsrechtlich aus Gründen der „Waffengleichheit“ auch im Ordnungswidrigkeitenverfahren notwendig sei.
Zwar seien, so das AG, nach herrschender Auffassung eigene private Ermittlungen in der Regel nicht notwendig, was auch für die Kosten von Privatgutachten gelte (OLG Stuttgart NStZ-RR 2003, 127; Meyer-Goßner/Schmitt, Kommentar zur StPO, 67. Aufl. 2024, § 464a Rn 16 m.w.N.; KK-StPO/Gieg, 9. Aufl. 2021, § 464a Rn 7). Dies werde damit begründet, dass die Ermittlungsbehörden und das Gericht von Amts wegen zur Sachaufklärung verpflichtet seien. Eine Ausnahme gelte aber u.a. bei komplizierten technischen Fragen, z.B. wegen eines etwaigen Informationsvorsprungs der Staatsanwaltschaft im Interesse einer effektiven Verteidigung (OLG Hamburg NStZ 1983, 284; OLG Köln NJW 1992, 586; OLG Celle JurBüro 1994, 297; KK-StPO/Gieg, a.a.O.).
Nach Ansicht des G dürfe ein Privatgutachten nicht ohne triftigen Grund in Auftrag gegeben worden sein. Wenn sich bei einer Geschwindigkeitsmessung im Rahmen der Verfolgung einer Verkehrsordnungswidrigkeit keine besonderen Anhaltspunkte auf Messfehler oder sonstige Unregelmäßigkeiten ergeben, sei die Einholung eines solchen Gutachtens daher nicht angebracht. Im vorliegenden Fall habe aber der Bußgeldbescheid für den Betroffenen eine nicht unerhebliche Sanktion dargestellt. Gegen ihn sei eine für Verkehrsordnungswidrigkeiten relativ hohes Geldbuße in Höhe von 400,00 EUR verhängt worden. Außerdem sei das ihm vorgeworfene Verhalten mit zwei Punkten im Fahreignungsregister bewertet worden. Am schwersten habe jedoch das verhängte einmonatige Fahrverbot gewogen. Dazu habe der Betroffene nachvollziehbar vorgetragen, dass ein solches für ihn schwerwiegende berufliche Nachteile gebracht hätte.
Insofern sei es gerechtfertigt, dass der Betroffene durch seinen Verteidiger eine besonders genaue und eingehende Prüfung der Geschwindigkeitsmessung veranlasst habe. Da die Messunterlagen nicht vollständig gewesen seien, habe er im Rahmen seiner Verteidigung darlegen müssen, welche Unterlagen zur Prüfung einer Messung unbedingt erforderlich gewesen seien. Im Verlaufe des Verfahrens sei es auch um die technische Frage der Größe des Messfeldes und der Rohmessdaten gegangen. Da weder der Betroffene noch sein Verteidiger die erforderliche Sachkunde hatten, habe der Betroffene völlig zu Recht ein privates Sachverständigengutachten eingeholt. Im Termin vom 8.6.2022 habe der Verteidiger des Betroffenen die Einholung des Gutachtens bestätigt und dieses im Beschwerdeverfahren auch vorgelegt. Es komme nicht darauf an, ob das private Gutachten verwertet werden konnte oder musste. Vorliegend sei das Verfahren zwar wegen Verjährung durch Urt. v. 19.1.2023 eingestellt. Entscheidend sei aber, ob der Betroffene bereits im Rahmen des Ermittlungsverfahrens die Einholung eines Privatgutachtens für erforderlich halten durfte. Dies sei aus den genannten Gründen der Fall.
Da die Höhe der Kosten sachlich und rechnerisch nicht zu beanstanden waren, hat das LG diese zusätzlich festgesetzt.
III. Bedeutung für die Praxis
Weitgehend zutreffend
Den Ausführungen des LG zur Erstattungsfähigkeit der Kosten für das private Sachverständigengutachten ist nichts hinzuzufügen. Sie treffen so in einer Vielzahl von Bußgeldverfahren zu (vgl. auch noch LG Dessau-Roßlau, Beschl. v. 4.5.2023 – 6 Js 394 Js 26340/21 (56/23), AGS 2023, 496 m.w.N.; LG Wuppertal, Beschl. v. 8.2.2018, DAR 2018, 236 = RVGreport 2019, 71; LG Aachen, Beschl. v. 12.7.2018 – 66 Qs 31/18, RVGreport 2019, 71). Ob allerdings der allgemeine Ansatz des LG zutrifft, dass die Aufwendungen für ein privates Sachverständigengutachten in der Regel nicht erstattungsfähig sein sollen – was allerdings der wohl h.M. in der Rechtsprechung entspricht – kann dahinstehen. Denn darauf kam es hier aus den vom LG zutreffend dargelegten Gründen nicht an. Wegen der weiteren Einzelheiten zu den Fragen verweise ich auf Burhoff AGS 2023, 193 ff.
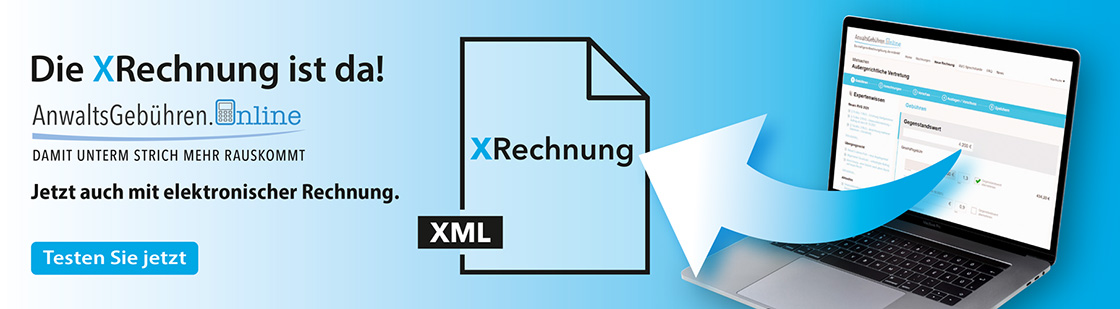



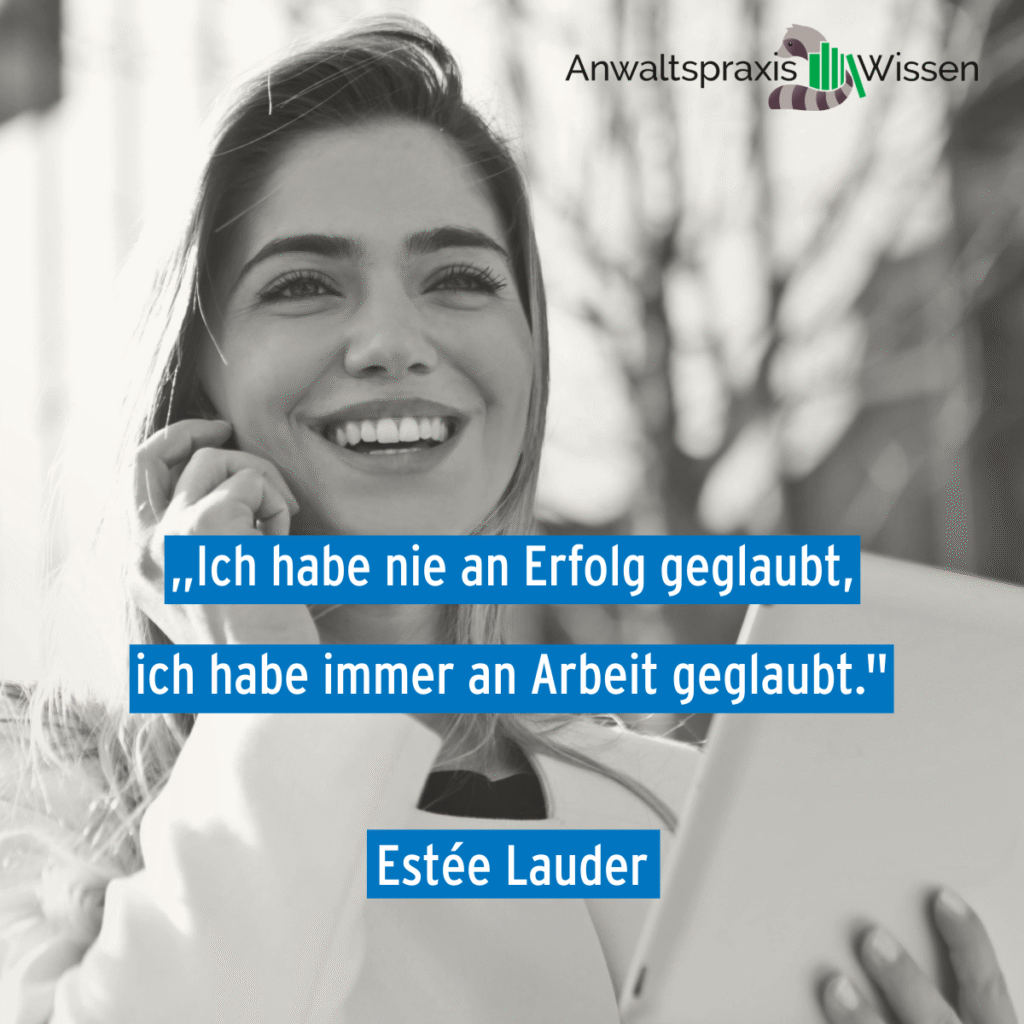

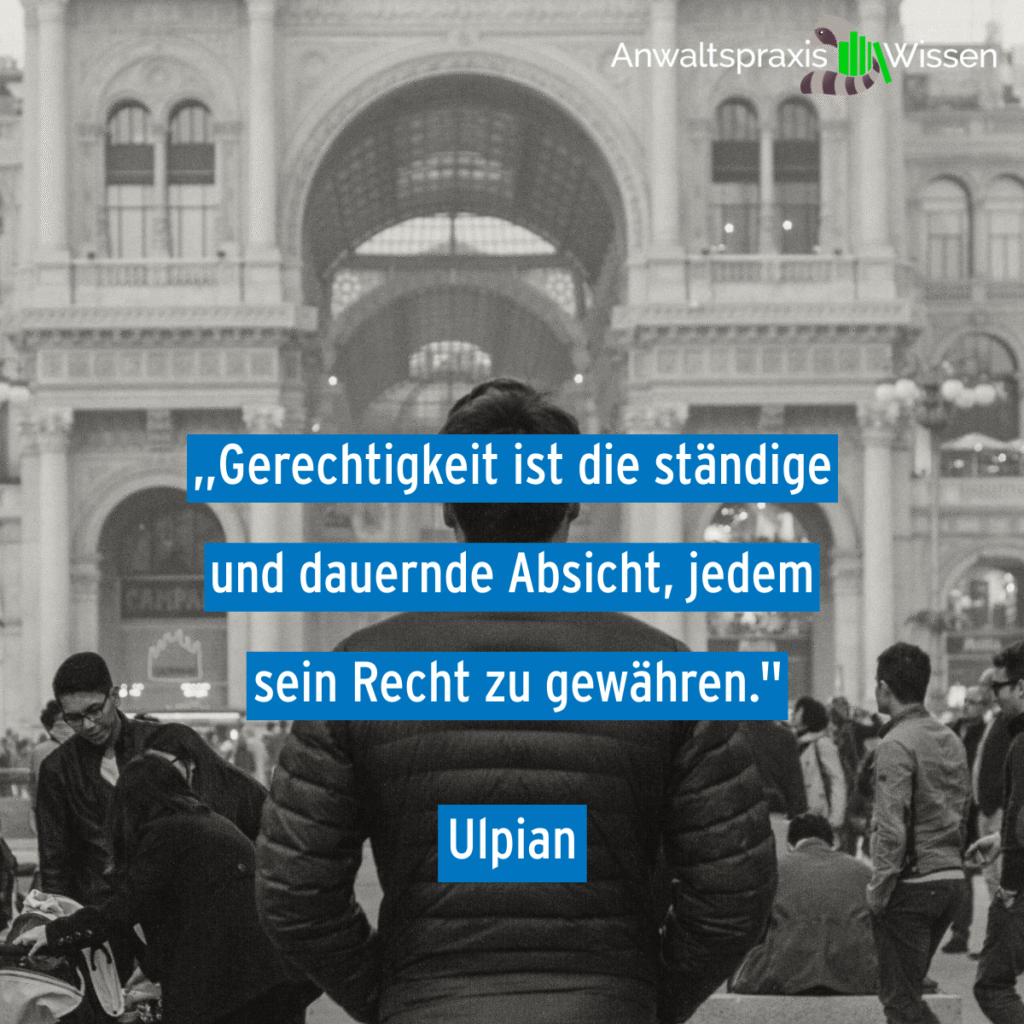

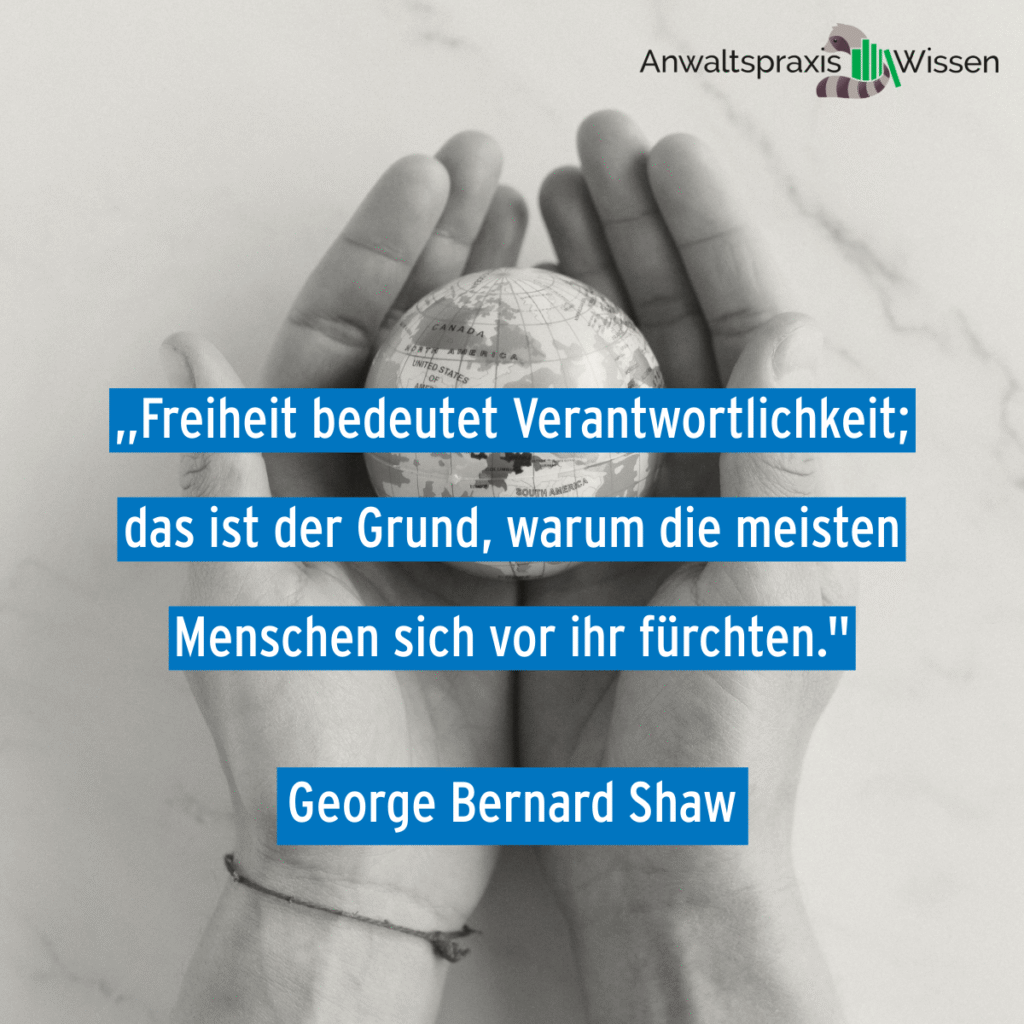

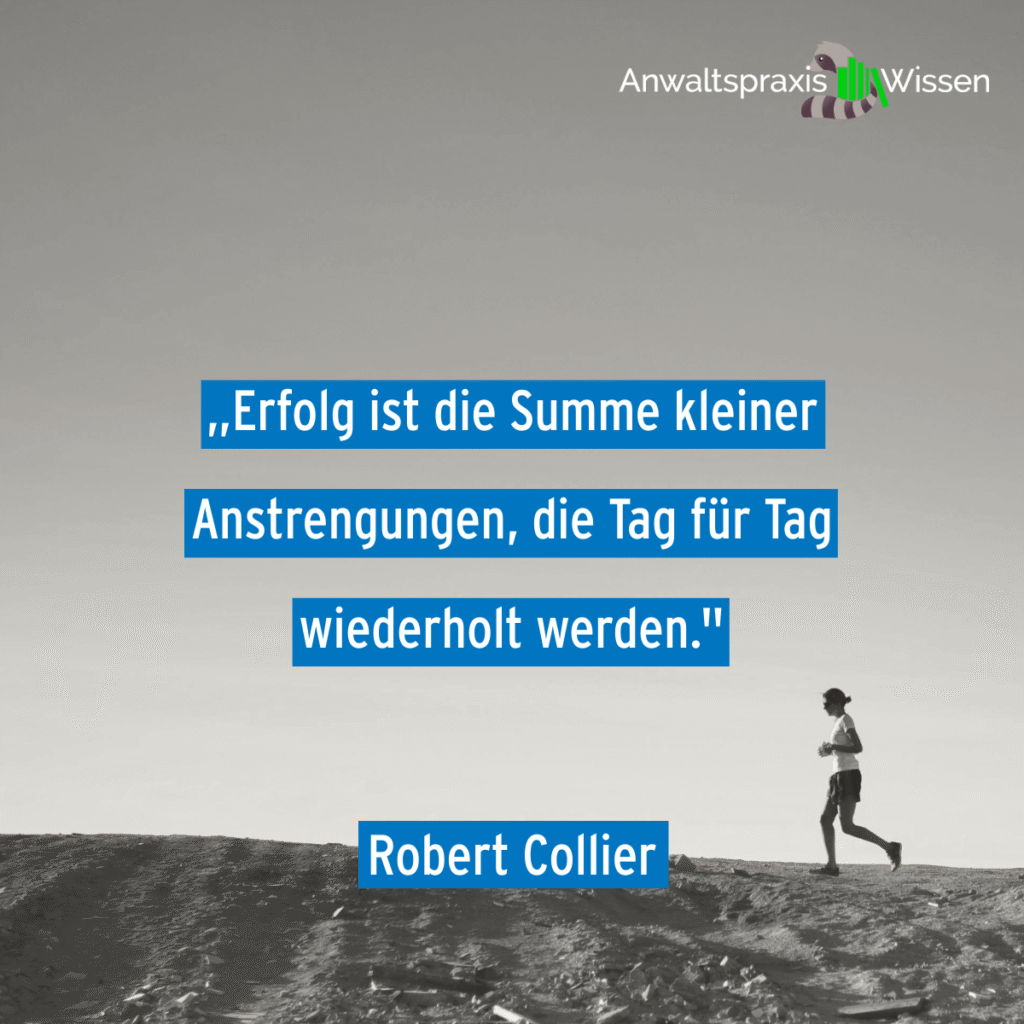



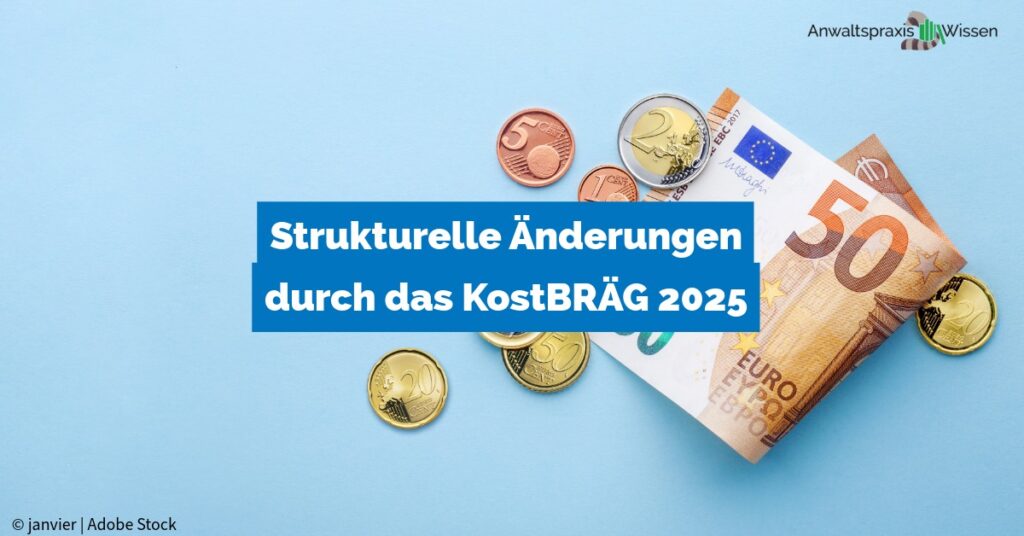

![Erbrecht im Gespräch: Kurze[s] Update: #19 Bestattungsrecht – mit Dr. Bernd Schmalenbach](https://anwaltspraxis-magazin.de/wp-content/uploads/2025/09/Erbrecht-im-Gespraech-19-1024x536.jpeg)