Die EU-Mindestlohn-Richtlinie steht derzeit auf der Kippe: sie könnte in Kürze vom EuGH für nichtig erklärt werden. Dort wird derzeit eine Klage Dänemarks (Rs. C-19/23) verhandelt, das sich der Verpflichtung zur Umsetzung der darin enthaltenen Vorgaben nicht beugen möchte. Das Land ist nämlich der Auffassung, dass die Richtlinie nicht von den EU-Verträgen gedeckt ist, weil sie zu tief in nationale Rechtssetzungsbefugnisse eingreift.
Zum Hintergrund: 2020 hatte die neu ernannte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen unter Hinweis auf die Bedeutung von Arbeit und Arbeitseinkommen für die Menschen bekanntgegeben, dass sie sich für ein gesetzliches Rahmenwerk zur Festlegung von Mindestlöhnen in der EU stark machen wolle. Zwar gab es in einigen Mitgliedstaaten bereits nationale Regelungen zu Mindestlöhnen; in vielen Ländern existierten aber lediglich Branchentarifverträge, die Rechtslage in der EU war deshalb zersplittert und unübersichtlich. Wie von der Leyen ankündigte, wolle sie „innerhalb der ersten 100 Tage ihrer Amtszeit“ ein Regelwerk vorlegen, das sicherstelle, dass „jeder Arbeitnehmer in unserer EU Anspruch auf einen fairen Mindestlohn“ bekomme. 2022 wurde dann tatsächlich eine entsprechende Richtlinie (Richtlinie EU 2022/2041) verabschiedet, zu deren Umsetzung die Mitgliedstaaten zwei Jahre Zeit haben sollten. In der’Richtlinie wird zwar kein gemeinsames Mindestlohn-Niveau vorgegeben; vorgeschrieben ist aber, wie gesetzliche Mindestlöhne von den Staaten festgesetzt und durchgesetzt werden; zudem werden diese u.a. verpflichtet, Aktionspläne aufzustellen, um die Tarifbindung zu steigern.
Mit diesen Vorgaben ist Dänemark nicht einverstanden und zog – unterstützt von Schweden – vor den EuGH. Der Klageantrag lautet, die gesamte Richtlinie für nichtig zu erklären, hilfsweise zwei der Einzelbestimmungen für unvereinbar mit höherrangigem EU-Recht zu erklären. Begründung: Die Union sei durch die Verträge zwar ermächtigt, durch Richtlinien Mindestvorschriften im Bereich der Arbeitsbedingungen festzulegen (Art. 153 Abs. 2 AEUV i.V.m. Art. 153 Abs. 1 AEUV); jedoch erstrecke sich diese Zuständigkeit gem. Art. 153 Abs. 5 AEUV ausdrücklich nicht auf das Arbeitsentgelt. Dessen Festlegung sollte den nationalen Gesetzgebern bzw. den jeweiligen Tarifvertragsparteien überlassen bleiben.
Dieser Argumentation hat sich jetzt der Generalanwalt Athanasios Emiliou in seinen Schlussanträgen angeschlossen. In diesem Gutachten für die Richter des EuGH empfiehlt er, dem Hauptantrag Dänemarks stattzugeben und die gesamte Richtlinie zu kippen. Auch er ist der Auffassung, dass der Ausschluss von Regelungen über das Arbeitsentgelt in Art. 153 Abs. 5 AEUV sich nicht nur auf die Lohnhöhe selbst, sondern auch auf die Rahmenbedingungen der Entgeltbestimmung erstreckt. Die neue Richtlinie habe gerade auch die Festsetzung und Angemessenheit von Mindestlöhnen geregelt und damit direkt in die nationalen Befugnisse eingegriffen. Damit habe die EU zudem gegen das Prinzip der begrenzten Einzelermächtigung aus Art. 5 Abs. 2 AEUV verstoßen.
Ob der EuGH diesen Empfehlungen seines Generalanwalts folgt, wird sich in einigen Monaten zeigen; in der Vergangenheit haben sich die Richter in den meisten Fällen den Gutachten der Generalanwälte angeschlossen. Welche Auswirkungen eine Nichtigerklärung der Mindestlohn-Richtlinie für die EU haben würde, wird derzeit uneinheitlich beurteilt. In Deutschland beispielsweise gibt es ein Mindestlohngesetz schon seit 2014. Dieses erfüllt bereits die meisten Forderungen der EU-Richtlinie und beinhaltet zudem mit die höchsten Mindestlohnvorgaben in der EU. Noch nicht erreicht hat Deutschland allerdings die in der Richtlinie genannten Zielwerte von 50 % des durchschnittlichen bzw. 60 % des mittleren Lohns. Ebenfalls ist man hierzulande noch weit davon entfernt, die Vorgabe von 80 % Tarifbindungsquote zu erreichen; nach den Erhebungen des Statistischen Bundesamts ist Deutschland bei der Tarifbindung schon vor Jahren unter die 50 %-Marke gerutscht und der Trend ist weiter rückläufig. Sollte die Richtlinie fallen, wären künftige Bundesregierungen nicht mehr an diese Zielvorgaben gebunden.
[Quelle: EuGH]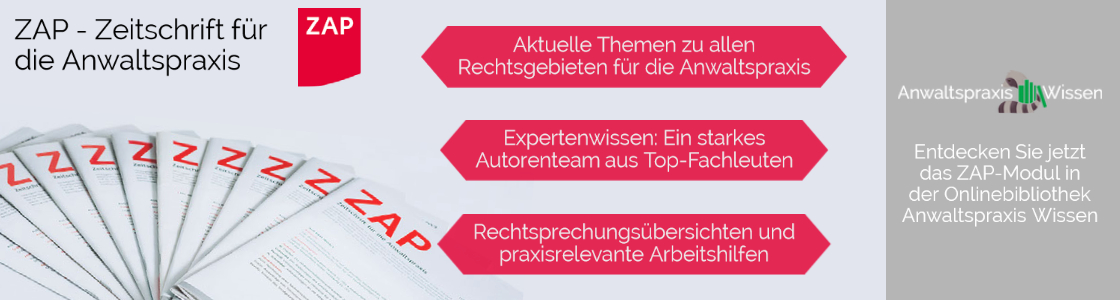
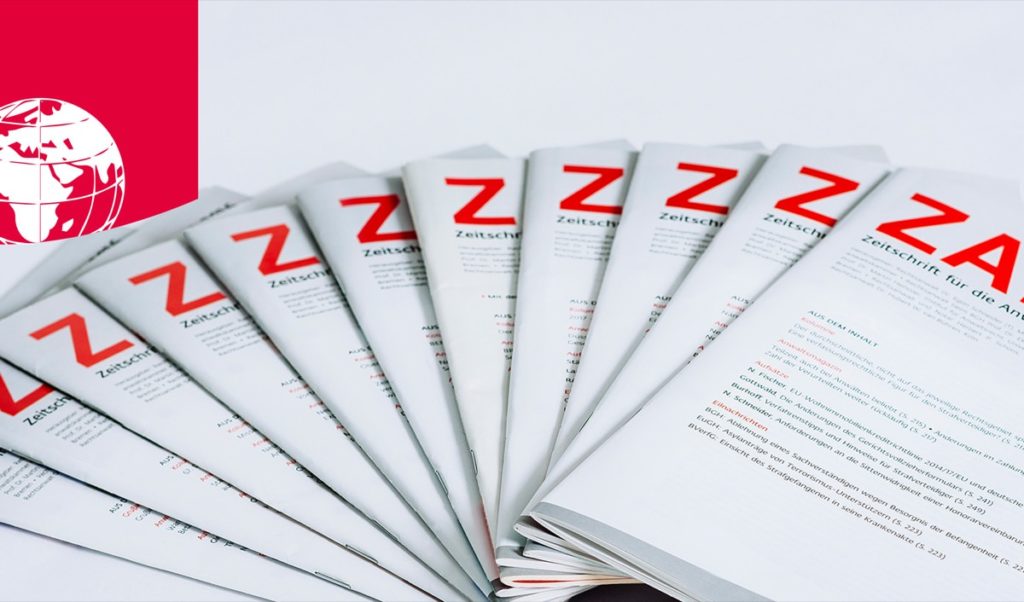
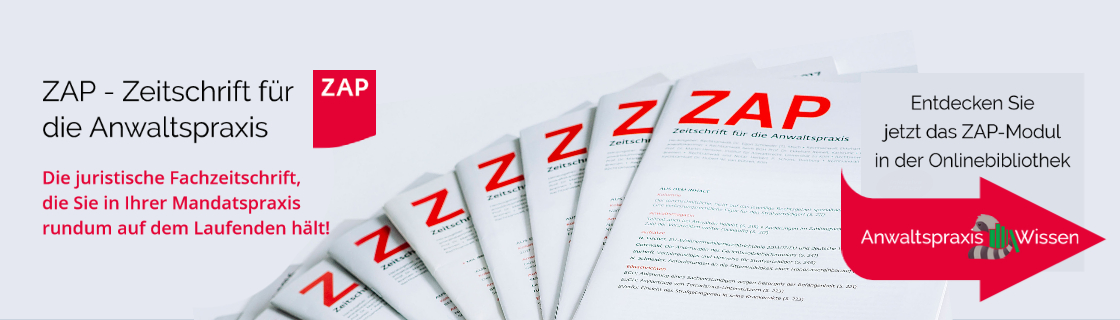


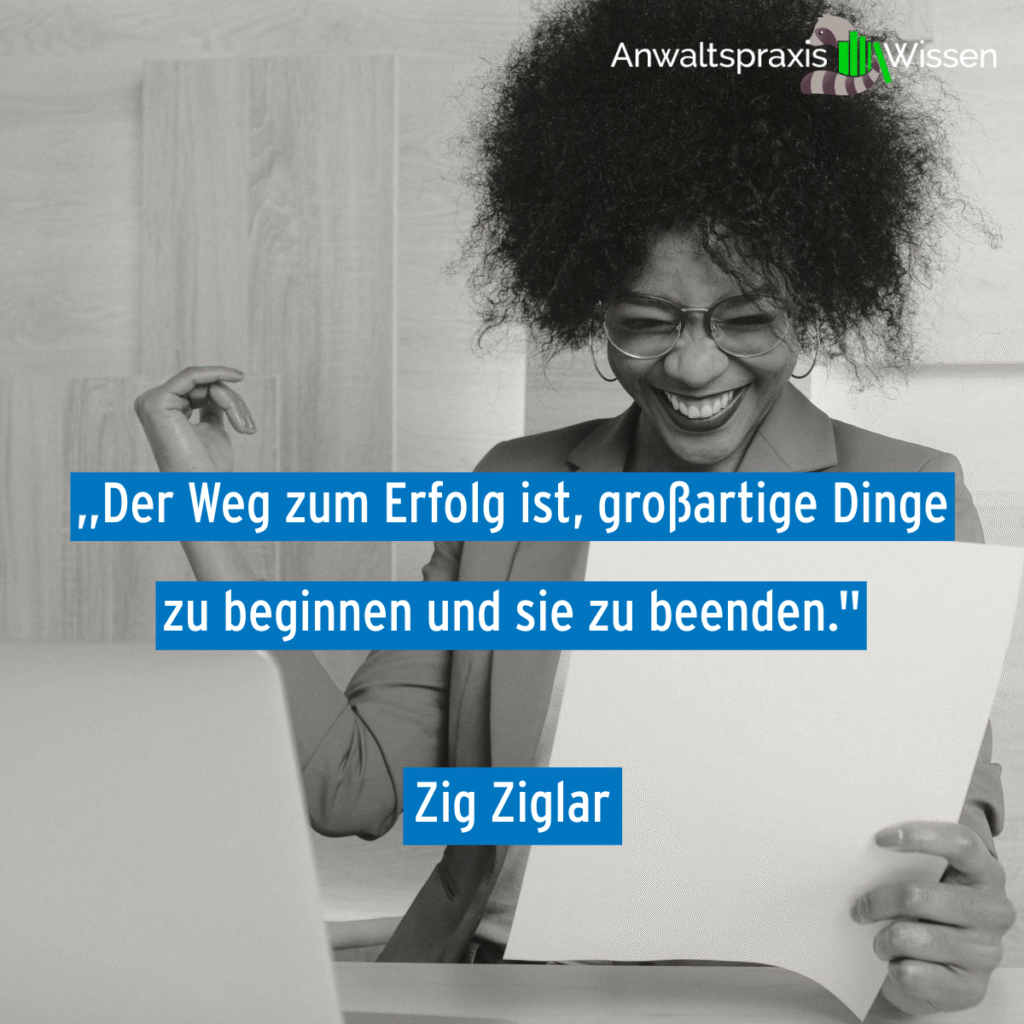

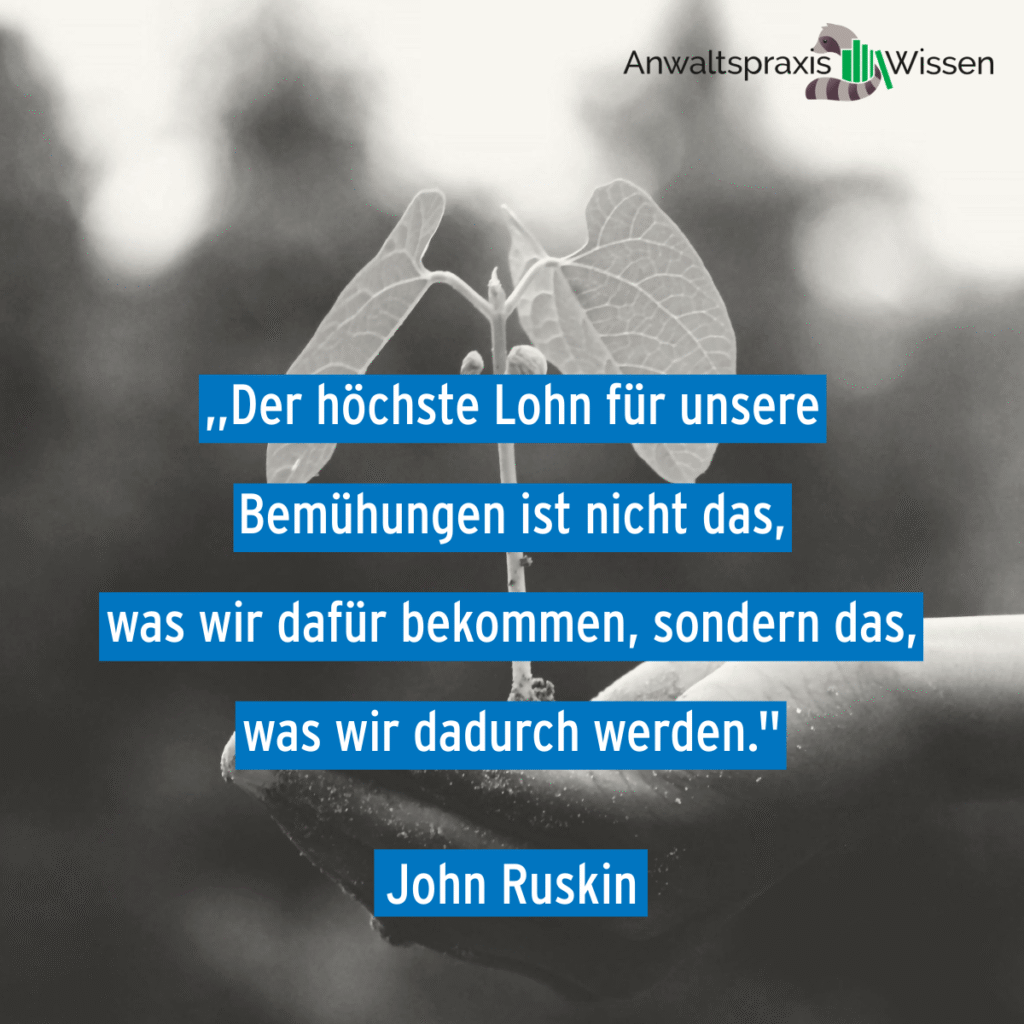

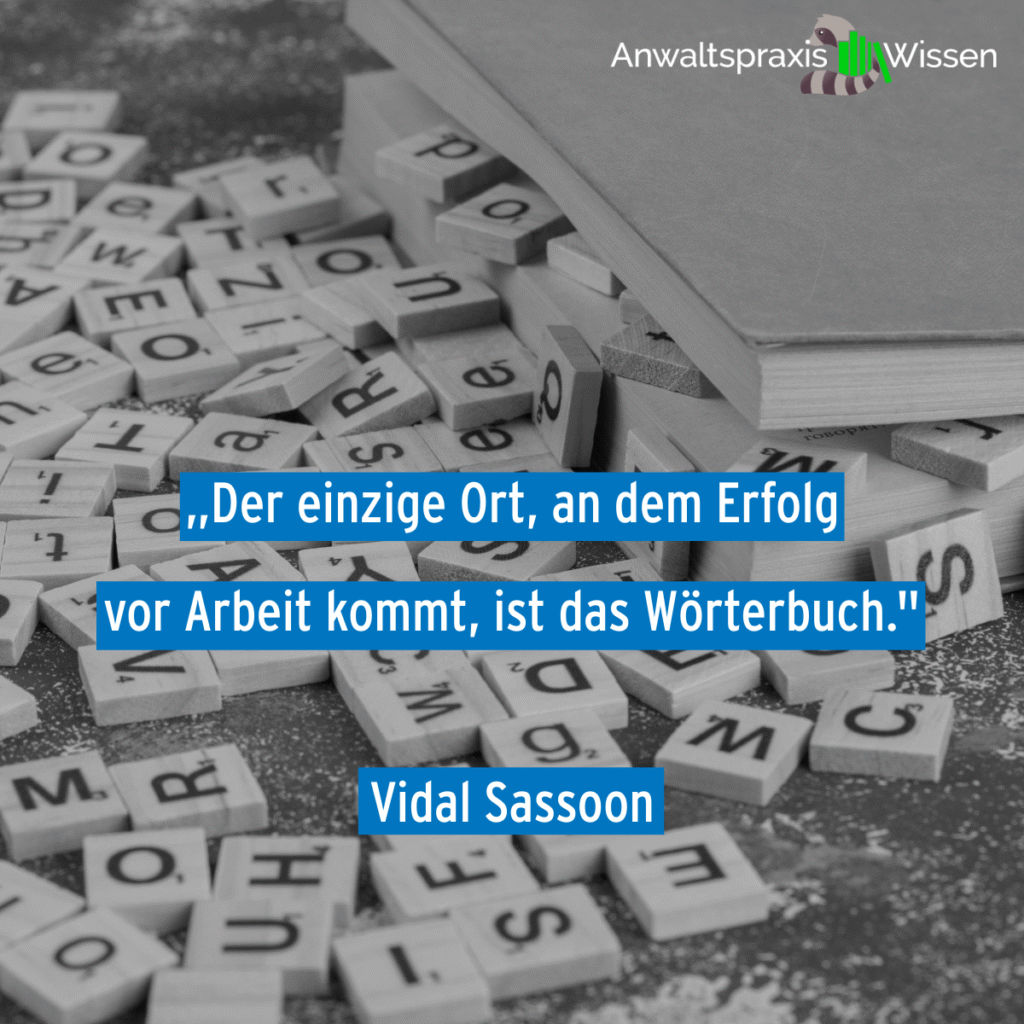
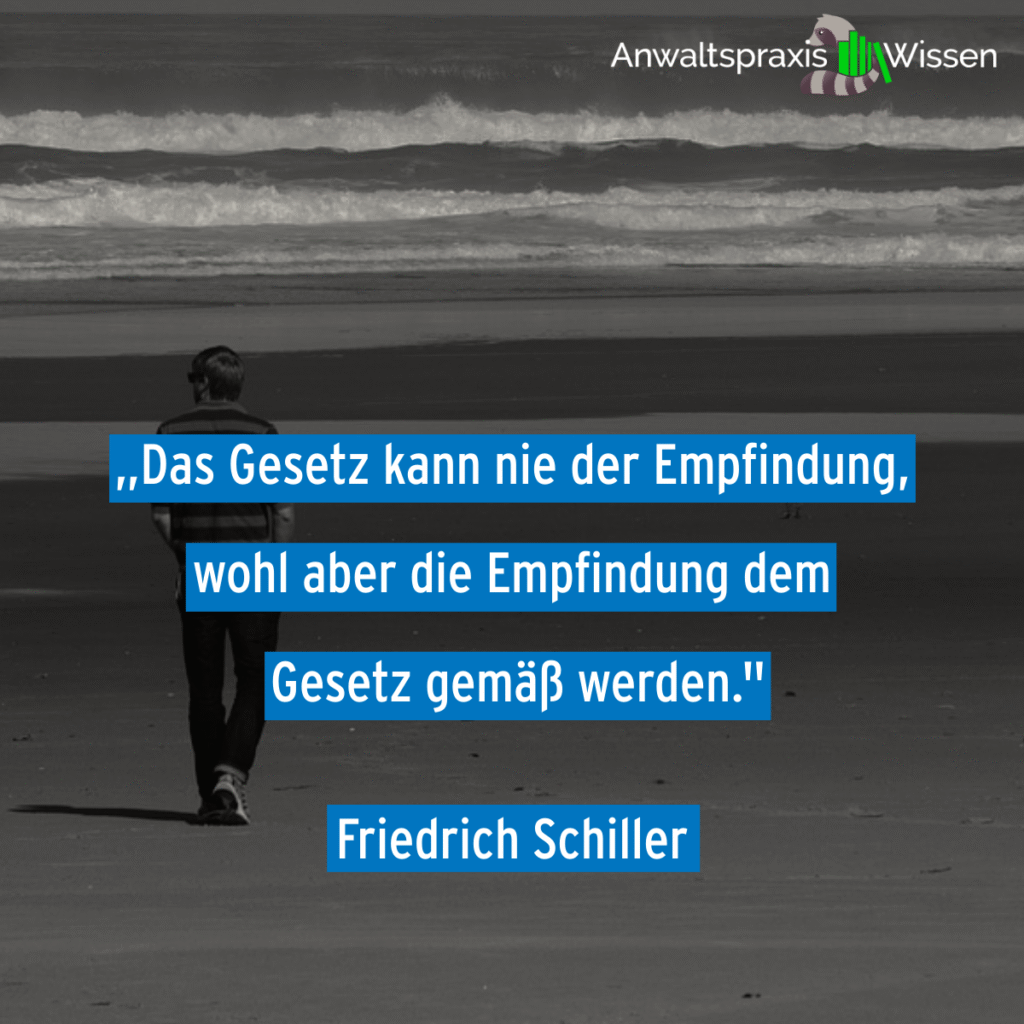
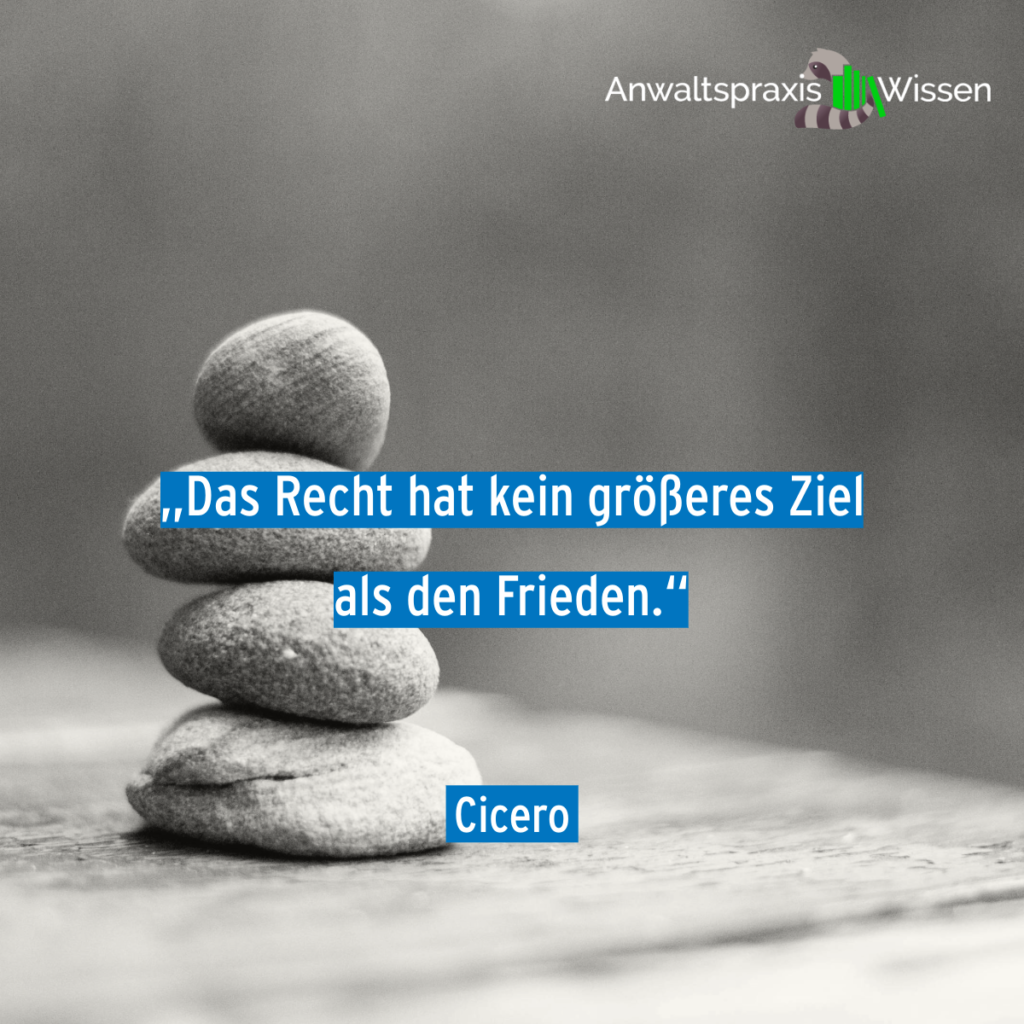

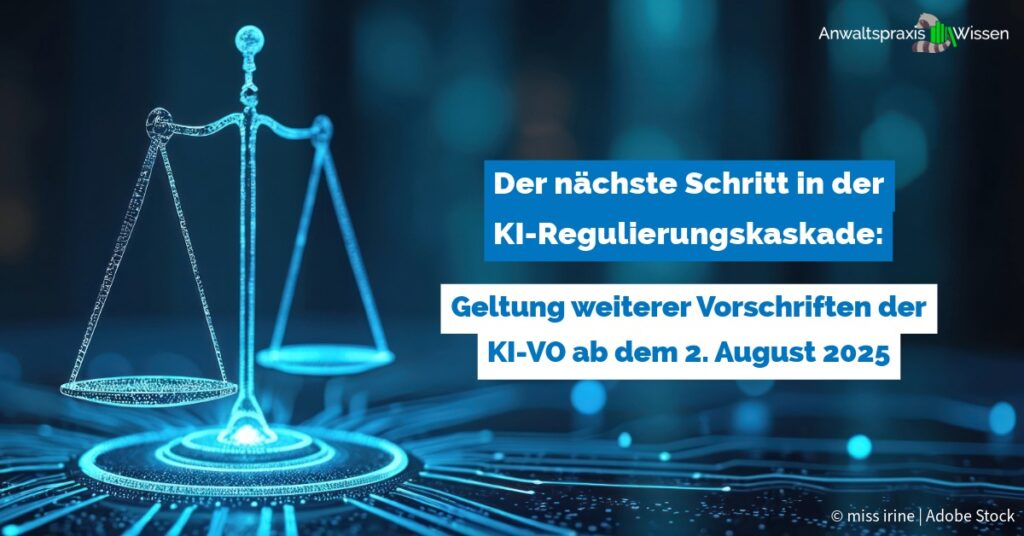
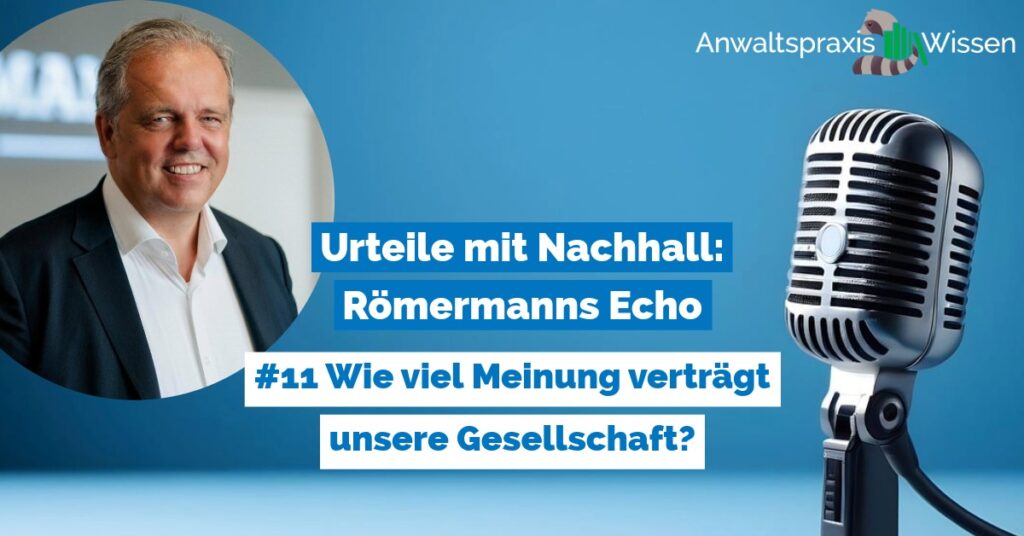
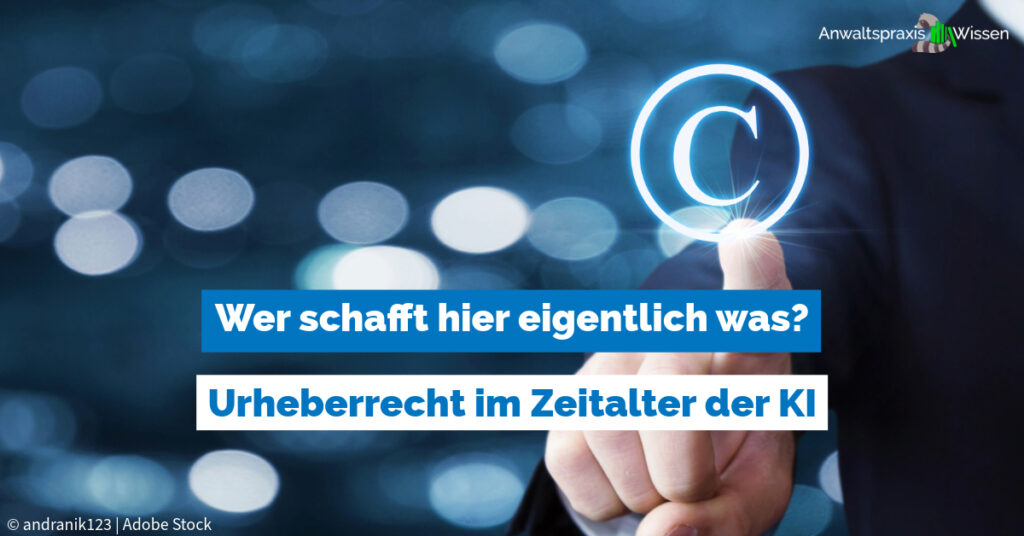

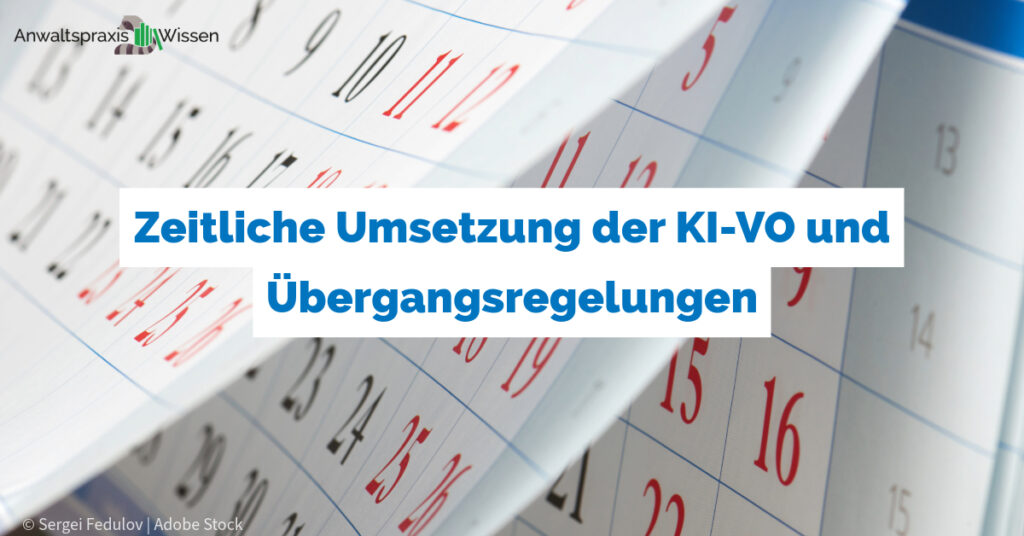




![Erbrecht im Gespräch: Kurze[s] Update: #15 Die Rechte des Erben vor dem Erbfall – mit Walter Krug](https://anwaltspraxis-magazin.de/wp-content/uploads/2025/05/Erbrecht-im-Gespraech-15-1024x536.jpeg)