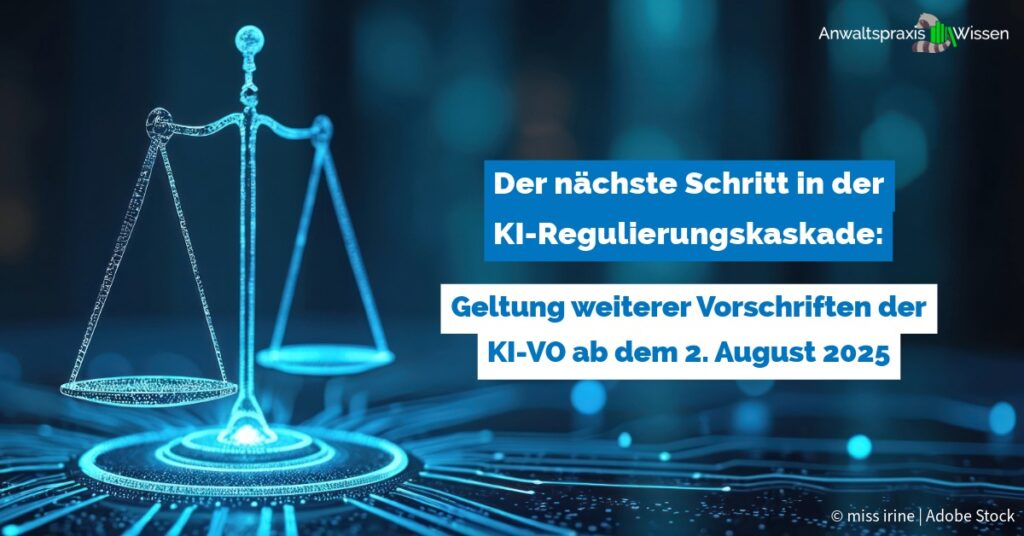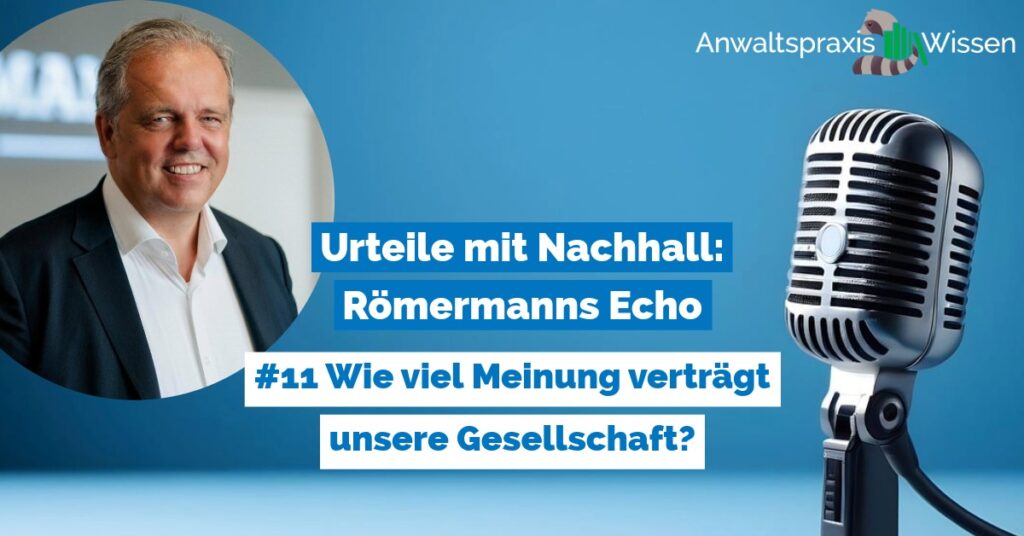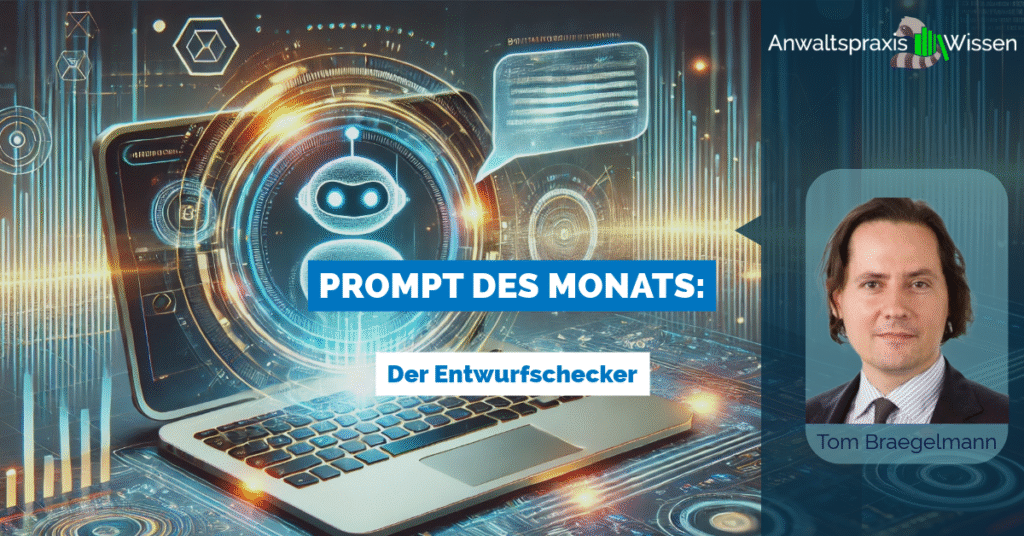„Sie müssen am Verhandlungstag persönlich anwesend sein.“ Auf den ersten Blick wirken solche Sätze korrekt und verbindlich, tatsächlich steckt darin aber eine unnötige Doppelung (anwesend ist man schließlich immer persönlich). Die Sprachwissenschaft nennt das Pleonasmus. Er ist im juristischen Alltag allgegenwärtig, nützlich ist er jedoch selten.
„Pleonasmus? Was ist das nun schon wieder? Immer diese Fremdwörter!“ höre ich Sie sagen. Und ich ahne es: Vermutlich haben Sie die Wendung „persönlich anwesend“ schon oft benutzt und niemand hat sich daran gestört. „Es steht ja sogar im Gesetz (vgl. § 450 Abs. 1 S. 2 ZPO)! Wo ist also das Problem?“
Es geht um sprachliche Feinheiten, vielleicht auch Pedanterie. Doch ein gewisses sprachliches Differenzierungsvermögen ist in der Juristerei unabdingbar. Also, lesen Sie ruhig weiter und lassen Sie sich auf etwas Wortklauberei ein. In wenigen Minuten wissen Sie alles!
Pleonasmus – was ist das?
Pleonasmus bezeichnet die unnötige Doppelung von Informationen innerhalb einer Wortverbindung.
Beispiele:
runde Kugel, persönliche Meinung, weißer Schimmel, alter Greis, von Bäumen gesäumte Allee, natürlicher Instinkt, anfängliche Startprobleme, Haifisch, es mit eigenen Augen sehen
Ihre Gemeinsamkeit? Das beigefügte Adjektiv ist überflüssig, denn es liefert keine ergänzenden Informationen. Es ist die bloße Wiederholung von Eigenschaften des Substantivs. Quasi Wortreichtum ohne zusätzlichen Informationsgewinn.
Feine Unterschiede: Abgrenzung zur Tautologie
Die Tautologie ist dem Pleonasmus recht ähnlich. Doch es werden nicht bloß die Eigenschaften wiederholt, sondern zwei sinngleiche Wörter (oft Synonyme) kombiniert.
Beispiele:
immer und ewig, Angst und Bange, nie und nimmer, voll und ganz, ganz und gar, leise und geräuschlos, null und nichtig, Hab und Gut, hegen und pflegen
Eine Tautologie dient meist dazu, eine Aussage besonders zu betonen. „Das tut mir nicht gut.“, findet z. B. eine Verstärkung durch die Formulierung „Das tut mir ganz und gar nicht gut.“
Tautologien aus dem Rechtsbereich sind meist veraltete Begrifflichkeiten wie beispielsweise
null und nichtig
Hab und Gut
recht und billig
Fug und Recht
Grund und Boden
Gedeih und Verderb
Sitte und Anstand
Manchmal kann zwischen Pleonasmus und Tautologie gar nicht klar getrennt werden. Teils werden diese Begriffe auch synonym verwendet, doch Sie haben nun gelernt, fein(er) zu differenzieren.
Juristen lieben Doppelungen
„Vollumfänglich“, „persönlich anwesend“, „Schlussfolgerung am Ende“ – Juristen lieben Pleonasmen. Wenn sie unbewusst eingestreut werden, sind es Stilfehler. In Kanzleitexten passiert das schnell, wenn etwa Textbausteine oder alte Vorlagen unreflektiert übernommen werden („So formulieren wir das schon seit Jahren und es hat niemanden gestört.“). Präziser werden die Aussagen durch solche Doppelungen jedoch nicht.
Ausnahmen sind selten. Einige nutzen Pleonasmen ganz bewusst als Stilmittel zur Betonung einer Aussage, als verstärkendes Element in einem pointierten Text oder zur Kennzeichnung von Ironie. Gerade in Schriftsätzen oder anwaltlicher Korrespondenz sollte ihr Einsatz jedoch gut abgewogen werden, um nicht unnötig zu provozieren oder Missverständnisse zu fördern.
Praxistipps für den Alltag: Warum Streichen oft die bessere Wahl ist
Im Anwaltsalltag zählen Genauigkeit und korrekter Stil, aber nicht, wie sehr ein Satz mit sprachlichem Zuckerguss überzogen ist. Um Doppelungen in Ihren Texten nicht zu übersehen, können Sie folgendermaßen vorgehen:
- Text laut und aufmerksam vorlesen: Pleonasmen fallen beim Sprechen auf.
- Wortpaar prüfen: Informiert das zweite Wort über etwas Neues oder wiederholt es bloß die Information? Dann streichen Sie es.
Prüfen Sie auch bestehende Vorlagen. Viele Formulierungen stammen noch aus älteren Mustern. Überarbeiten Sie Ihre Textbausteine.
Haben Sie den Mut zur Streichung. Ihr Text verliert nicht an Autorität, wenn er schlanker wird.
Denken Sie mandantenfreundlich. Klare, knappe Sprache wird schneller verstanden, wirkt serviceorientiert und oftmals überzeugender.
Pleonasmen sind nicht per se schlecht, aber auch nicht neutral. Wer sie bewusst einsetzt, kann vereinzelt Akzente setzen. Unbewusst verwendet, verschenken sie Wirkung. Am Ende überzeugt nicht die Fülle der Wörter, sondern glasklare (!) Argumentation. Im Zweifel gilt: Streichen!



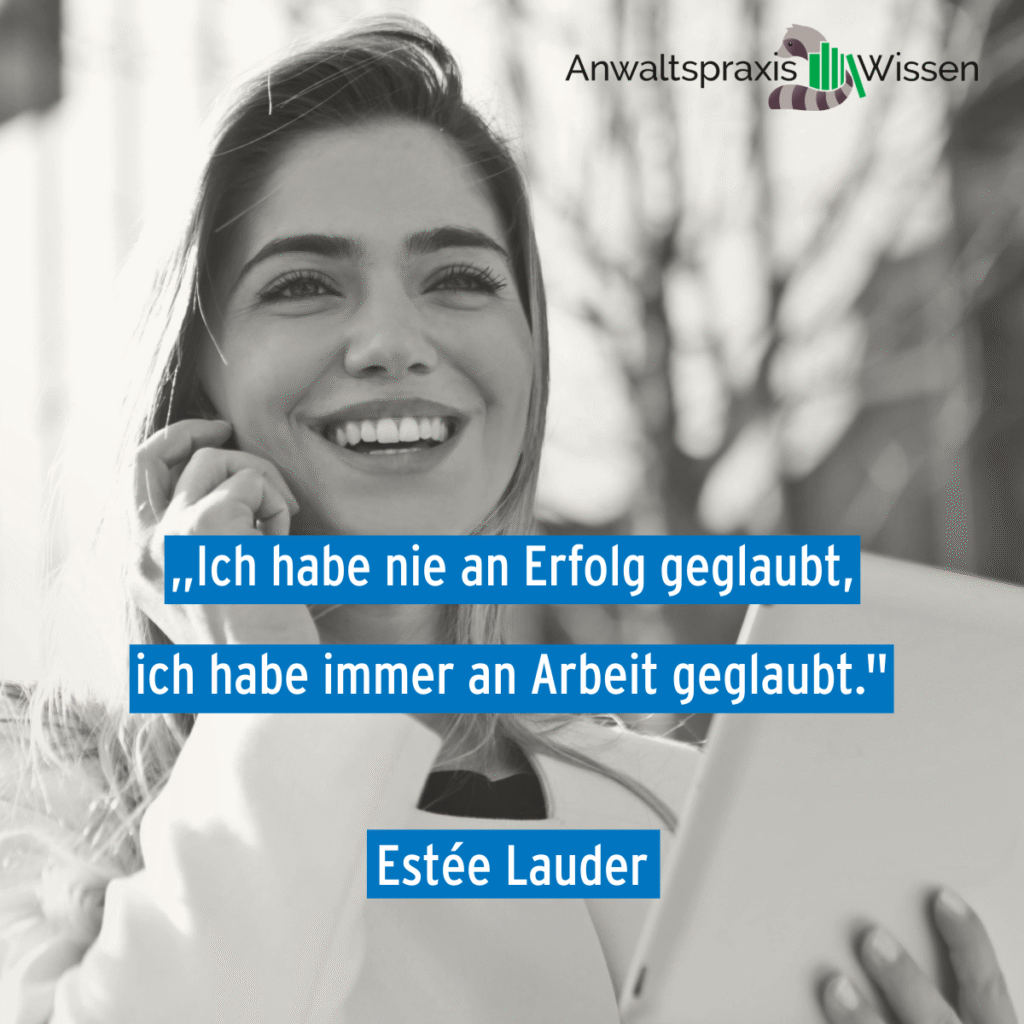

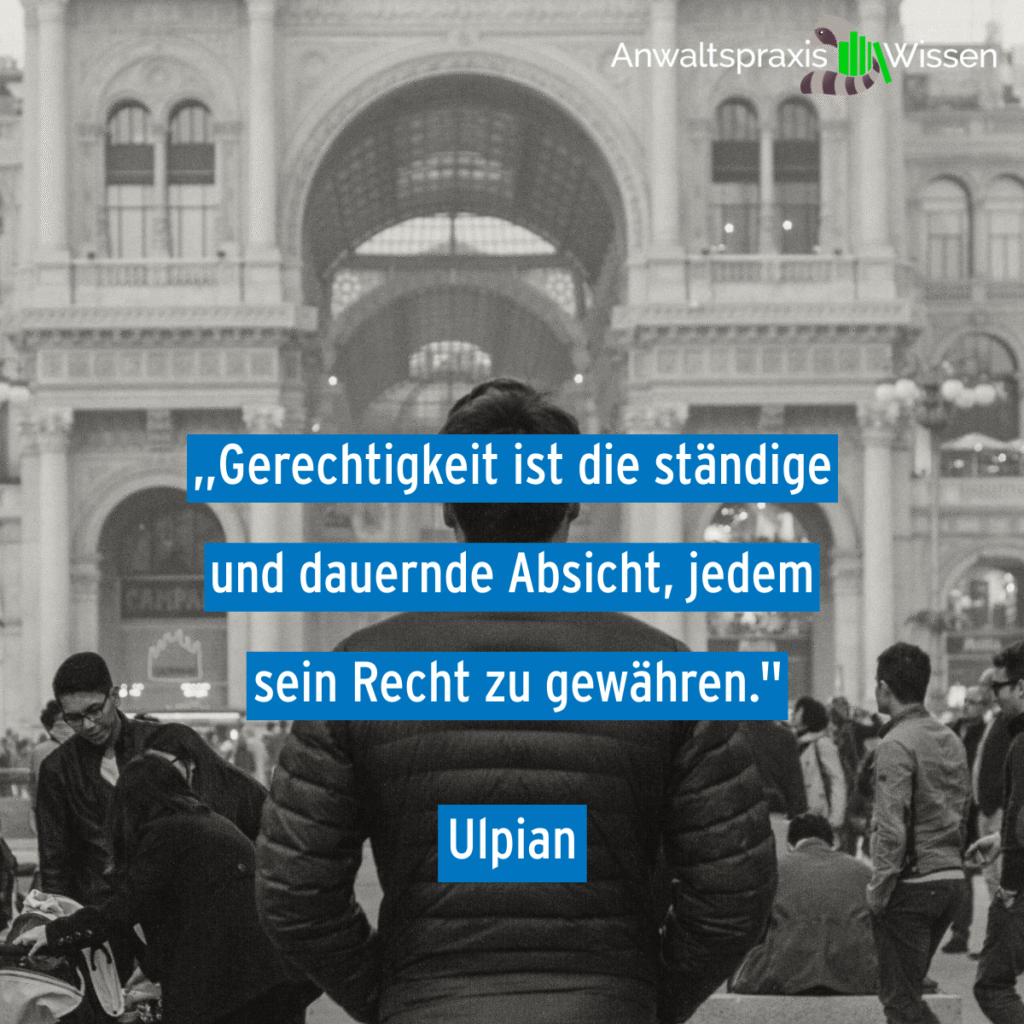

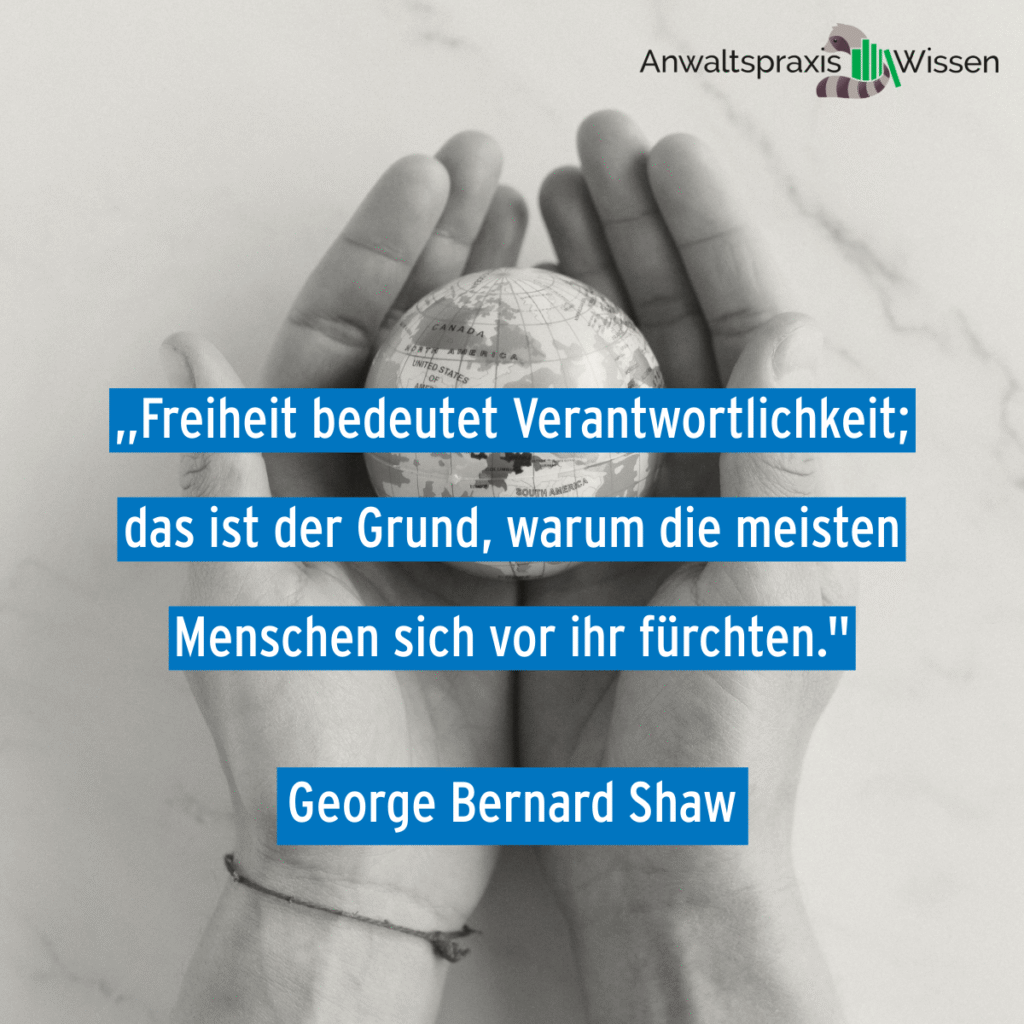

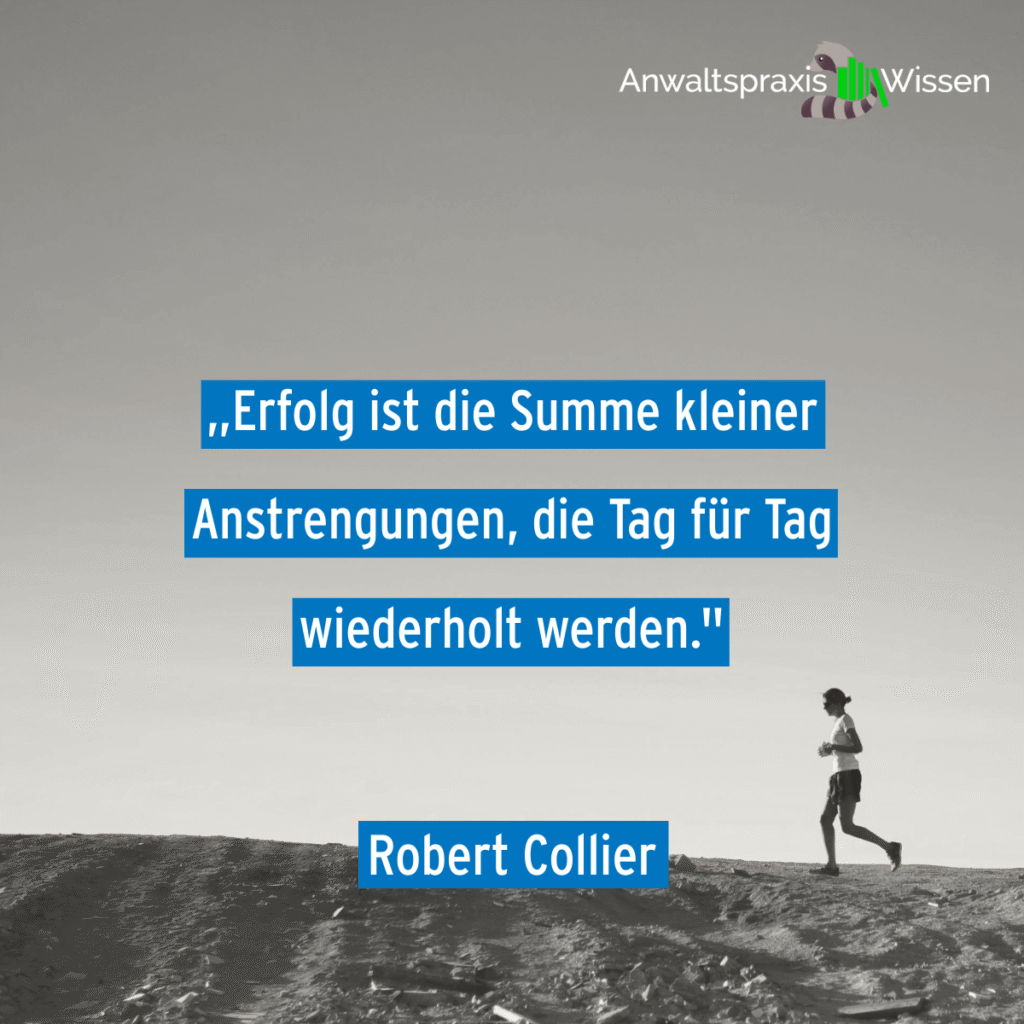


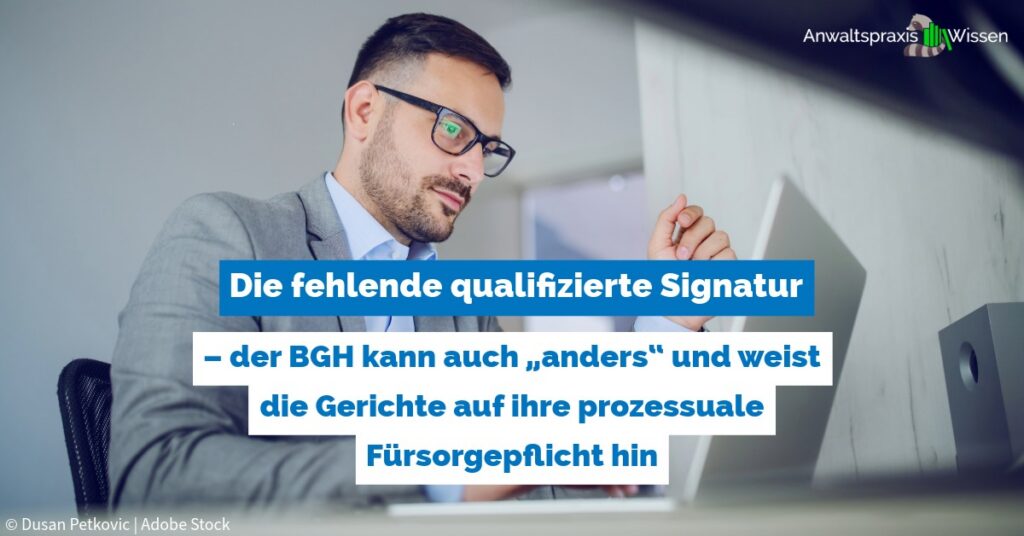

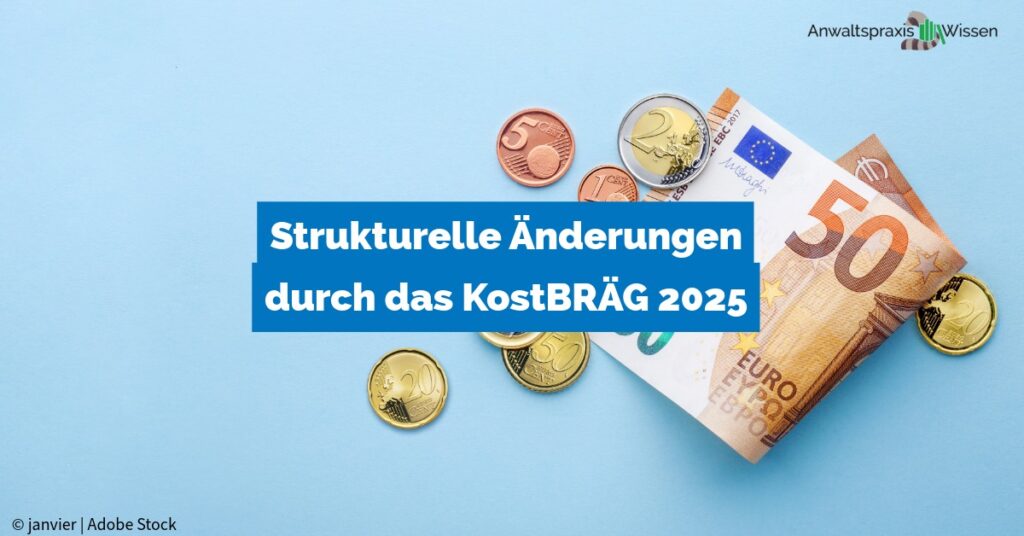

![Erbrecht im Gespräch: Kurze[s] Update: #19 Bestattungsrecht – mit Dr. Bernd Schmalenbach](https://anwaltspraxis-magazin.de/wp-content/uploads/2025/09/Erbrecht-im-Gespraech-19-1024x536.jpeg)