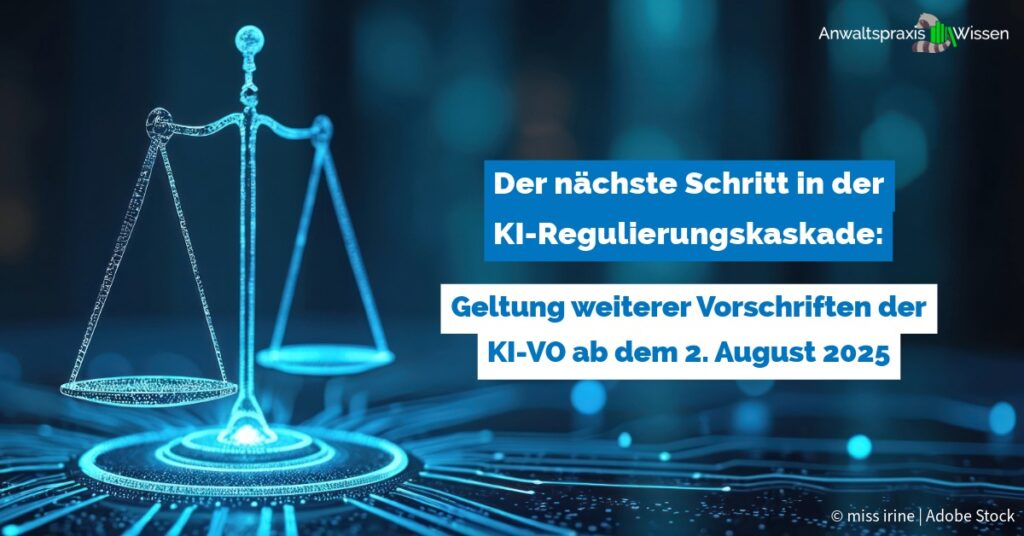1. Verlangt der Geschädigte eines Verkehrsunfalls vom Schädiger die Freistellung von Honorarforderungen des von ihm mit der Erstellung eines Schadensgutachtens beauftragten Sachverständigen, richtet sich sein Anspruch grundsätzlich bis zur Grenze des Auswahl- und Überwachungsverschuldens danach, ob und in welcher Höhe er mit der Verbindlichkeit, die er gegenüber dem Sachverständigen eingegangen ist, beschwert ist.
2. Jedenfalls in diesem Fall des Freistellungsantrages ist für die schadensrechtliche Betrachtung (§ 249 BGB) des Verhältnisses zwischen Geschädigtem und Schädiger die werkvertragliche Beziehung (§§ 631 ff. BGB) zwischen Geschädigtem und Sachverständigem maßgeblich. (Leitsatz des Verfassers)
I. Sachverhalt
Gutachterhonorar für Desinfektionskosten vor und nach Untersuchung
Die Parteien streiten um den Ersatz weiterer Sachverständigenkosten in Form einer Covid-19-Desinfektionspauschale nach einem Verkehrsunfall. Nach dem Unfall, für den die Beklagtenseite in vollem Umfang eintrittspflichtig war, hat der Kläger einen Sachverständigen mit der Ermittlung der Schadenshöhe beauftragt. Dieser hat im Rahmen der Begutachtung zum Schutz der Mitarbeiter des Sachverständigen alle relevanten Fahrzeugteile, die planmäßig kurzfristig berührt werden müssen, desinfizieren lassen und dieselbe Schutzmaßnahme auch vor der Rückgabe des Fahrzeuges zugunsten des Klägers getroffen. Das Landgericht hatte in der I. Instanz bei einem Streit über die Erstattungsfähigkeit dieses Aufschlages von 17,85 EUR lediglich die Hälfte zugesprochen, die sich auf Schutzmaßnahmen zugunsten der Kunden bezogen.
II. Entscheidung
Subjektiver Schadensbegriff mit Erkenntnissen des Geschädigten
Diese Entscheidung hat der BGH mit folgenden Erwägungen aufgehoben: Der Geschädigte können vom Schädiger als erforderlichen Herstellungsaufwand nur die Kosten erstattet verlangen, die vom Standpunkt eines verständigen und wirtschaftlich denkenden Menschen in der Lage des Geschädigten zur Behebung des Schadens zweckmäßig und notwendig erscheinen. Bei dieser Beurteilung, welcher Herstellungsaufwand erforderlich ist, wäre auch Rücksicht auf die spezielle Situation des Geschädigten, insbesondere seine Erkenntnisse und Einflussmöglichkeiten zu nehmen.
Freistellung von Verbindlichkeit bestimmt die Höhe des Ersatzanspruchs
Wenn, wie hier allerdings, die Rechnung noch nicht bezahlt ist, sondern der Geschädigte lediglich eine Freistellung von der Honorarforderung des von ihm beauftragten Sachverständigen begehrt, würde sich sein Anspruch schon nach dem eigenen Klagbegehren grundsätzlich und bis zur Grenze des Auswahl- und Überwachungsverschuldens danach richten, ob und in welcher Höhe er mit der Verbindlichkeit, die er gegenüber dem Sachverständigen eingegangen ist, beschwert wäre. Jedenfalls in diesem Fall des Freistellungsantrages wäre auch für die schadensrechtliche Betrachtung nach § 249 BGB bei der Beurteilung des Verhältnisses zwischen Geschädigtem und Schädiger die werkvertragliche Beziehung zwischen Geschädigtem und Sachverständigem nach dem §§ 631 ff. BGB maßgeblich. Insoweit kann der Geschädigte vom Schädiger die Freistellung der ihm hieraus entstehenden Verbindlichkeit verlangen, soweit der Vergütungsanspruch nicht auch für den Geschädigten erkennbar überhöht gewesen ist.
Kein Auswahl- oder Überwachungsverschulden des Geschädigten
Daher würde es – anders als das Landgericht dies beurteilt hatte – nicht darauf ankommen, ob die Desinfektionsmaßnahmen jeweils objektiv erforderlich im Sinne des § 249 Abs. 2 S. 1 BGB gewesen wären. Vorliegend könne jedenfalls ein Auswahl- und Überwachungsverschulden des Klägers nach den Umständen des Streitfalls nicht bejaht werden, sodass alleine noch zu prüfen wäre, ob und in welcher Höhe der Kläger dem Sachverständigen nach werkvertraglichen Grundsätzen eine Vergütung für die Desinfektionsmaßnahmen schulden würde.
Höhe der werkvertraglich geschuldeten Vergütung ist aufzuklären
Nach den für den BGH bindenden Feststellungen des Berufungsgerichtes hatten der Kläger und der Sachverständige keine konkrete Vergütungsvereinbarung getroffen. Die Tätigkeit des Sachverständigen wäre jedoch üblicherweise nur gegen ein entsprechendes Honorar zu erwarten, sodass es auf die übliche Vergütung ankommen würde. Insoweit hat das Berufungsgericht allerdings für den BGH verbindlich festgestellt, dass eine übliche Vergütung nicht ermittelt werden konnte. Konsequent weist der BGH darauf hin, dass ansonsten durch eine ergänzende Vertragsauslegung zu ermitteln wäre, ob und in welcher Höhe auch eine gesonderte Vergütung für einen solchen Aufschlag bejaht werden könne. Ansonsten käme immerhin ausnahmsweise auch noch eine einseitige Bestimmung der Gegenleistung durch den Sachverständigen in Betracht. Insoweit hätte das Berufungsgericht den Sachverhalt weiter aufzuklären und eine entsprechende Entscheidung zu treffen. Aus Sicht des BGH würde es dabei auch keinen grundsätzlichen Bedenken begegnen, dass der Sachverständige die Corona-Desinfektionspauschale gesondert berechnet hat, um diese zusätzliche Vergütung transparent zu erfassen, wenn diese Kosten denn für eine ergänzende Vertragsauslegung gedeckt wären.
III. Bedeutung für die Praxis
Zweistufige Prüfung: Schadensersatz folgt Werkvertrag bei Freistellung
Die Entscheidung des BGH dürfte für die Praxis ganz erhebliche Auswirkungen haben. Bisher hat der BGH im Bereich der Erstattung von Sachverständigenkosten immer darauf hingewiesen, dass der nicht bezahlten Rechnung keine Indizwirkung für die Erforderlichkeit im Sinne des § 249 Abs. 2 BGB zukommt und alleine der vom Geschädigten in Übereinstimmung mit der Rechnung und der ihr zugrunde liegenden Preisvereinbarung tatsächlich erbrachter Aufwand ein Anhaltspunkt für die Bestimmung des erforderlichen Betrages im Sinne des § 249 Abs. 2 BGB darstellen würde (vgl. BGH, Urt. v. 1.6.2017 – VII ZR 95/16 – VRR 2017, 2; BGH, Urt. v. 17.12.2019 – VI ZR 315/18 = VRR 2020,11). Jetzt geht der BGH allerdings auf diese konkrete Bewertung im vorliegenden Einzelfall gar nicht mehr ein. Vielmehr wendet er konsequent den Blick bei einer verfolgten Freistellung auf die Prüfung, ob und in welcher Höhe überhaupt eine Verbindlichkeit zulasten des Geschädigten besteht, von der dieser freigestellt werden muss. Denn allein die Höhe dieser festzustellenden Verbindlichkeit kann auch bei einem Schaden beim Geschädigten bejaht werden, der eine entsprechende Belastung zu seinem Nachteil begründet (vgl. dazu auch bereits Nugel, zfs 2014, 370 ff.). Insoweit hat die Prüfung zweistufig zu erfolgen: Zuerst wird die Höhe der bestehenden Verbindlichkeit nach werkvertraglichen Grundsätzen festgestellt. In einem zweiten Schritt wird dann geprüft, ob ein Schadensersatzanspruch auch in dieser Höhe bestehen kann oder aber zu verringern ist – zum Beispiel, weil der Betrag objektiv nicht erforderlich gewesen ist und dies subjektiv der Geschädigte auch unter Berücksichtigung seiner Einfluss- und Erkenntnismöglichkeiten hätte erkennen können und müssen oder den Geschädigten darüber hinaus zum Beispiel auch ein Mitverschulden im Sinne des § 255 Abs. 2 BGB trifft.
Ermittlung der werkvertraglich geschuldeten Vergütung im Vordergrund
Bei der Ermittlung der eingegangenen werkvertraglichen Verbindlichkeit bestand im Falle des BGH die Besonderheit, dass nach den Feststellungen des Tatrichters eine konkrete Vergütungsvereinbarung nicht bestanden hat. Dies mag erst einmal aus der Praxis heraus bei Gutachterhonoraren überraschen – unter Umständen lag der Fall allerdings auch so, dass nur bzgl. der Pauschale für Desinfektionsmaßnahmen keine Vergütungsvereinbarungen getroffen wurden. Überraschend ist es aber, dass nach den Feststellungen des Tatrichters dann auch keine übliche Vergütung ermittelt werden konnte – üblicherweise kann (notfalls durch einen Sachverständigen) sehr wohl ermittelt werden, wie die überwiegende Mehrzahl aller Sachverständigen in einer bestimmten Region abrechnet und ob und in welcher Höhe eine solche Pauschale tatsächlich verlangt wird. Wenn allerdings der Sonderfall vorliegt, dass auch eine übliche Vergütung nicht ermittelt werden kann, bleibt lediglich eine ergänzende Vertragsauslegung übrig – dass der BGH diese allerdings nicht selbst vorgenommen hat, überrascht allerdings.
Subjektive Erkenntnismöglichkeiten des Geschädigten ggf. im Wandel
Im Übrigen finden sich bei dem Fall des BGH, der augenscheinlich zu der Anfangszeit der Corona-Pandemie gespielt hat, keine vertiefte Erörterung dazu, ob und in welchem Umfang der Geschädigte hätte erkennen können, dass derartige Maßnahmen gar nicht mehr erforderlich gewesen sind. Bei dem aktuellen Erkenntnisstand tendiert ein Teil der Rechtsprechung bereits zu der durchaus überzeugenden Annahme, dass flächendeckende Desinfektionsmaßnahmen schon unter Berücksichtigung medizinischer Erkenntnisse gar nicht mehr erforderlich gewesen waren und diese auch üblicherweise weder erwartet werden können noch üblicherweise abgerechnet werden. Auch hier bleibt abzuwarten, wie die Rechtsprechung sich weiterentwickeln wird.


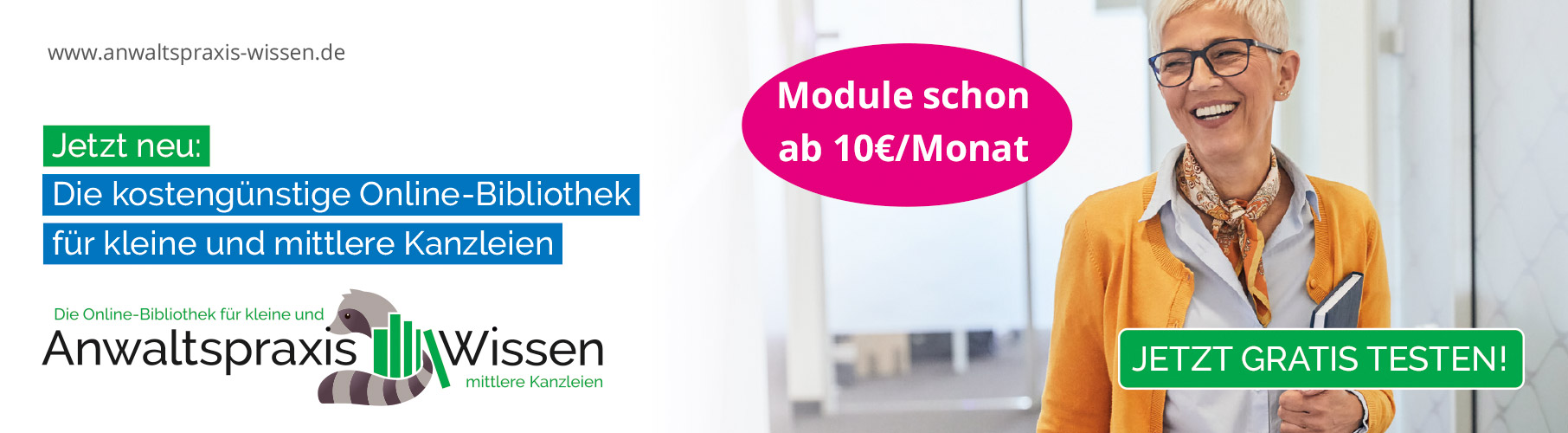

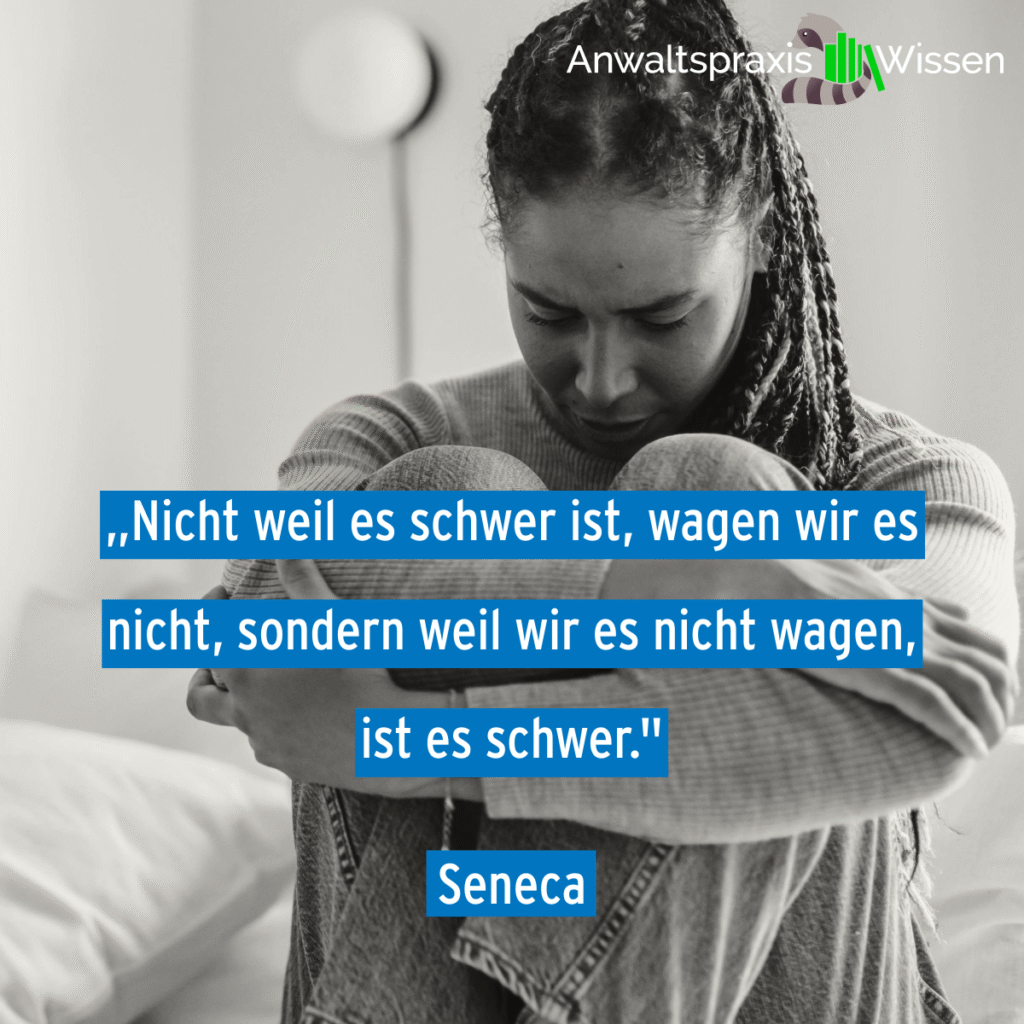
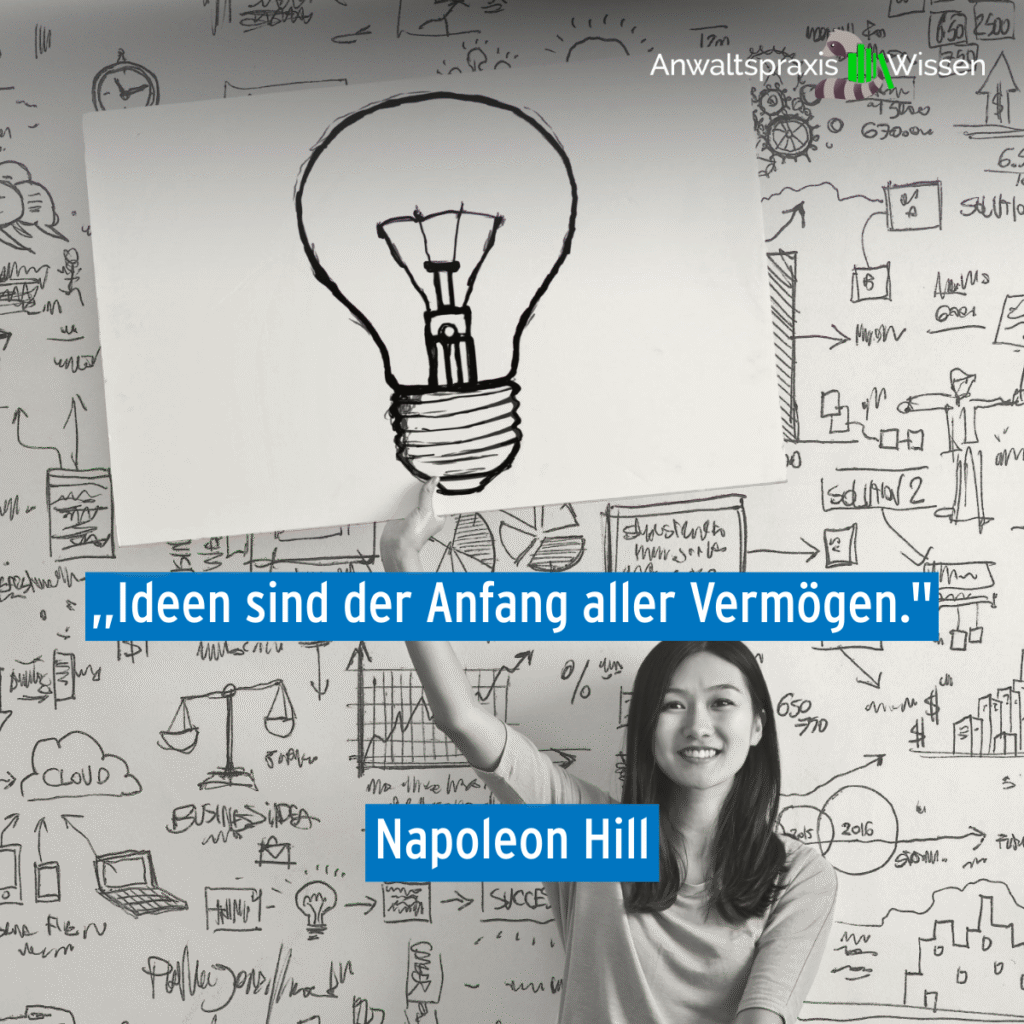
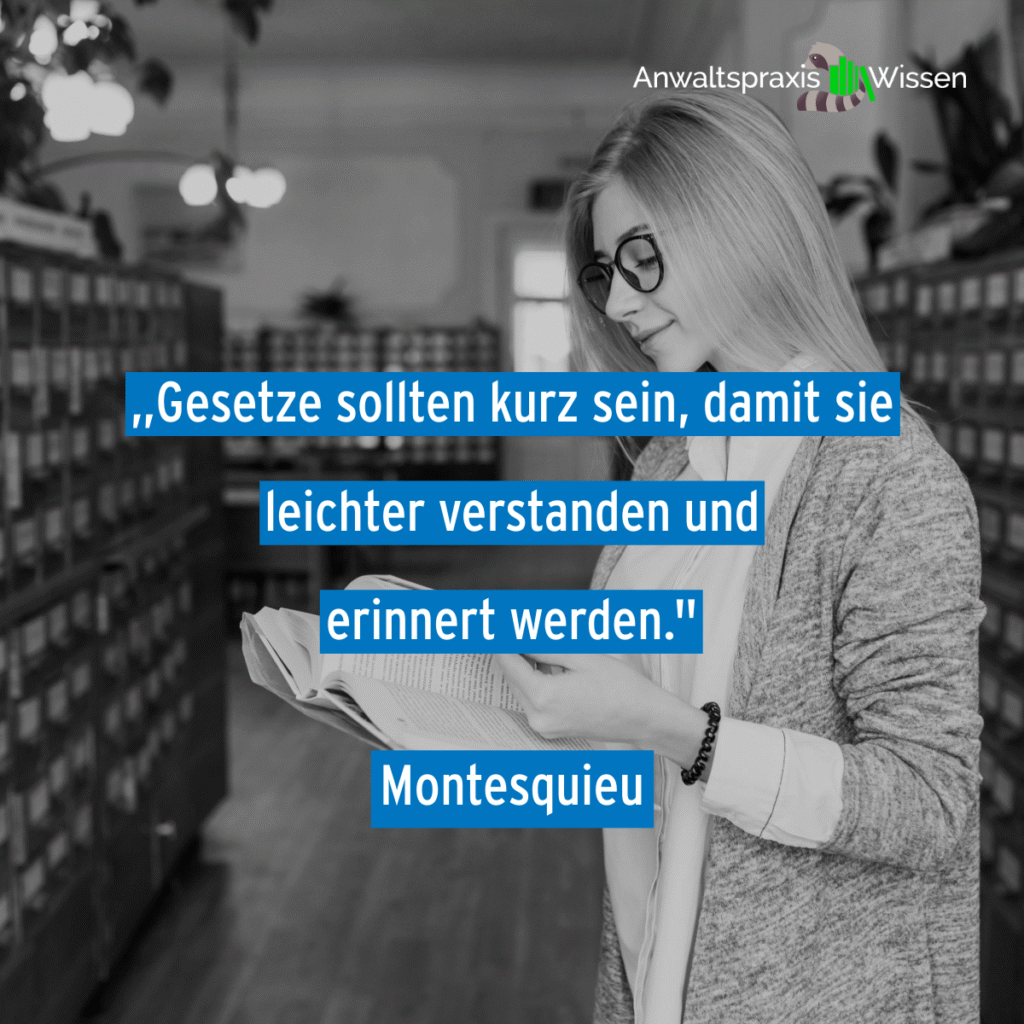
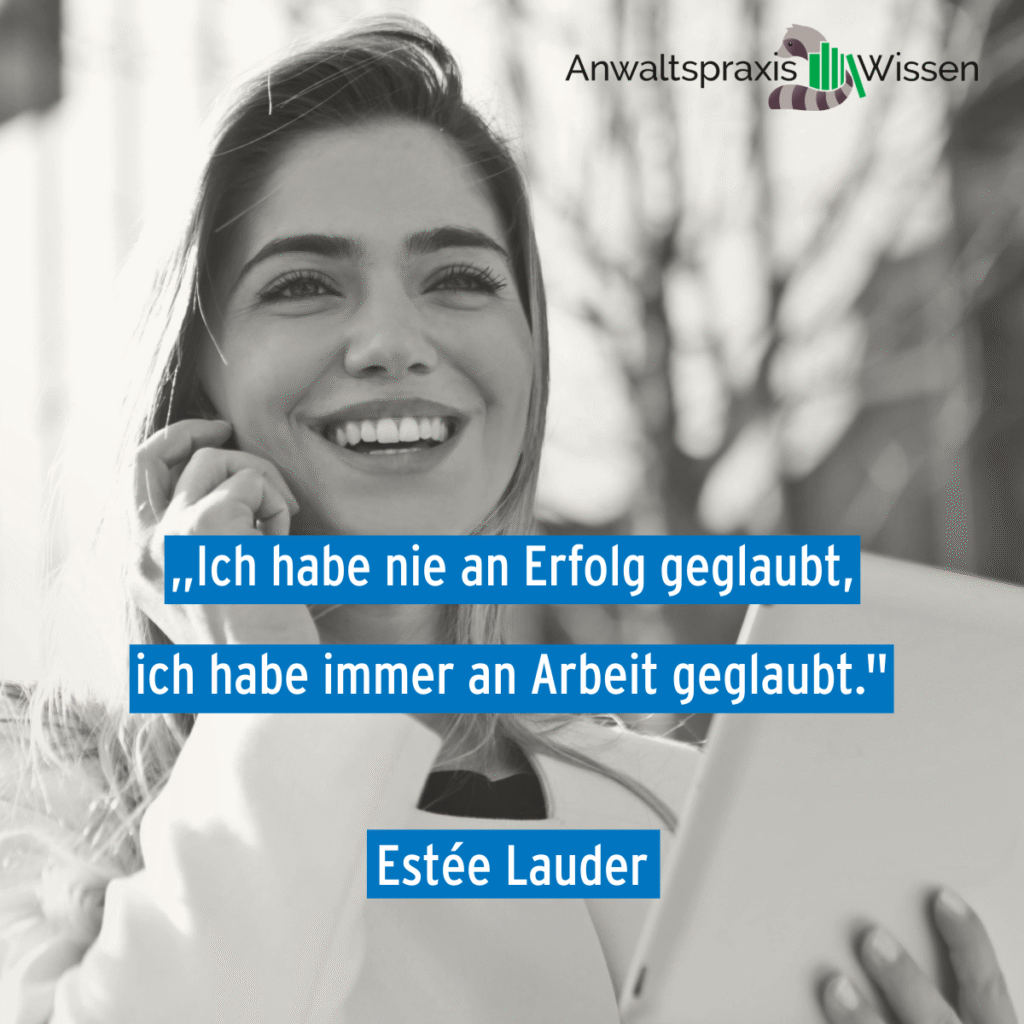

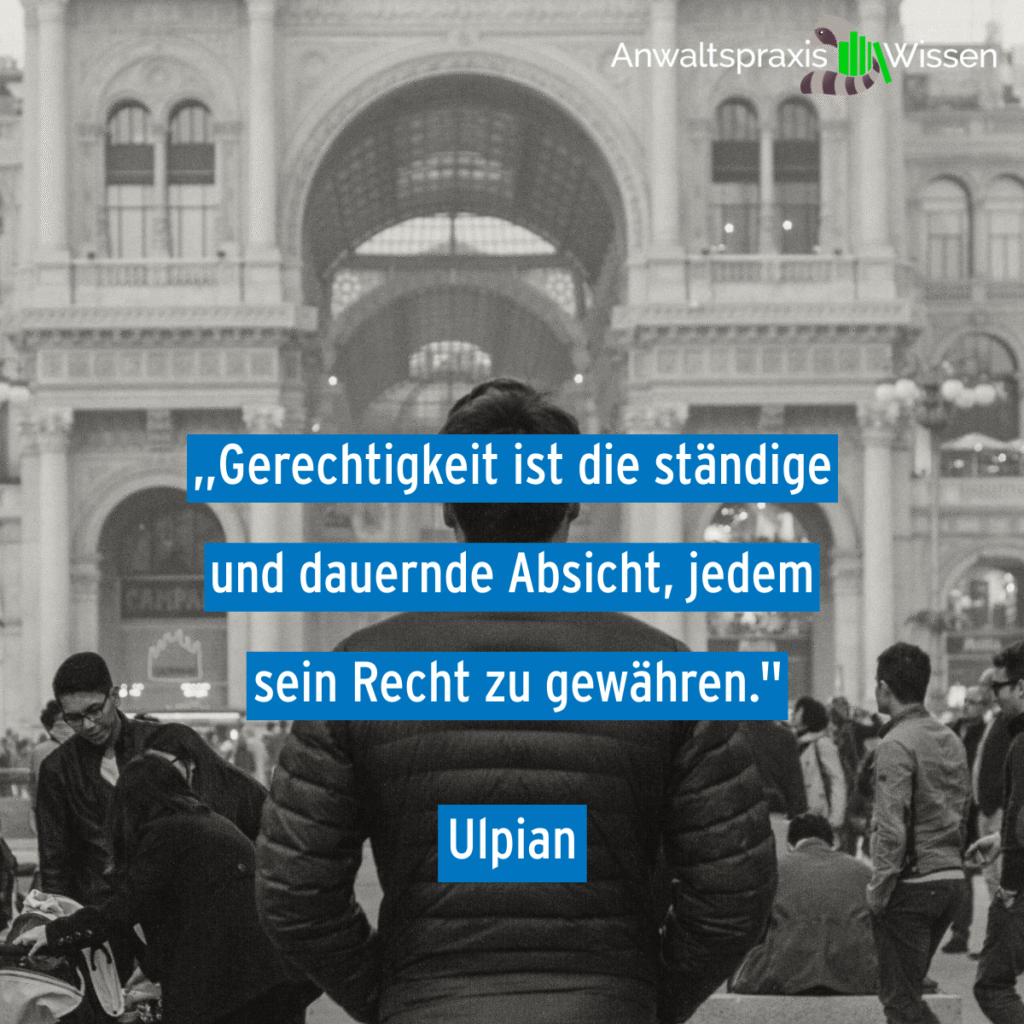

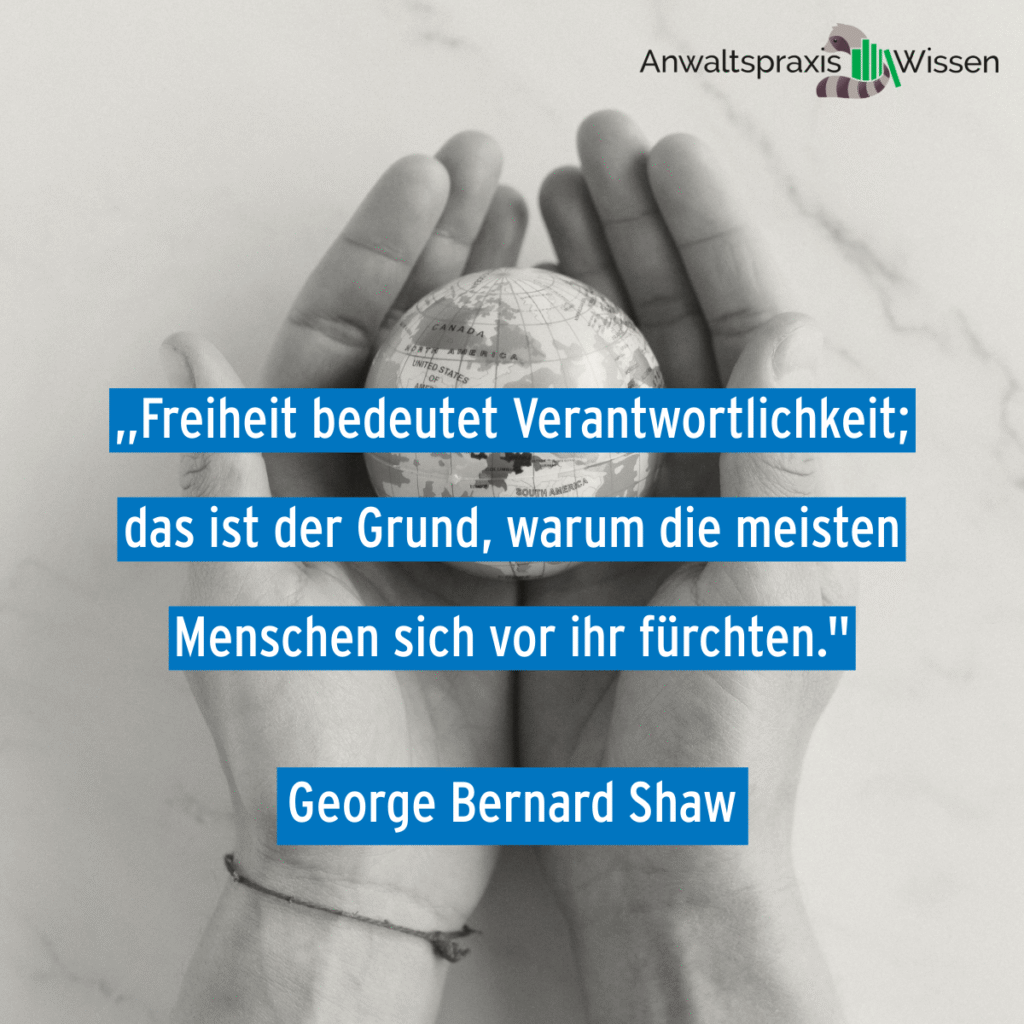



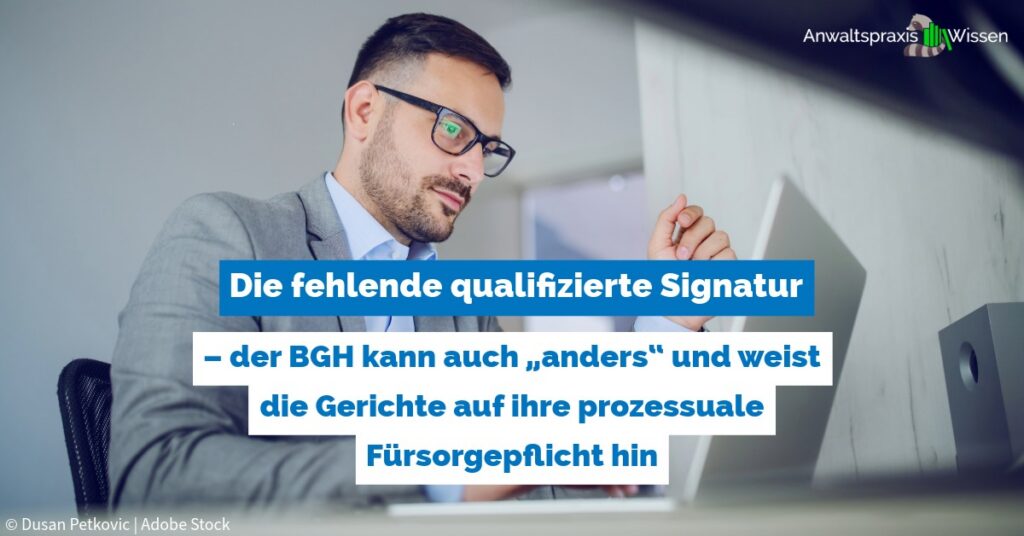

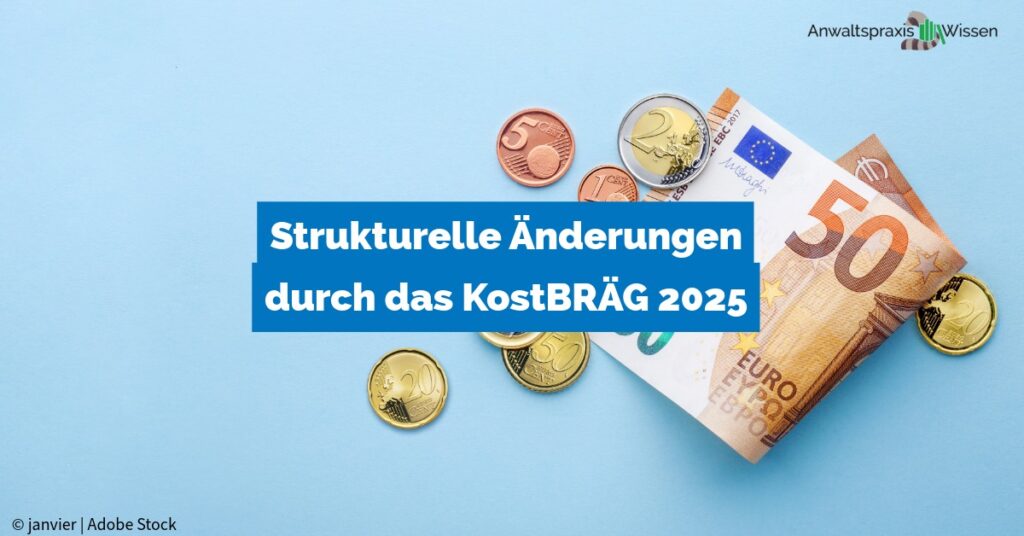

![Erbrecht im Gespräch: Kurze[s] Update: #19 Bestattungsrecht – mit Dr. Bernd Schmalenbach](https://anwaltspraxis-magazin.de/wp-content/uploads/2025/09/Erbrecht-im-Gespraech-19-1024x536.jpeg)