1. Der Besitz von bis zu 50 g Cannabis durch einen Strafgefangenen ist nicht strafbar, wenn dieser eine Freiheitsstrafe von mindestens sechs Monaten verbüßt. Bei dem Haftraum handelt es sich um seinen gewöhnlichen Aufenthalt gemäß § 3 Abs. 2 S. 1 Nr. 1 KCanG.
2. Den Anstaltsleitungen bleibt es unbenommen, den Besitz und Konsum von Cannabis in der Anstalt zu untersagen und Verstöße mit vollzuglichen Maßnahmen zu ahnden.
(Leitsätze des Verfassers)
I. Sachverhalt
Cannabis im Haftraum
Der Angeklagte verbüßt eine Haftstrafe von zwei Jahren und drei Monaten. In einem neuen Verfahren wurde ihm u.a. Besitz von Cannabis zur Last gelegt, nachdem in seinem Haftraum 45,06 Gramm Cannabisharz, welches zum Eigenkonsum bestimmt war, aufgefunden worden war.
Freispruch aus Rechtsgründen
Von diesem Vorwurf hat das AG den Angeklagten aus rechtlichen Gründen freigesprochen. Jedenfalls bei einer Haftdauer von mindestens sechs Monaten handele es sich bei einem Haftraum in einer JVA um den gewöhnlichen Aufenthalt des Verurteilten i.S.d. § 1 Nr. 17 KCanG, weshalb der festgestellte Besitz von Cannabis der Erlaubnisnorm des § 3 Abs. 2 S. 1 Nr. 1 KCanG unterfalle.
Revision der StA erfolglos
Die hiergegen eingelegte Sprungrevision der Staatsanwaltschaft hatte keinen Erfolg.
II. Entscheidung
Gewöhnlicher Aufenthalt gem. § 1 Nr. 17 KCanG
Das KG hat sich der Auffassung des AG, wonach es sich bei dem Haftraum des Angeklagten um dessen gewöhnlichen Aufenthalt i.S.d. KCanG handelt, angeschlossen. Zur Begründung verweist der Senat zunächst auf die Legaldefinition in § 1 Nr. 17 KCanG, wonach der gewöhnliche Aufenthaltsort der Ort ist, an dem sich eine Person unter Umständen aufhält, die erkennen lassen, dass sie an diesem Ort oder in diesem Gebiet nicht nur vorübergehend verweilt; solche Umstände sind nach dieser Vorschrift bei einem zeitlich zusammenhängenden Aufenthalt an einem Ort von mindestens sechs Monaten Dauer anzunehmen, wobei kurzfristige Unterbrechungen unberücksichtigt bleiben.
Wille des Betroffenen unerheblich
Diese Definition habe der Gesetzgeber an diejenige in §§ 8, 9 AO sowie in § 30 Abs. 3 SGB I angelehnt. Hiervon ausgehend handele es sich beim gewöhnlichen Aufenthalt um den Ort, an dem die Person sozial integriert ist und ihren auf längere Zeit angelegten tatsächlichen Lebensmittelpunkt hat. Auf den Willen der Person, den Aufenthaltsort zum Mittelpunkt oder Schwerpunkt ihrer Lebensverhältnisse zu machen, komme es dabei nicht an; entscheidend seien vielmehr allein die tatsächlichen Verhältnisse. Folglich könne auch die zwangsweise Unterbringung wie etwa im Fall eines Strafgefangenen beim Vollzug einer mehrjährigen Freiheitsstrafe einen gewöhnlichen Aufenthalt begründen. Denn dort empfange der Gefangene seine Besucher und unterhalte seine sozialen Kontakte. Sonderregelungen, wie sie das KCanG etwa für militärische Bereiche vorsehe, habe der Gesetzgeber im Hinblick auf Justizvollzugsanstalten nicht getroffen.
Kein Rückgriff auf § 8 Abs. 2 StPO
Nicht gefolgt ist das KG dagegen der Ansicht der Staatsanwaltschaft, wonach die Regelung über den Gerichtsstand des gewöhnlichen Aufenthalts in § 8 Abs. 2 StPO heranzuziehen sei, der durch eine zwangsweise Unterbringung etwa in einer JVA nicht begründet wird. Dies finde weder im Gesetz noch in den Gesetzgebungsmaterialien eine Stütze. Der Gesetzgeber habe bei der Schaffung der Legaldefinition in § 1 Nr. 17 KCanG ausdrücklich nur auf die vorgenannten Normen in der AO sowie im SGB I Bezug genommen.
Schutz durch Art. 13 GG nicht erforderlich
Schließlich könne der Annahme eines gewöhnlichen Aufenthalts auch nicht mit Erfolg entgegengehalten werden, dass der Haftraum nicht dem Schutzbereich des Art. 13 GG unterfalle und daher nicht in diesem Sinne als Wohnung anzusehen sei. Denn der gewöhnliche Aufenthalt stelle gerade keinen Wohnsitz dar und setze lediglich das Bestehen eines tatsächlichen Lebensmittelpunkts für eine gewisse Dauer voraus. Eine Einschränkung dahingehend, dass es sich sowohl beim Wohnsitz als auch beim Ort des gewöhnlichen Aufenthalts gleichermaßen um von Art. 13 GG geschützte Wohnräume handeln müsse, finde im Gesetz keine Stütze und unterliefe zudem die gesetzliche Differenzierung zwischen den beiden Begriffen; dem gewöhnlichen Aufenthalt würde so die eigenständige Bedeutung genommen. Wenngleich der Haftraum nicht am Schutz des Art. 13 GG teilnehme, erhalte der Gefangene mit dessen Zuweisung einen persönlichen, vom allgemeinen Anstaltsbereich abgegrenzten Lebensbereich zur Verfügung gestellt. Dies komme nicht zuletzt darin zum Ausdruck, dass der Haftraum taugliches Tatobjekt eines Hausfriedensbruchs sein könne.
III. Bedeutung für die Praxis
Überzeugende Entscheidung
1. Die Frage, ob es sich bei einem Haftraum um einen gewöhnlichen Aufenthalt oder gar um eine Wohnung handelt, wird in der Rechtsprechung der Obergerichte bislang nicht einheitlich beurteilt. So hat das OLG Schleswig (Beschl. v. 1.8.2024 – 1 Ws 123/124) in Übereinstimmung mit einer entsprechenden Ansicht im Schrifttum (Patzak/Fabricius/Patzak, BtMG, 11. Aufl., § 1 KCanG Rn 39) entschieden, dass Hafträume weder einen Wohnsitz noch einen gewöhnlichen Aufenthaltsort begründeten. Dem ist das KG nunmehr mit einer sorgfältig und überzeugend begründeten Entscheidung entgegengetreten. Dabei orientiert sich der Senat eng am Gesetzeswortlaut sowie an den Gesetzgebungsmaterialien und vermeidet es konsequent, in die Vorschriften etwas „hineinzulesen“, was der Gesetzgeber nicht im Blick hatte.
Nur bei Strafhaft
2. Zu beachten ist allerdings, dass die Entscheidung nur im Hinblick auf die Strafhaft ergangen ist, wohingegen sich Untersuchungshäftlinge nicht auf das KG werden berufen können. Denn die Untersuchungshaft begründet nach Auffassung des Senats keinen gewöhnlichen Aufenthalt, da sie nicht auf Dauer angelegt sei und jederzeit beendet werden könne.
Vollzugsrechtliche Ahndung möglich
Ohnehin sind Befürchtungen, wonach Strafgefangene jedenfalls im Zuständigkeitsbereich des KG fortan folgenlos eingeschmuggeltes Cannabis konsumieren können, unbegründet. Denn der Senat erinnert ausdrücklich daran, dass Besitz und Konsum von Cannabis in Vollzugsanstalten mit Blick auf die Sicherheit und Ordnung selbstverständlich generell untersagt werden können. Kommt es insoweit zu Verstößen, muss der Gefangene nicht nur mit vollzugsrechtlichen Maßnahmen rechnen, sondern auch mit Nachteilen, wenn Entscheidungen nach § 57 StGB anstehen. Denn ein von Verstößen gegen die Anstaltsordnung geprägtes Vollzugsverhalten kann einer günstigen Prognose, wie sie für eine vorzeitige Entlassung zwingend erforderlich ist, entgegenstehen.




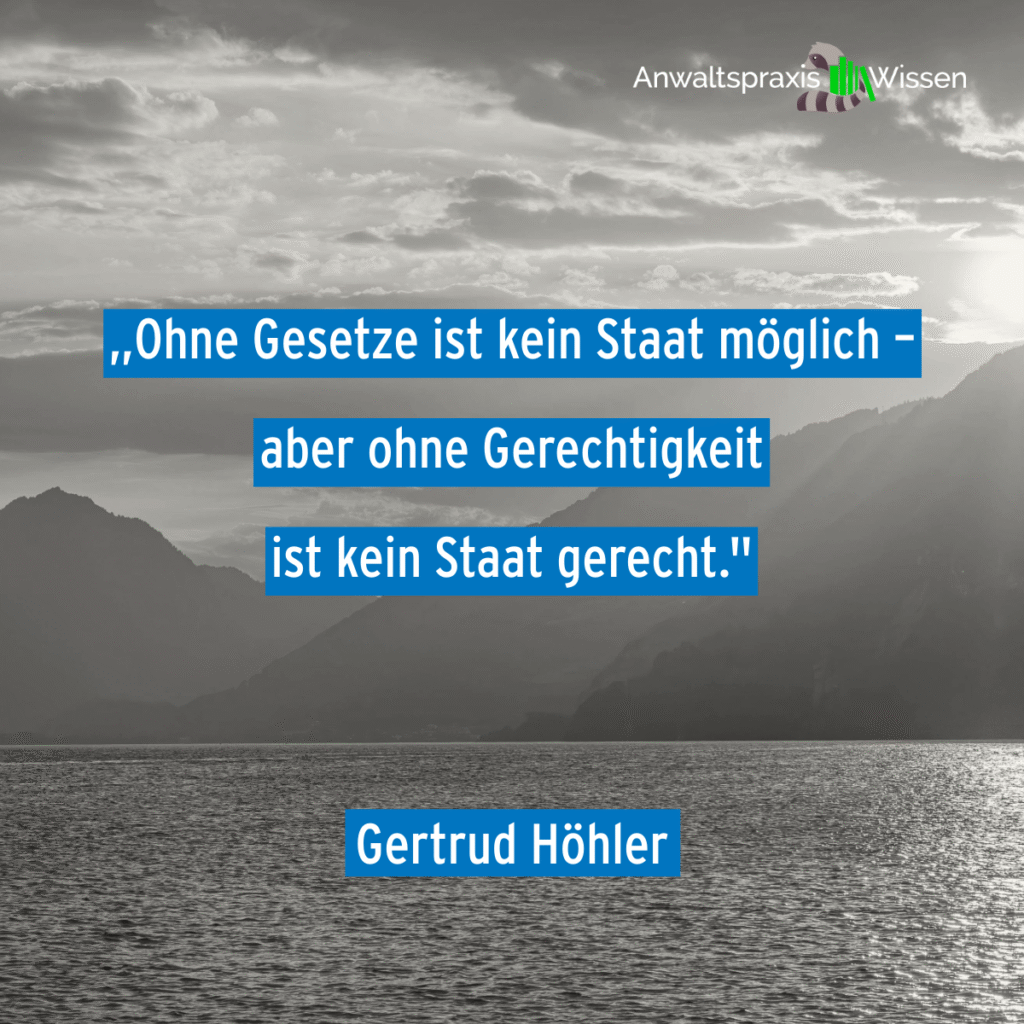
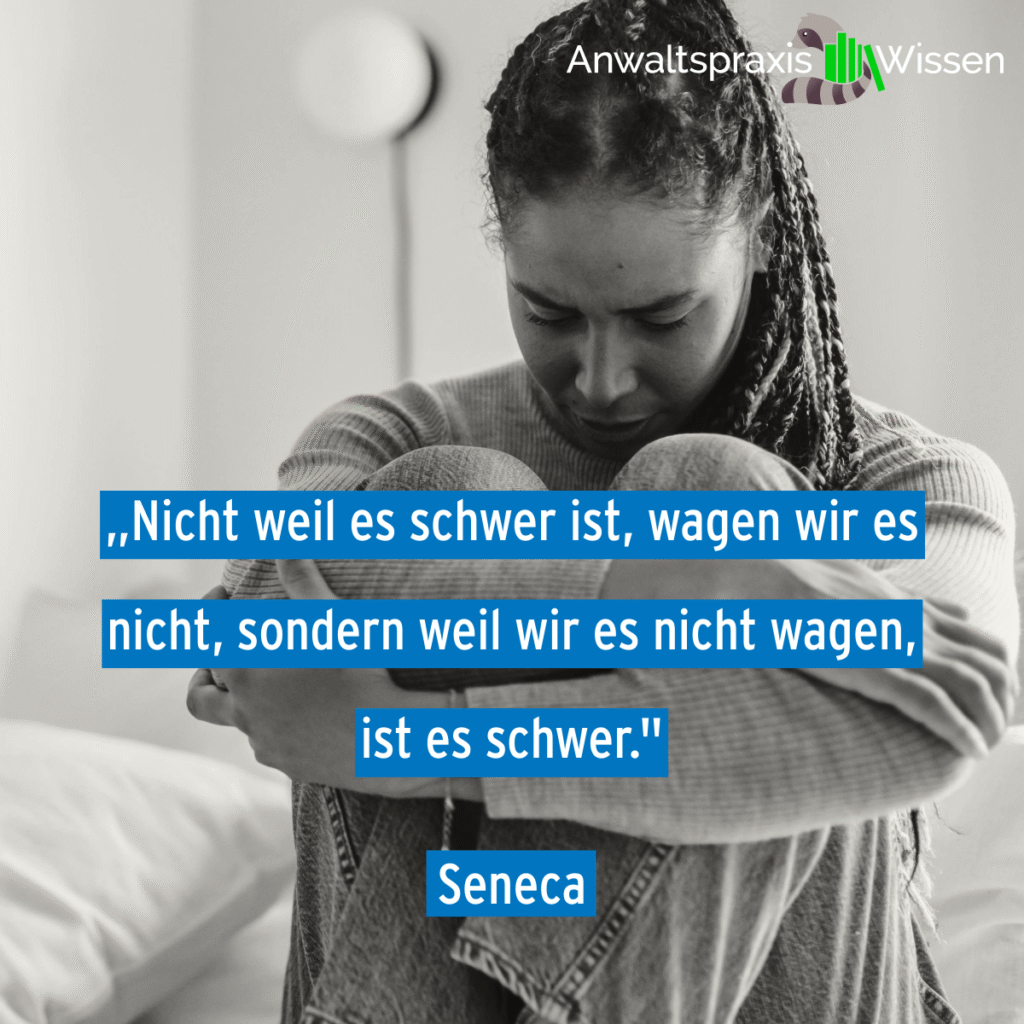
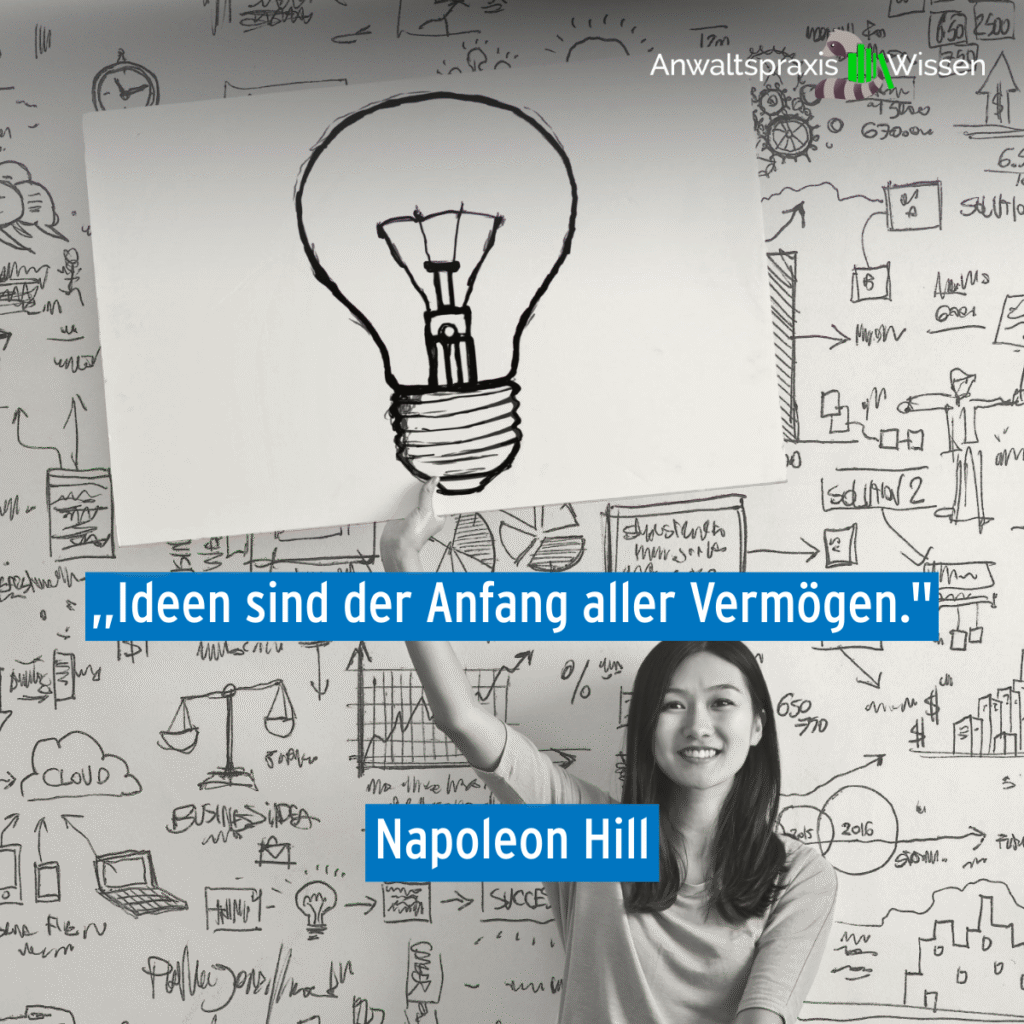
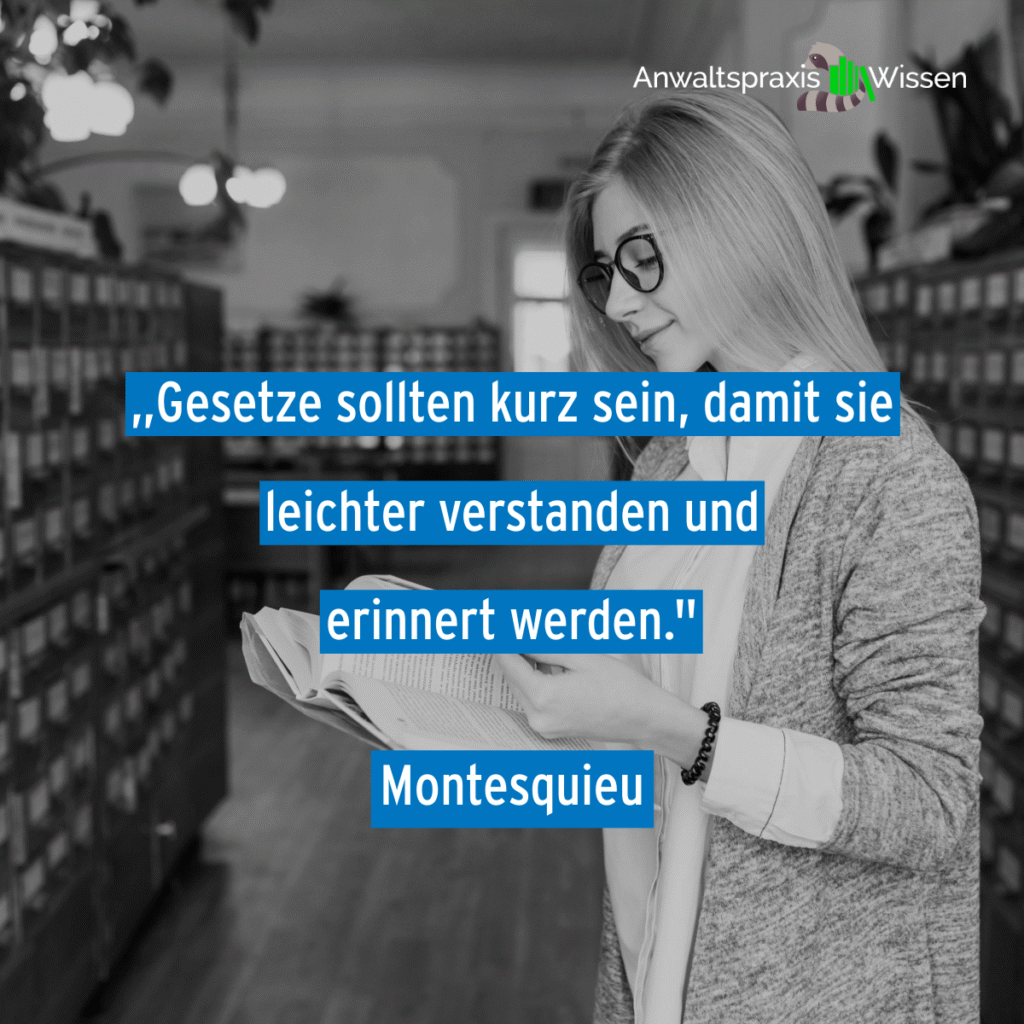
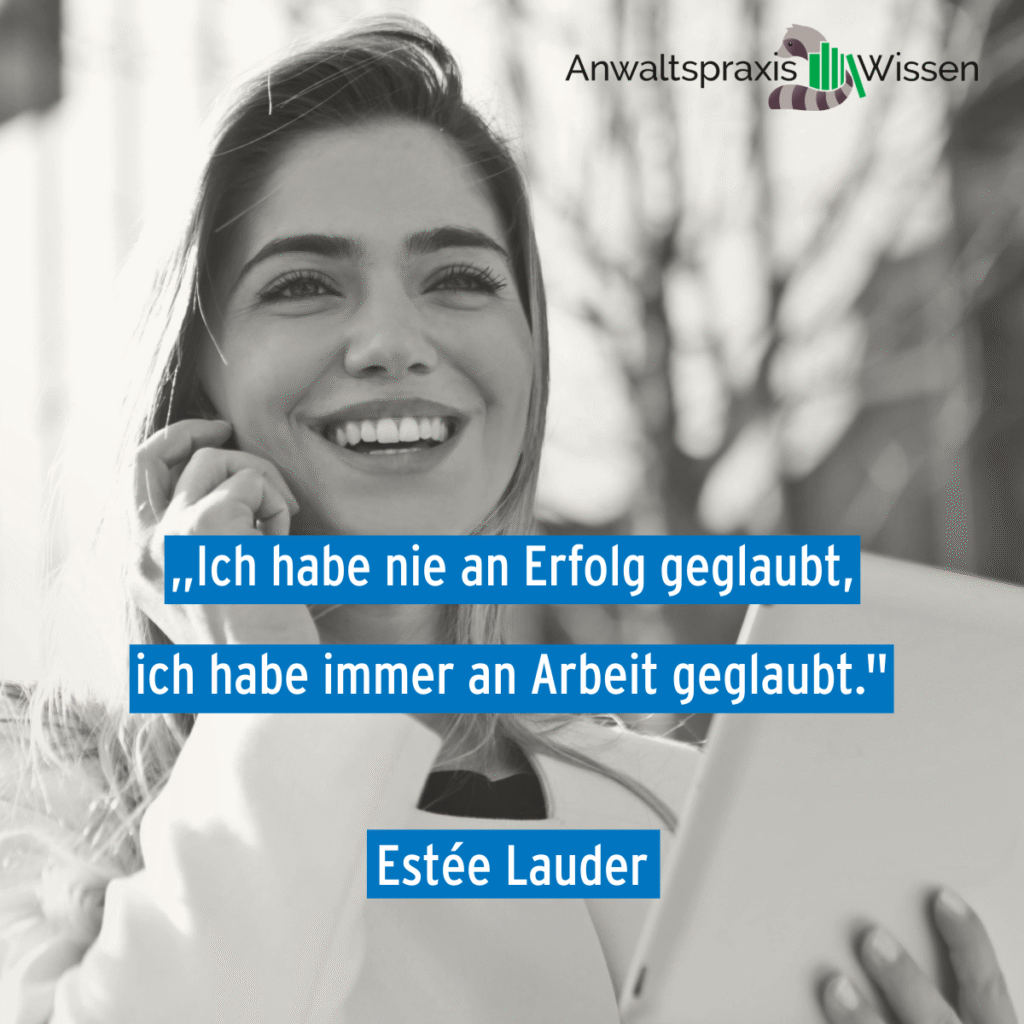

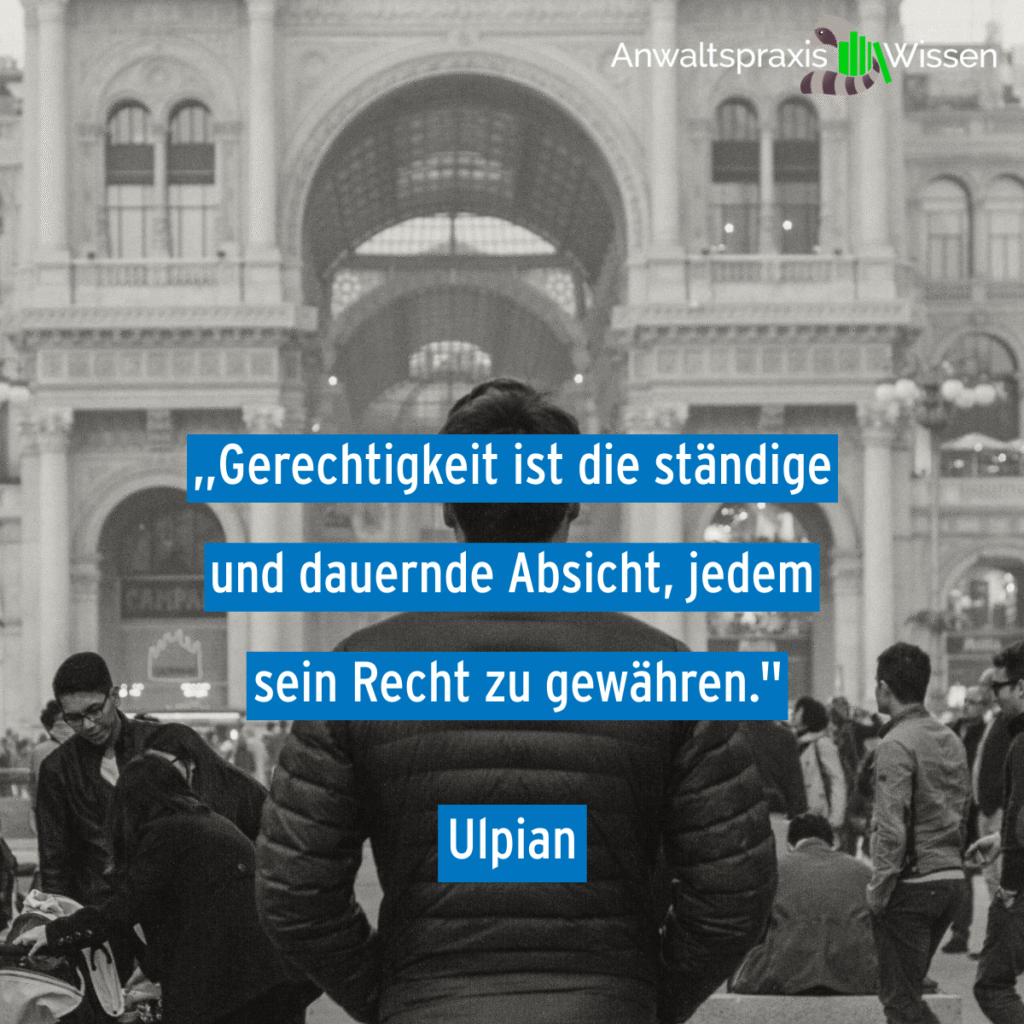

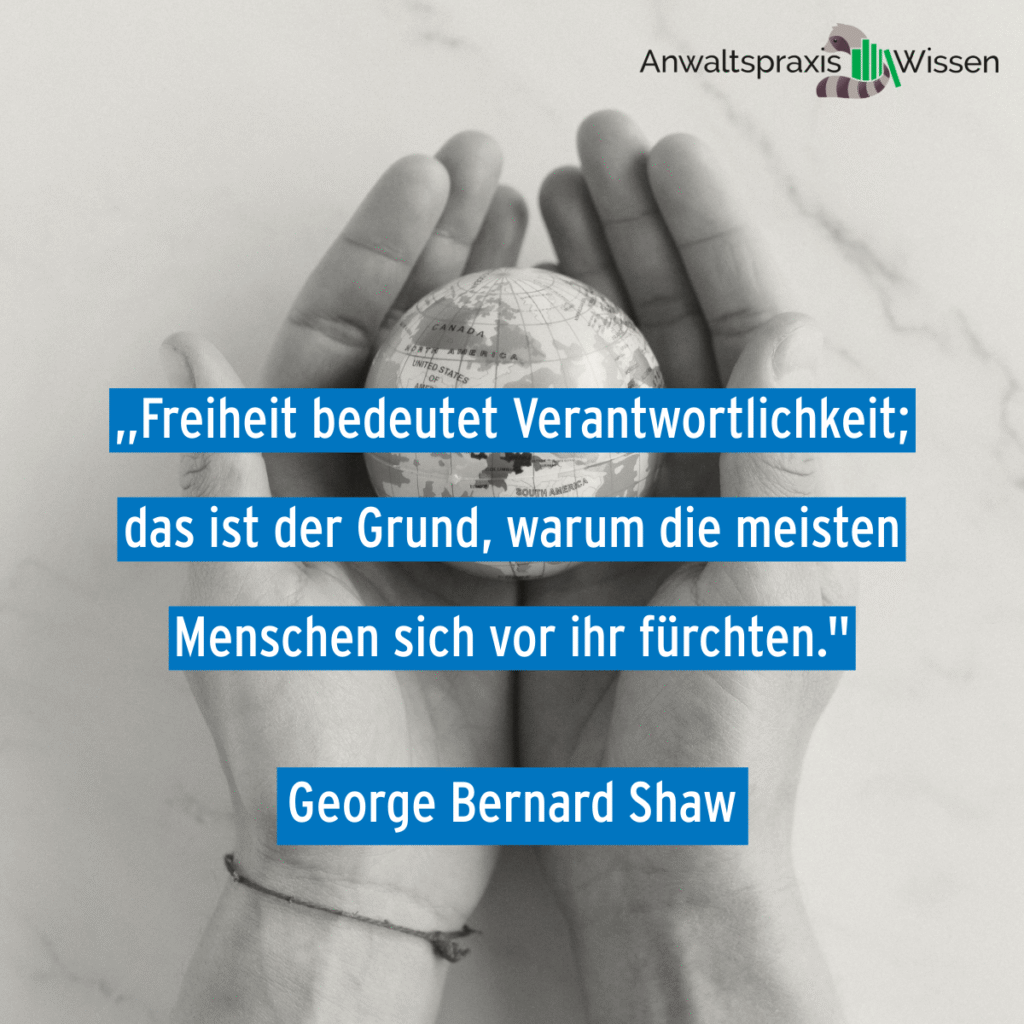
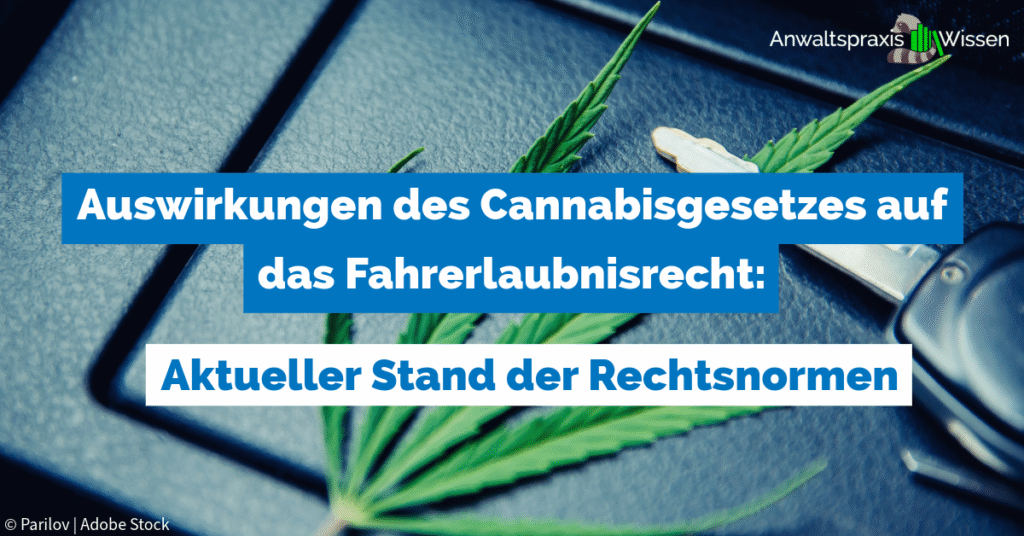

![Erbrecht im Gespräch: Kurze[s] Update: #21 Ehegatten: Testament oder Erbvertrag? – mit Dr. Markus Sikora](https://anwaltspraxis-magazin.de/wp-content/uploads/2025/11/Erbrecht-im-Gespraech-21-1024x536.jpeg)


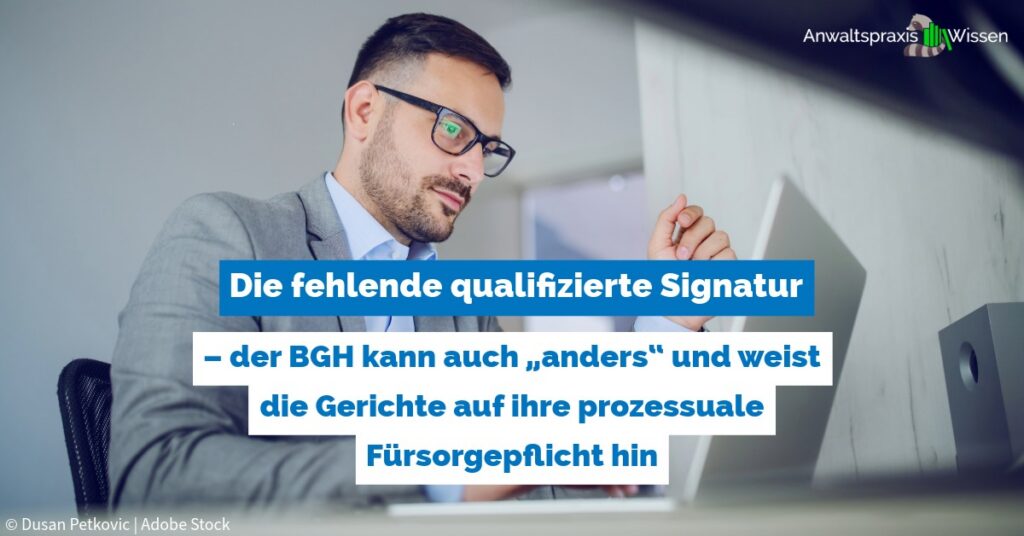

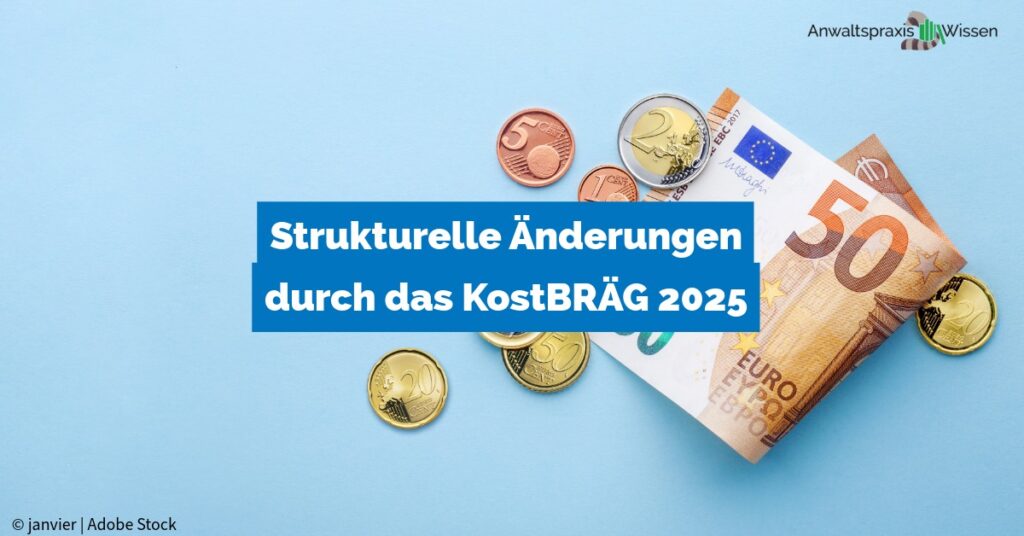

![Erbrecht im Gespräch: Kurze[s] Update: #19 Bestattungsrecht – mit Dr. Bernd Schmalenbach](https://anwaltspraxis-magazin.de/wp-content/uploads/2025/09/Erbrecht-im-Gespraech-19-1024x536.jpeg)