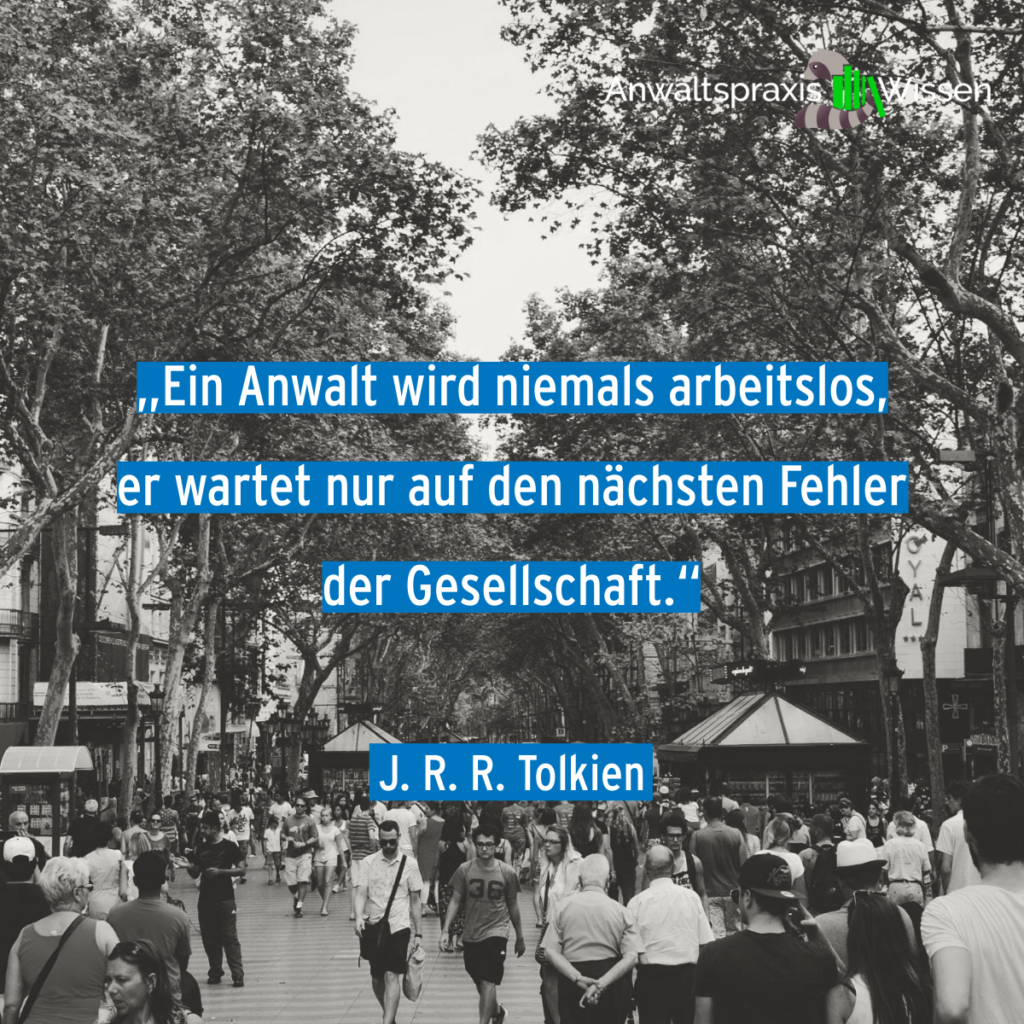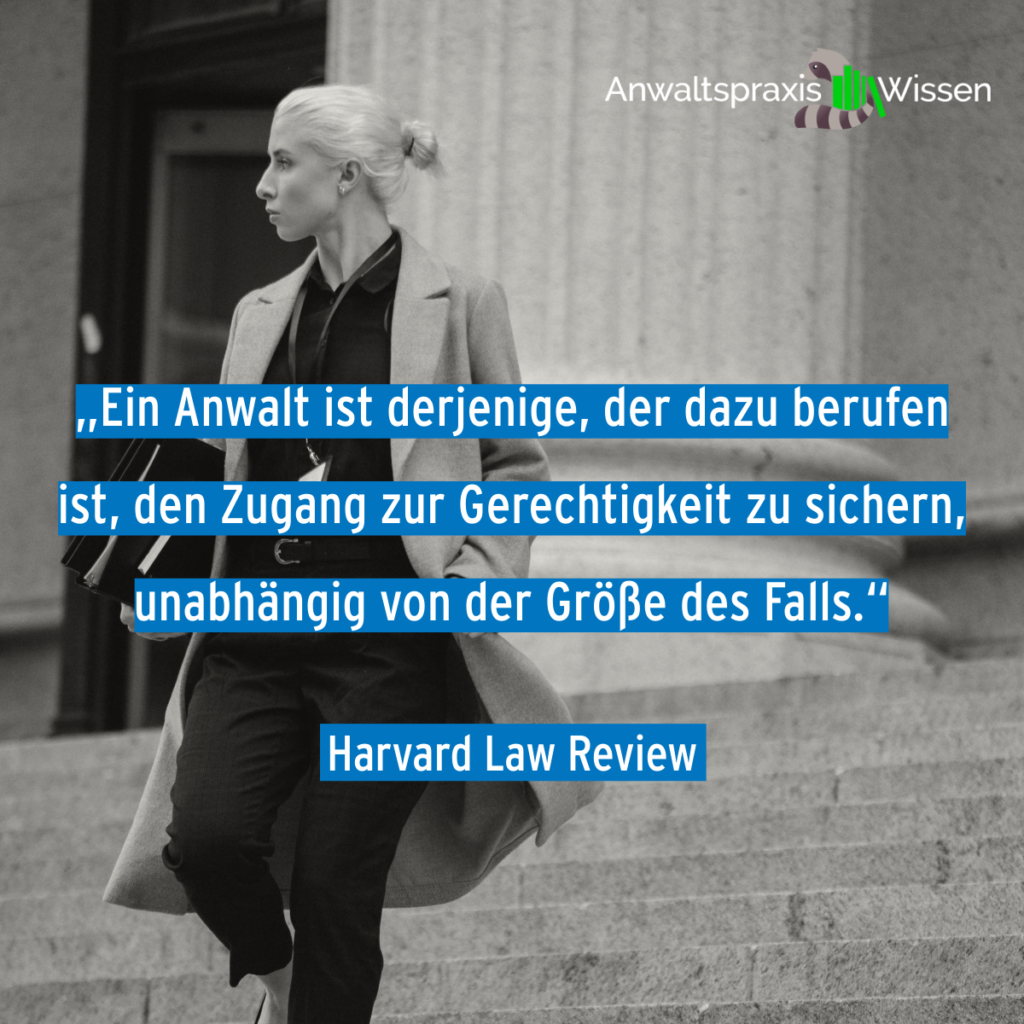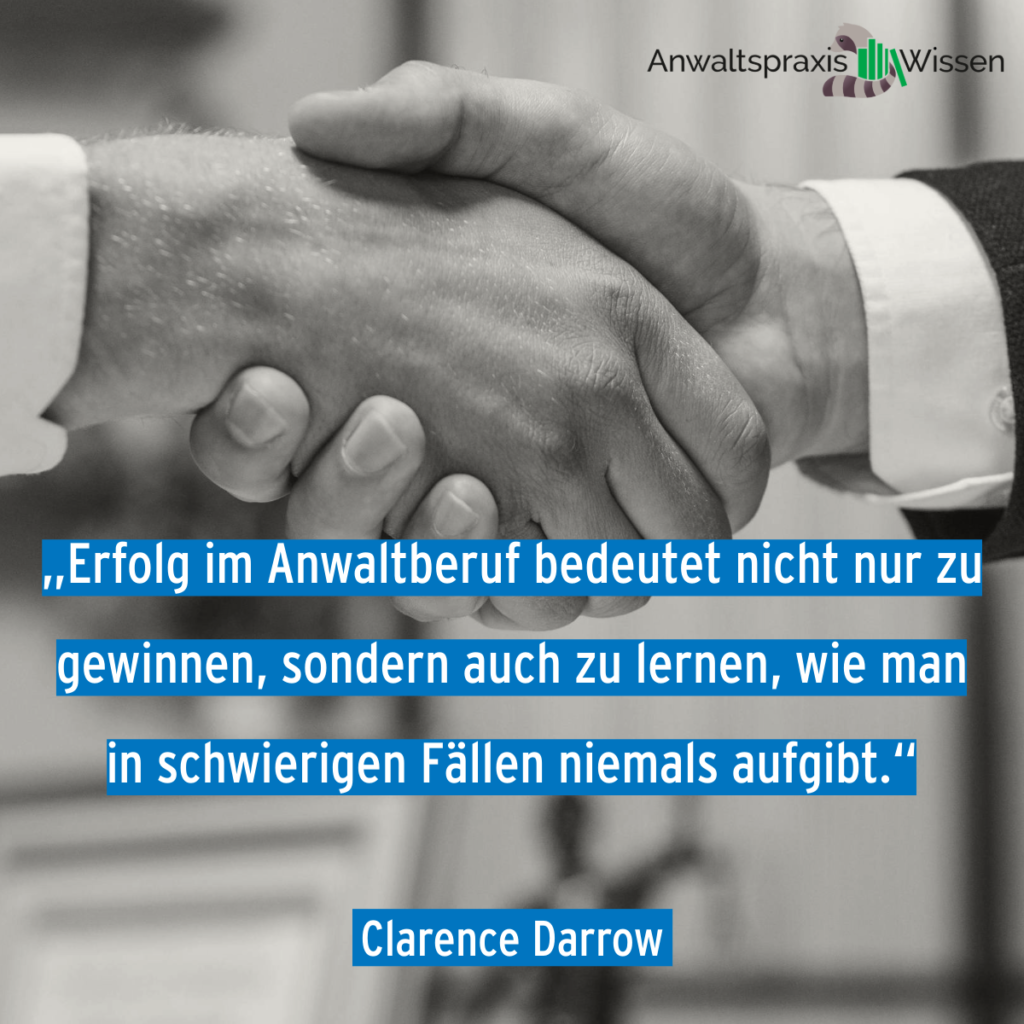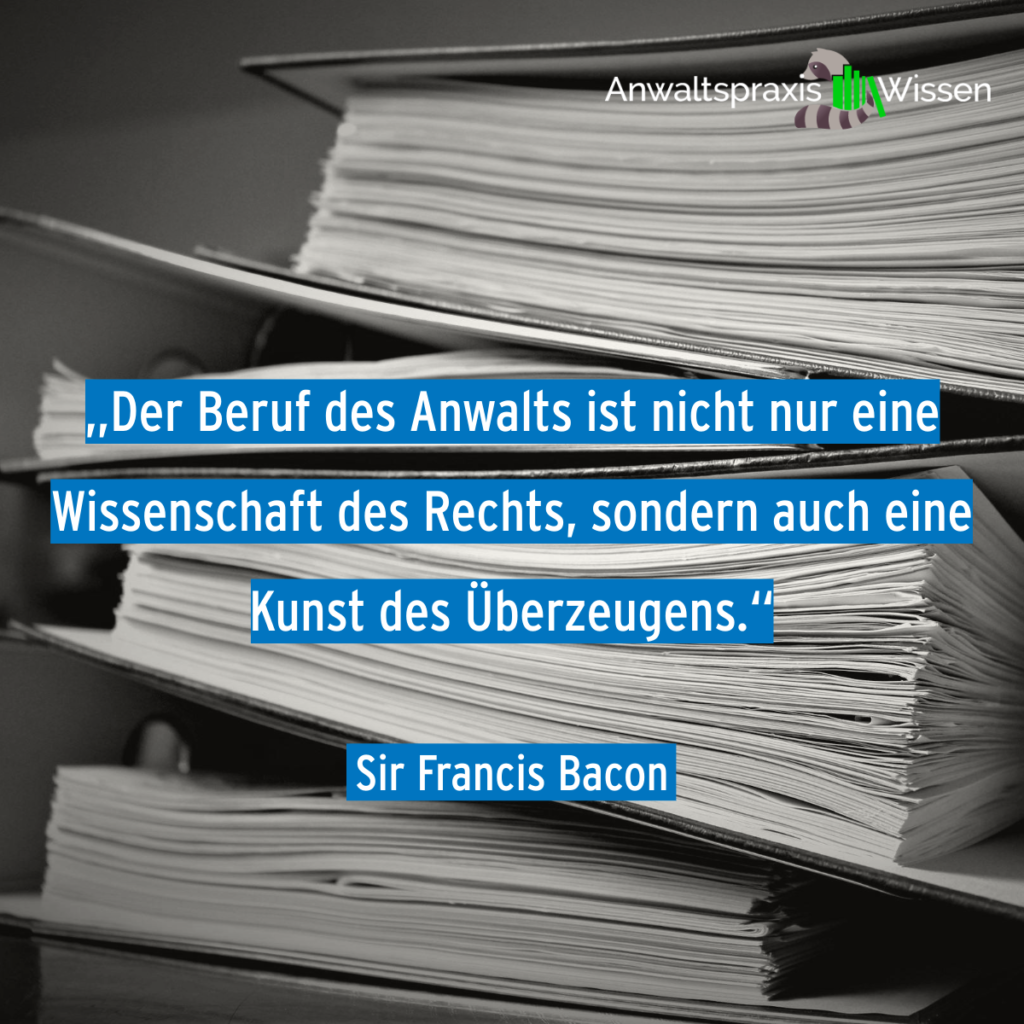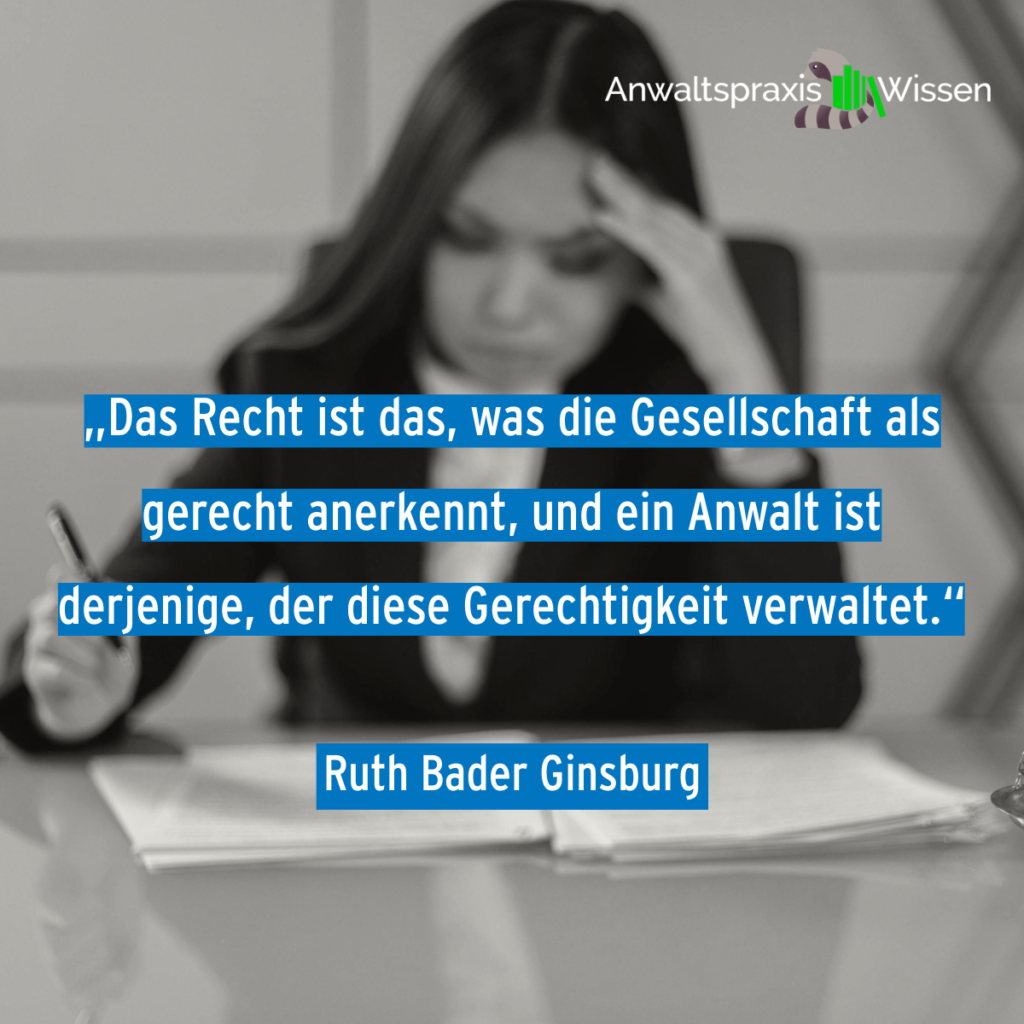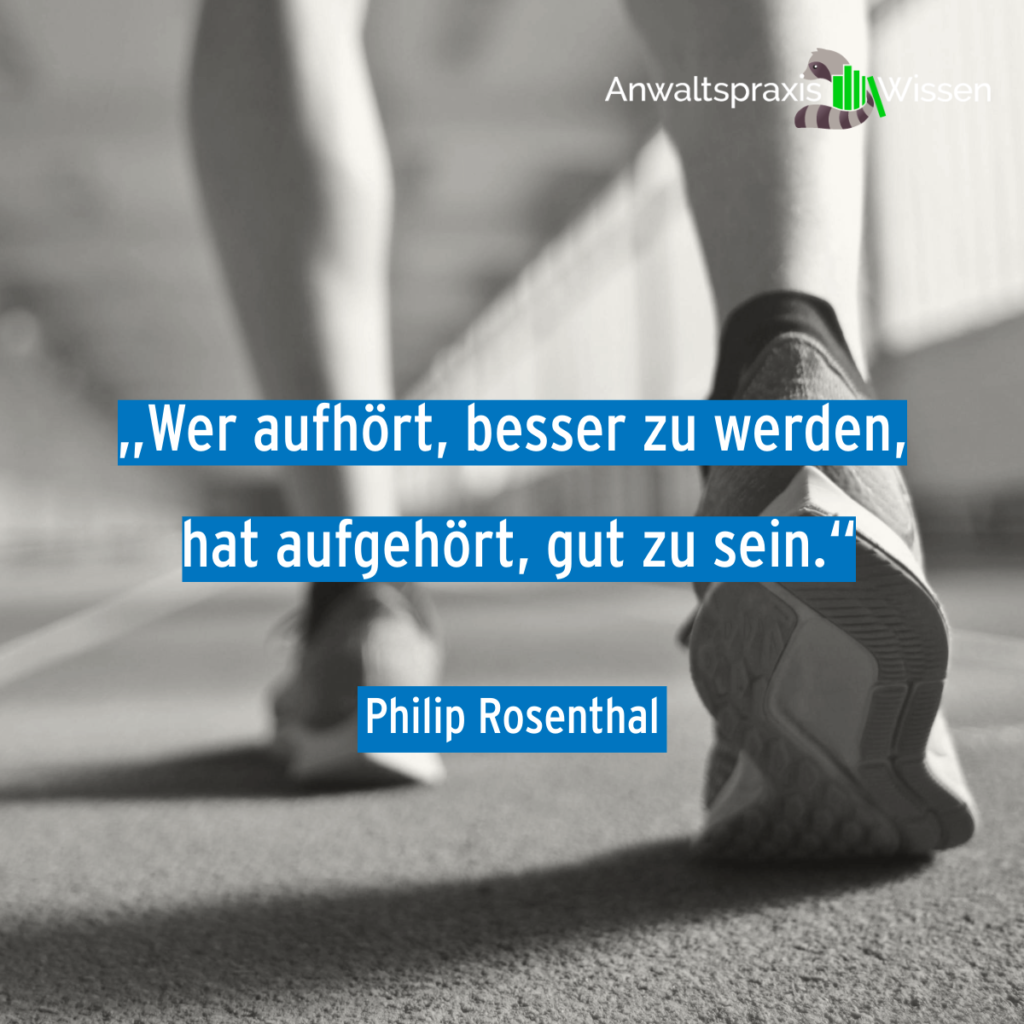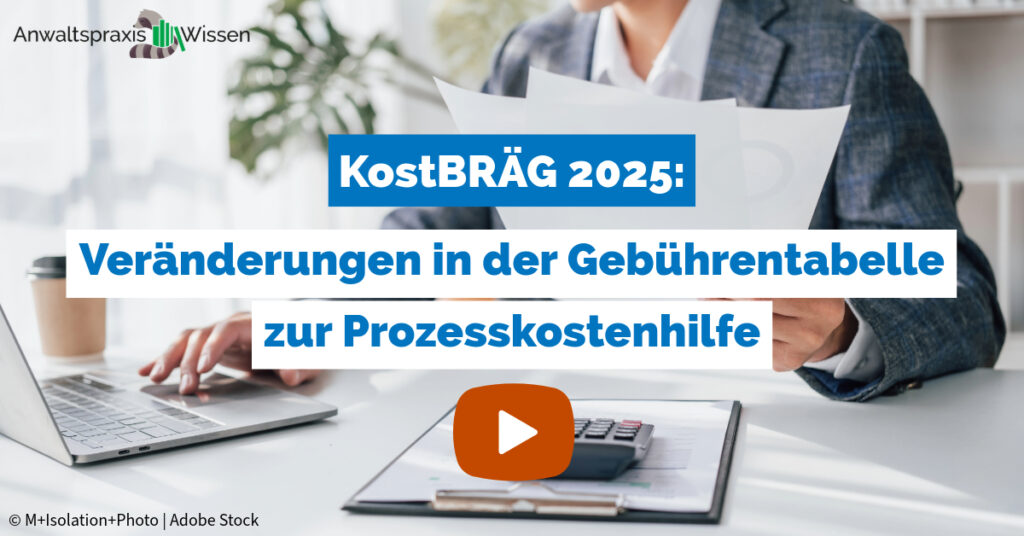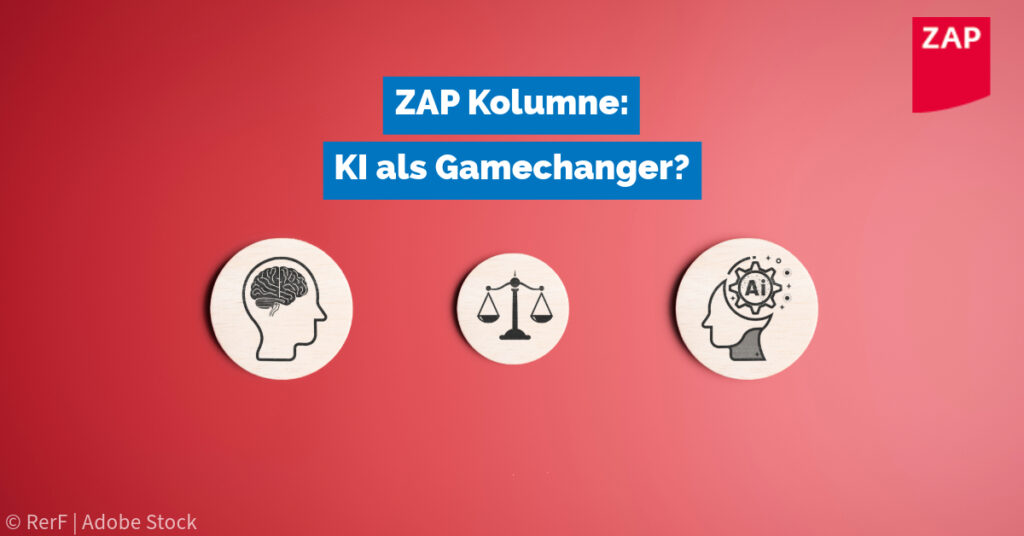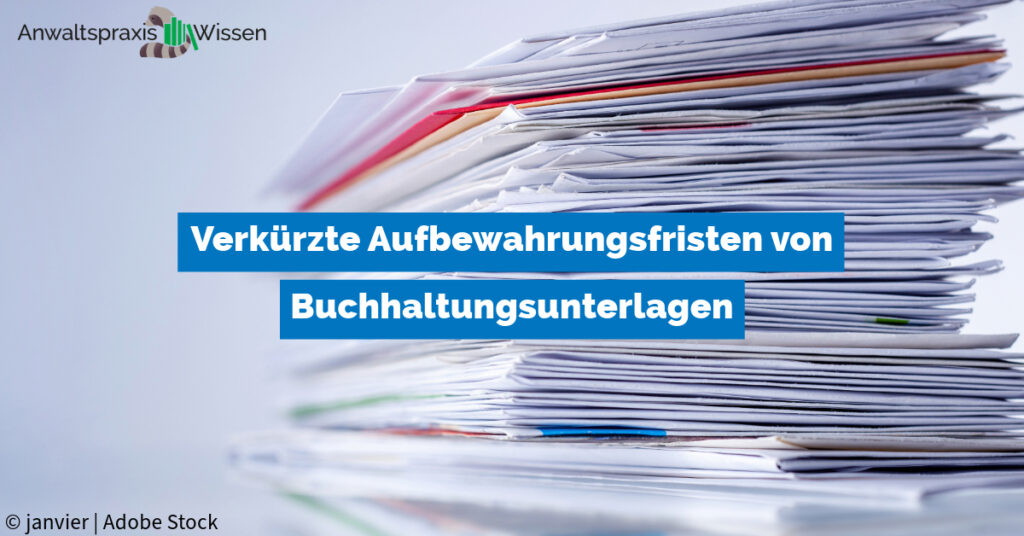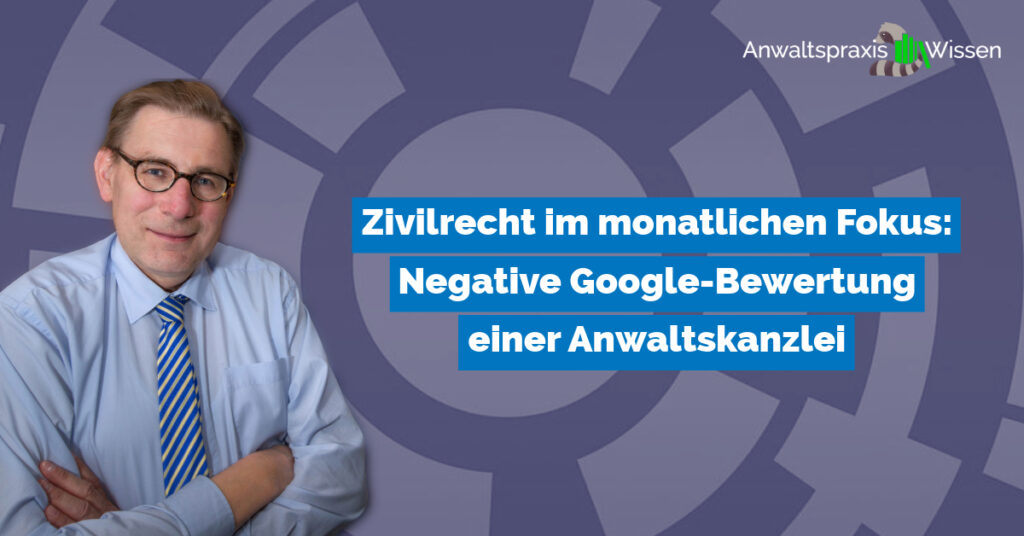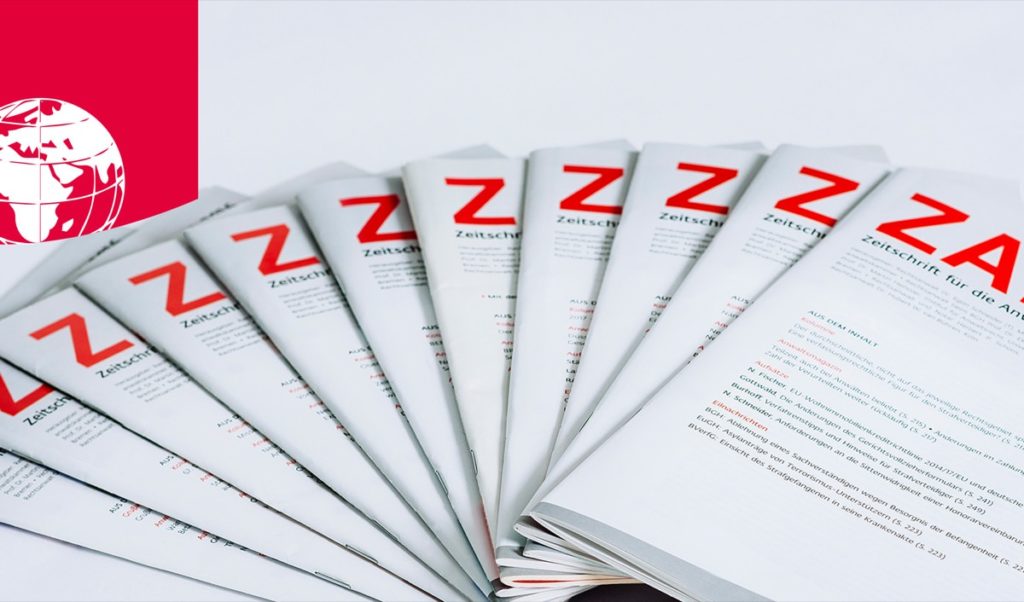Werden Zahlungskarten gestohlen, geht es im Einzelfall immer darum: Hat der Kunde fahrlässig gehandelt? Der Klassiker: Direkt auf der Bankkarte oder einem Zettel im Portemonnaie die eigene Geheimzahl notieren. Das AG München sieht Bankkunden aber aus dem Schneider, wenn eine notierte Geheimzahl nur mit mathematischem Geschick herauszubekommen ist.
Bankkarte gestohlen … und kurz darauf wird Konto geplündert
Dem Kläger wurde im Urlaub sein Geldbeutel samt Girocard gestohlen. Er hatte den Diebstahl zwar schnell bemerkt und ließ seine Karte sofort sperren. Trotzdem waren die Langfinger flotter und zapften 20 Minuten nach ihrem Beutezug noch 1.000 EUR am Geldautomaten ab. Die Bank belastete das Konto des Klägers mit diesem Betrag sowie den anfallenden Gebühren (11,00 EUR) für beide Abhebungen am Automaten. Der Kläger verlangte von seiner Bank die Zahlung der 1.011 EUR und obsiegte vor dem AG München beinahe vollständig.
PIN mit Zahlenspiel verstecken? Ja, aber dann bitte als harte Nuss …
Der Kläger hatte seine Girocard in der Geldbörse zusammen mit einem handgeschriebenen Zettel aufbewahrt. Eigentlich eine Todsünde, aber einfach so hingeschrieben hatte er seine vierstellige Geheimzahl auf dem Zettel nicht. Vielmehr hatte er diverse Telefonnummern notiert und darunter die PIN versteckt. Dabei hatte er diese in zwei Schritten in Primzahlen zerlegt und gelangte so zu den Ziffern 2, 7 und 317, die er zusammenhängend und ohne Bezug als Ziffer „27317“ auf den Zettel geschrieben hatte.
Grob fahrlässig war das nicht, meinte das AG München und sprach der beklagten Bank nur eine Summe von 150 EUR zu (= verschuldensunabhängiger Schadensersatzanspruch der Bank; § 675v Abs. 1 S. 1 BGB a.F.). Den eingeklagten Restbetrag von 861,00 EUR musste sie an den Kläger zahlen. Eine Bankkunde darf nach herrschender Meinung seine PIN verschlüsselt auch gemeinsam mit der Karte vorhalten, wenn die Verschlüsselung „ausreichend komplex ist“. Selbst ein im Rechtsstreit hinzugezogener Gutachter konnte die PIN des Klägers zunächst nicht ausknobeln. Für das AG lag daher eine „komplexe, individuelle Verschlüsselungsmethode“ vor, die – wenn man sie nicht kennt – als ausreichend sicher zu werten war. Angesichts der knappen Zeit zwischen Diebstahl und Geldabhebung konnte das Gericht nicht nachvollziehen, wie die Diebe die Geheimzahl so schnell ausrechnen konnten.
AG München, Urteil vom 02.06.2023 (nicht rechtskräftig)
– 142 C 19233/19 –