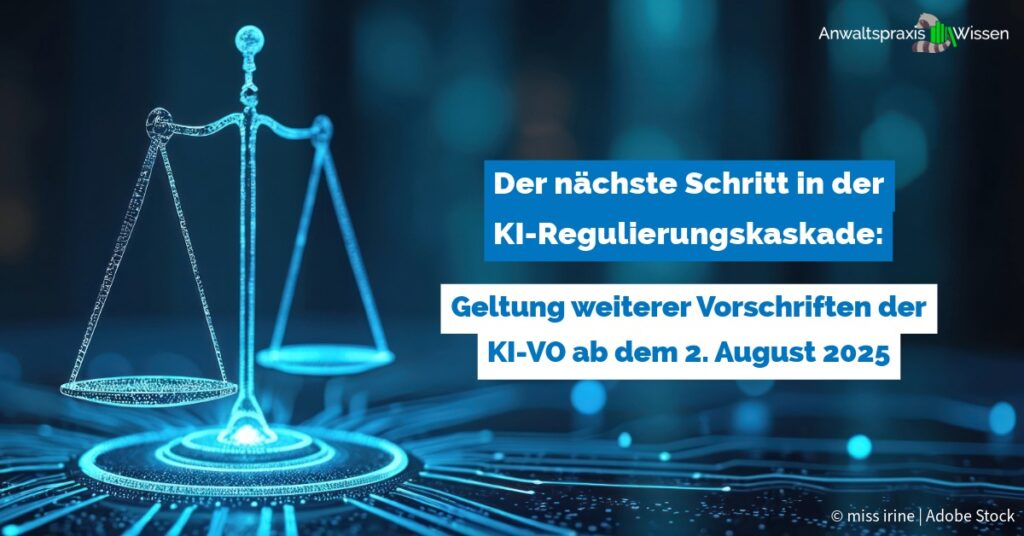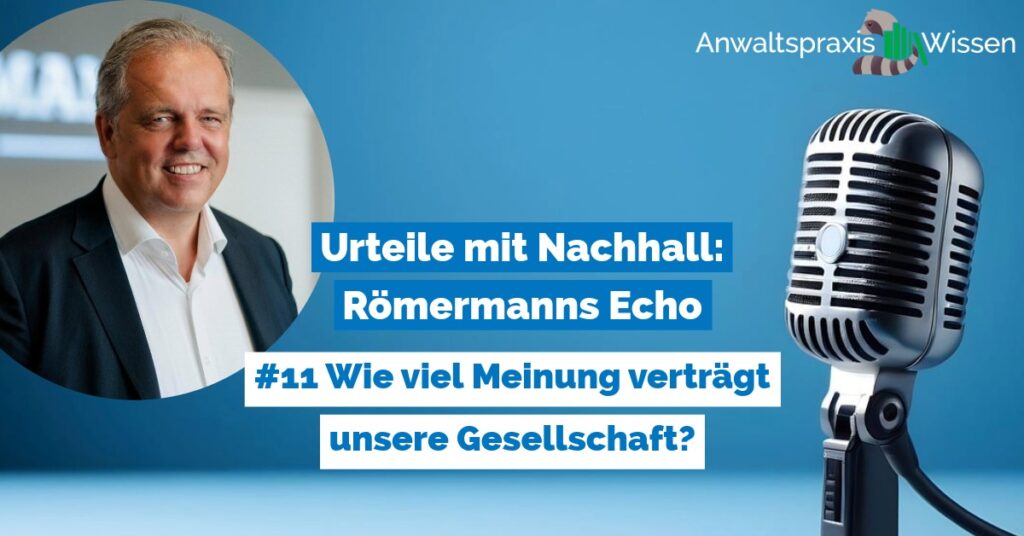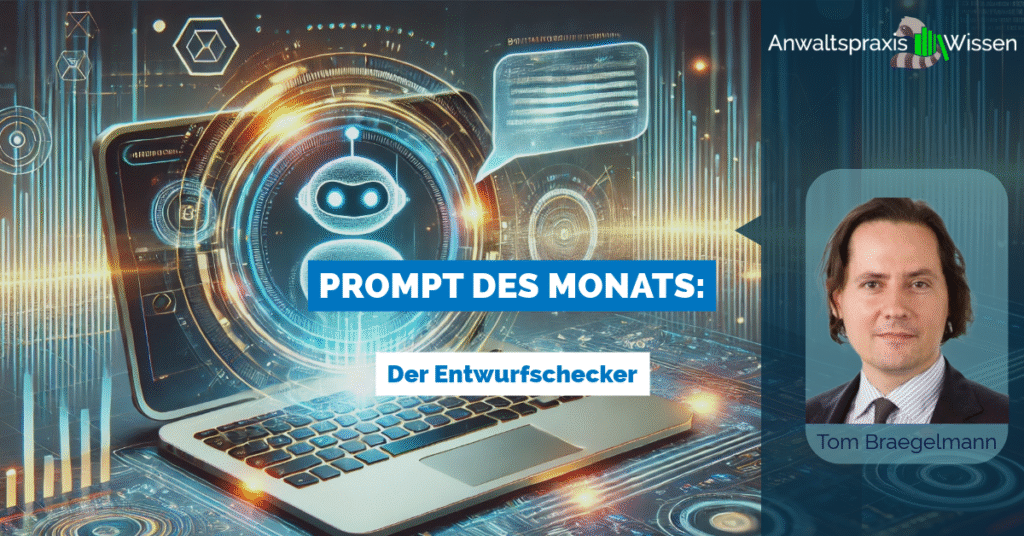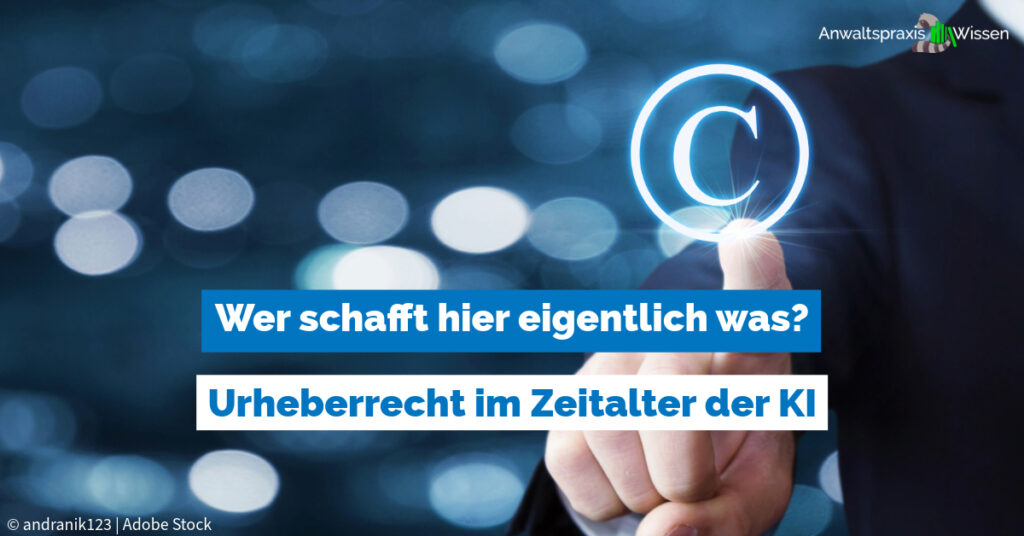Das Bundesjustizministerium plant derzeit offenbar, die Wertgrenzen für eine Reihe von Rechtsmitteln anzuheben. Dies berichteten im August u.a. die Bundesrechtsanwaltskammer und der Deutsche Anwaltverein. Danach sollen nach der Vorstellung des BMJ parallel zur Neuordnung der Eingangszuständigkeiten von Amts- und Landgerichten (s. dazu näher ZAP 2025, 676) auch die Rechtsmittelstreitwerte angepasst werden. Auch hier wird die geplante Änderung mit der zwischenzeitlich eingetretenen Inflationsentwicklung begründet. Die Erhöhung steht offenbar zudem im Zusammenhang mit einer in der Justiz für 2027 anstehenden Personalbedarfserhebung, mit der die erforderliche Personalstärke in den deutschen Justizbehörden anhand von Fallzahlen und Bearbeitungszeiten berechnet werden soll.
Wie die Bundesrechtsanwaltskammer berichtete, sollen konkret folgende Wertgrenzen angehoben werden:
-
Anhebung der Wertgrenze für Berufungen (§ 511 Abs. 2 Nr. 1 und Abs. 4 S. 1 Nr. 2 ZPO; § 64 Abs. 2b ArbGG), Beschwerden (§ 61 Abs. 1 und 3 FamFG) und das Verfahren nach billigem Ermessen (§ 495a ZPO) von derzeit 600 auf 1.000 €;
-
Anhebung der Wertgrenze für die Nichtzulassungsbeschwerde (§ 544 Abs. 2 Nr. 1 ZPO) von derzeit 20.000 auf 25.000 €;
-
Anhebung der Wertgrenze für Kostenbeschwerden (§ 567 Abs. 2 ZPO; § 304 Abs. 3 StPO; §§ 66 Abs. 2 S. 1, 68 Abs. 1 S. 1, 69 S. 1 GKG; §§ 57 Abs. 2 S. 1, 59 Abs. 1 S. 1, 60 S. 1 FamGKG; §§ 81 Abs. 2 S. 1, 83 Abs. 1 S. 1 GNotKG; §§ 4 Abs. 3, 9 Abs. 3 S. 1 JVEG; § 33 Abs. 3 S. 1 RVG) von derzeit 200 auf 300 €.
Mit Ausnahme der Nichtzulassungsbeschwerde entsprechen die Erhöhungen damit in etwa der Inflation seit den letzten Anpassungen im Jahr 2002 bzw. 2004. Die in der VwGO, der FGO und im SGG vorgesehenen Wertgrenzen sollen den Plänen des BMJ zufolge separat im Rahmen der dort anstehenden Reformen in Angriff genommen werden.
Für die Parteien eines Gerichtsverfahrens bedeutet die Anhebung von Wertgrenzen für ihre Rechtsmittel immer auch die Erschwerung des Zugangs zur nächsthöheren Instanz. Dass die Organisationen der Anwaltschaft deshalb genauer hinschauen, ob die Gesetzesbegründungen tragen, ist verständlich. So auch in diesem Fall: Dem vom BMJ geltend gemachten Aspekt der zwischenzeitlichen Inflation stimmen BRAK und DAV nur teilweise zu. Und insb. die BRAK sieht auch insgesamt „keine tragfähigen Gründe“ für eine generelle Anhebung der Rechtsmittelstreitwerte.
Die Kritik der Bundesrechtsanwaltskammer entzündet sich vornehmlich an der vorgesehenen Erhöhung der Berufungswertgrenze von 600 auf 1.000 €. Bislang bestehe, so die BRAK, ein Gleichlauf zwischen der Berufungswertgrenze gem. § 511 Abs. 2 Nr. 1 ZPO und der Wertgrenze des vereinfachten Verfahrens nach § 495a ZPO, die derzeit jeweils bei 600 € liege. Die angedachte Anhebung der Wertgrenze des § 495a ZPO auf 1.000 € parallel zur Anhebung der Berufungswertgrenze hätte gravierende Folgen, da dadurch ein Teil der Verfahren dem vereinfachten Verfahren ohne mündliche Verhandlung und ohne förmliche Beweiserhebung unterworfen würde. Dies stünde im Widerspruch zu dem rechtsstaatlichen Anspruch auf rechtliches Gehör i.S.d. Art. 103 Abs. 1 GG und einem effektiven Verfahren bei rechtlich oder tatsächlich anspruchsvollen Sachverhalten mit geringem Streitwert.
Auch würden künftig Auskunftsansprüche für Auskunftspflichtige in vielen Fällen faktisch von der Berufungsinstanz ausgeschlossen, da die Gerichte die Streitwerte hier traditionell recht niedrig bemessen würden. Dass diese Ansprüche weitgehend aus dem Anwendungsbereich des § 511 Abs. 2 Nr. 1 ZPO herausfallen dürften, sei aus rechtsstaatlicher Perspektive kritisch zu bewerten. Ähnliches gelte in familiengerichtlichen Verfahren: hier würde eine entsprechende Anhebung bedeuten, dass nur noch größere Streitwerte oder wirtschaftlich bedeutsame Angelegenheiten den Weg in das Beschwerdeverfahren fänden. Dies würde sich insb. in Unterhaltsverfahren für wirtschaftlich schwächere Parteien nachteilig auswirken, moniert die BRAK.
Kritisiert wird von ihr auch die avisierte Anhebung der Wertgrenze für Nichtzulassungsbeschwerden. Speziell hier dürfe nicht mit der Inflationsentwicklung argumentiert werden, erläutert die Kammer. Denn Sinn und Zweck der Einführung einer Wertgrenze für die Nichtzulassungsbeschwerde sei seinerzeit die „Belastungssteuerung“ der Revisionsinstanz gewesen. Vor dem Hintergrund der derzeit wieder abnehmenden Arbeitsbelastung des Bundesgerichtshofs lasse sich deshalb eine weitere Beschränkung des Zugangs zur Rechtsmittelinstanz gerade nicht mehr rechtfertigen.
Nicht tragfähig, so BRAK und DAV, sei die Argumentation mit der Inflation auch bei der geplanten Anhebung der Wertgrenze für Kostenbeschwerden. Hier seien die Kosten seit 2004 nämlich gar nicht der Inflation gefolgt, sondern den jeweiligen – viel geringeren – Anhebungen im RVG bzw. im GKG und im FamGKG. Der Anwaltverein hält bei der Kostenbeschwerde daher maximal eine Erhöhung auf 250 € für gerechtfertigt.
[Quelle: BRAK/DAV]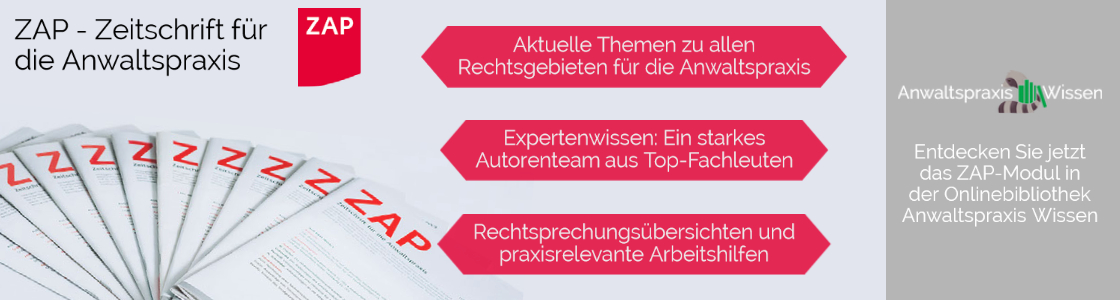
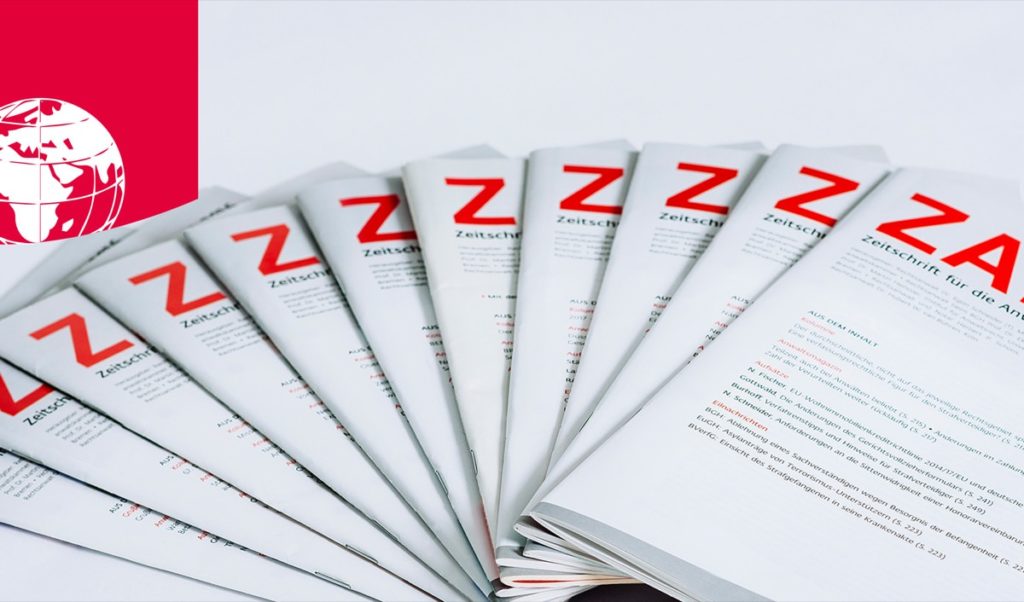


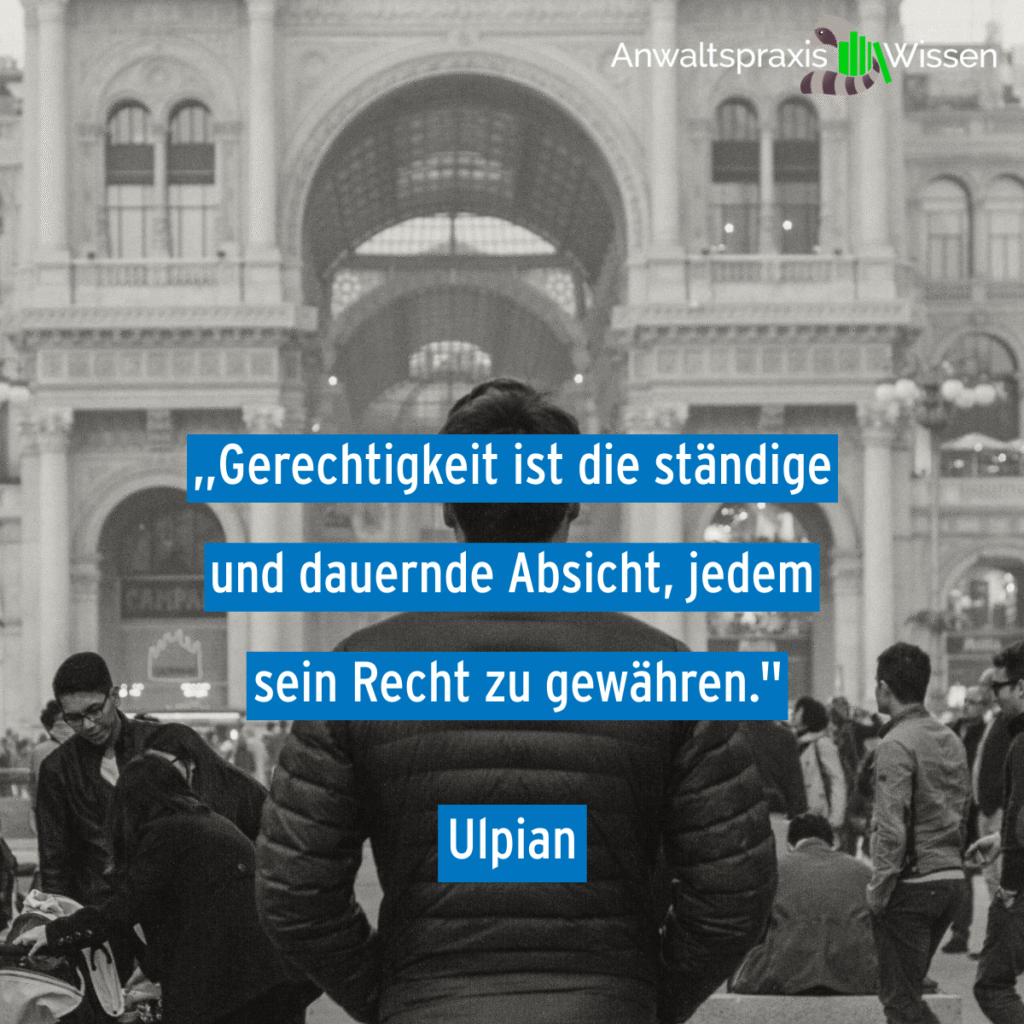

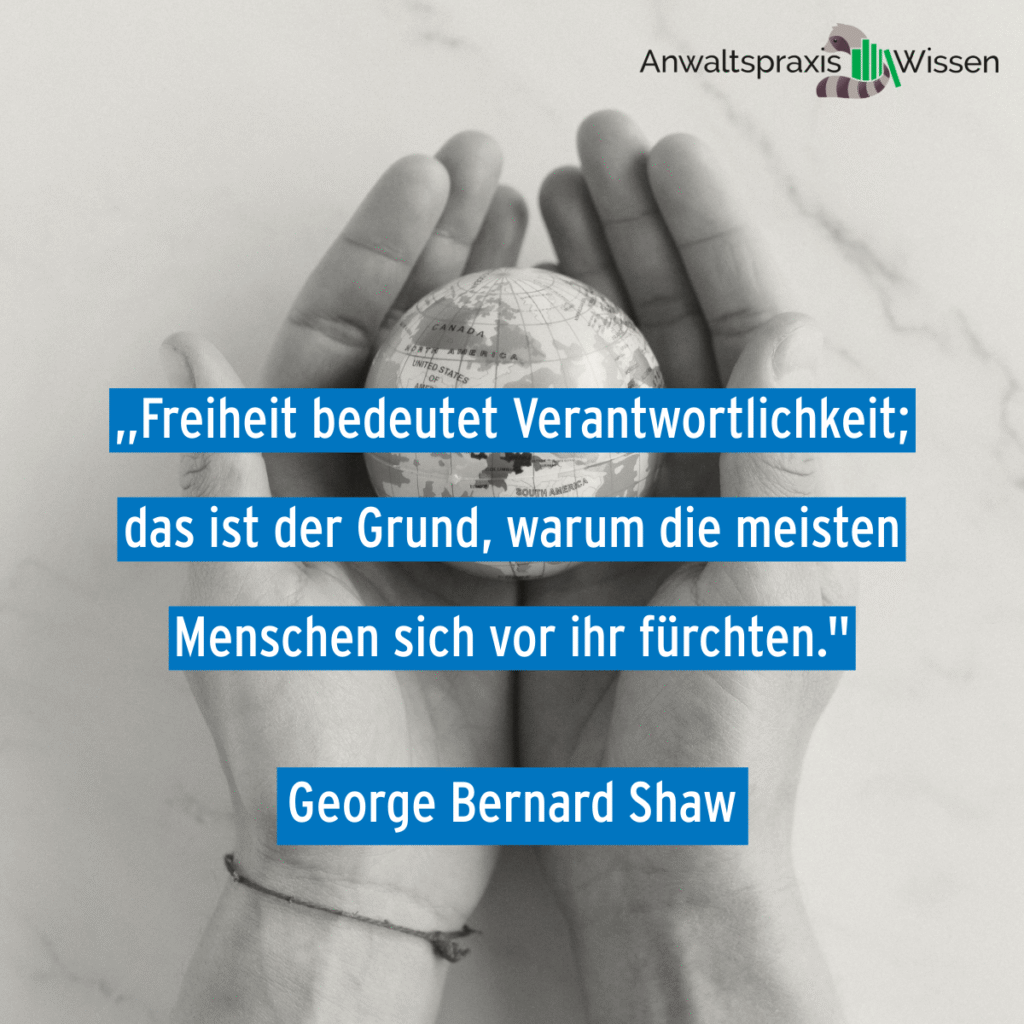

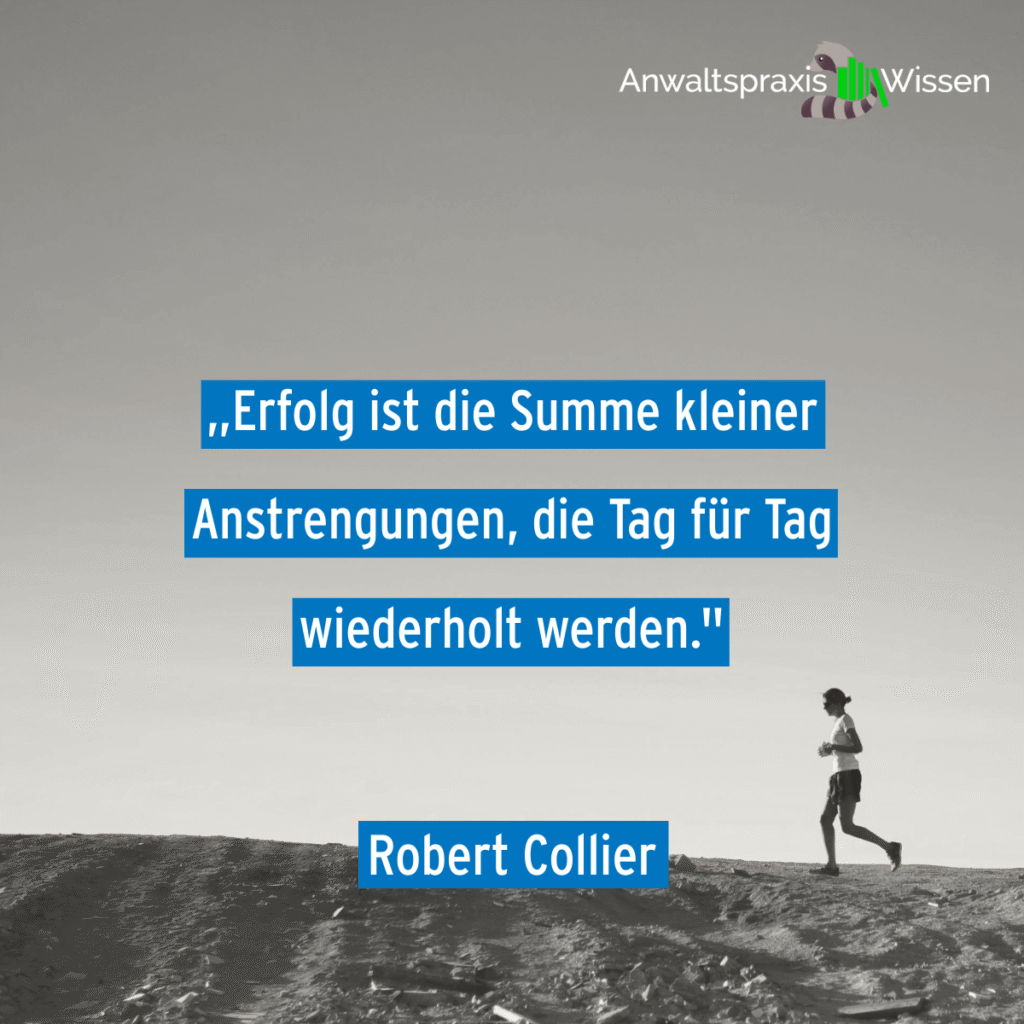


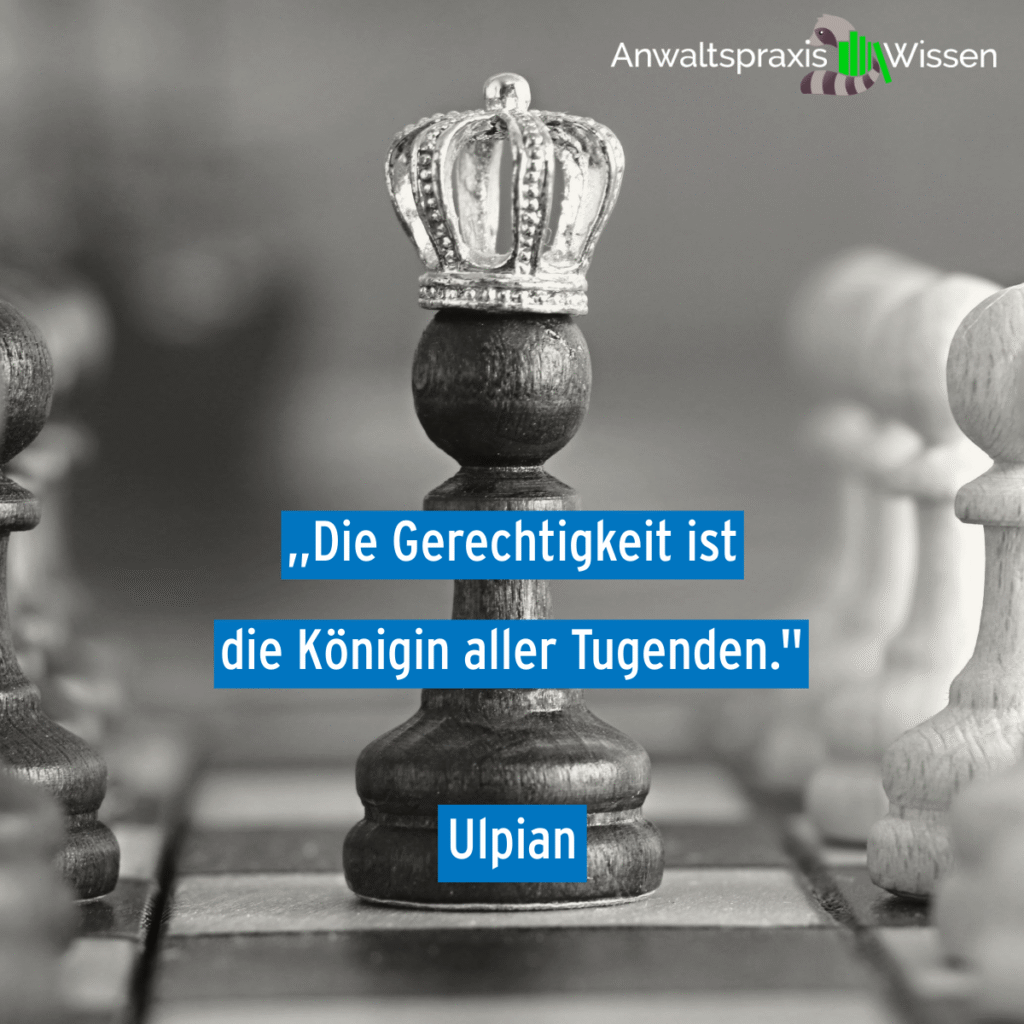

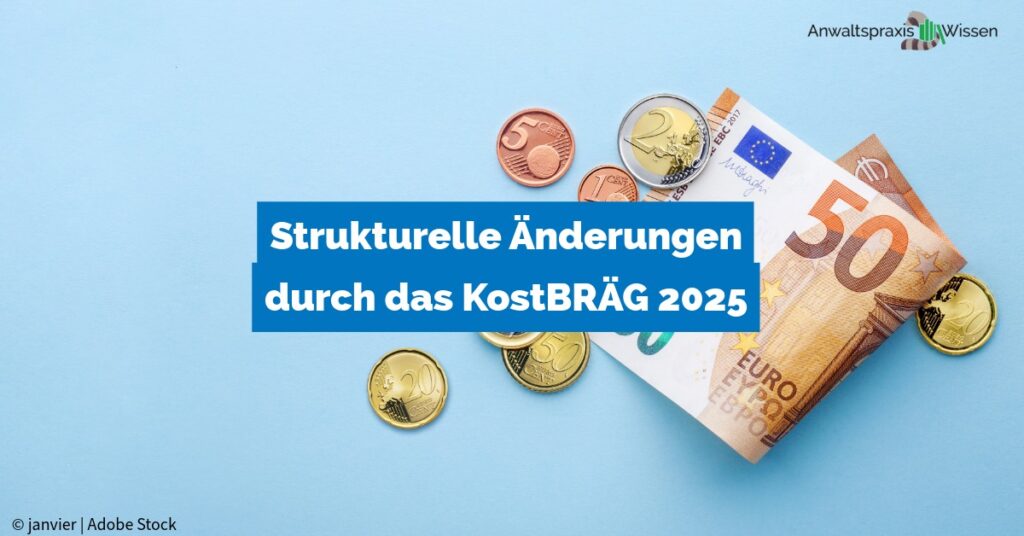

![Erbrecht im Gespräch: Kurze[s] Update: #19 Bestattungsrecht – mit Dr. Bernd Schmalenbach](https://anwaltspraxis-magazin.de/wp-content/uploads/2025/09/Erbrecht-im-Gespraech-19-1024x536.jpeg)