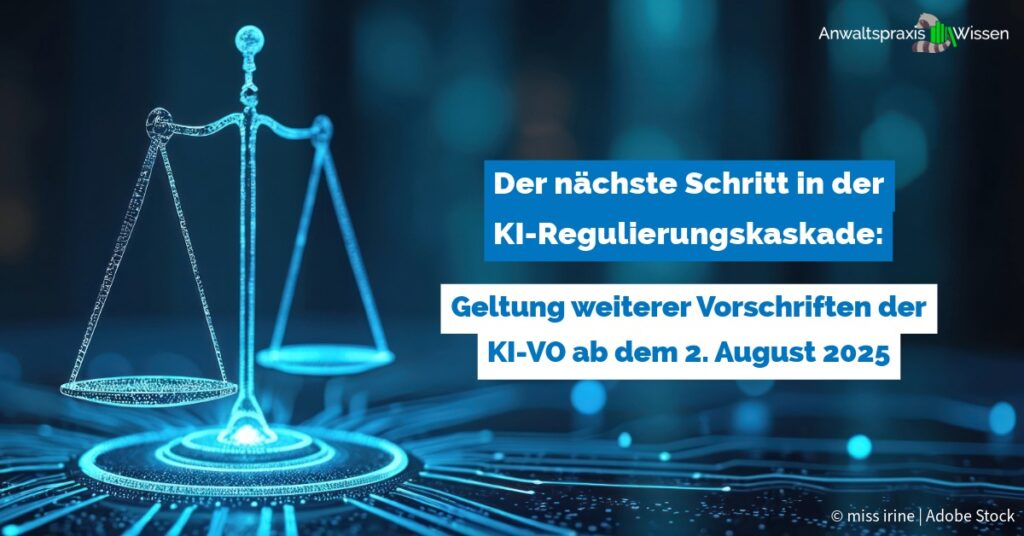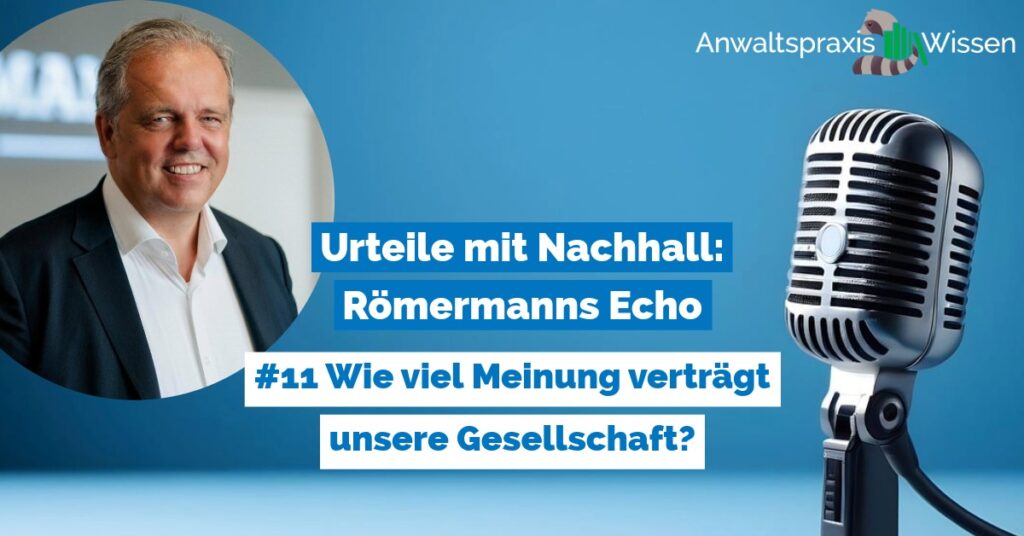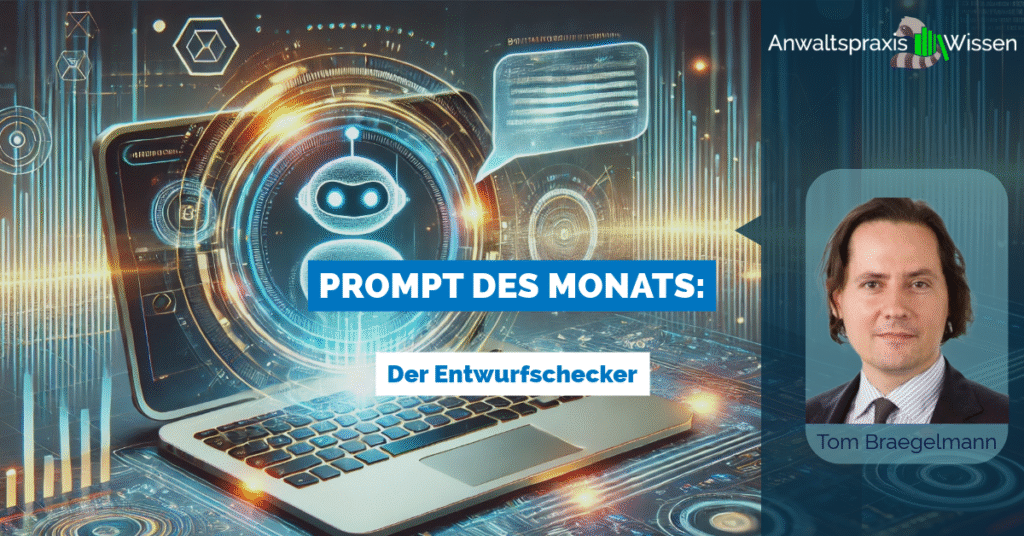Der Tatbestand der Steuerinterziehung in der Tatbestandsvariante des § 370 Abs. 1 Nr. 1 AO erfordert im Gegensatz zu demjenigen des Betruges nach § 263 StGB keine Täuschung. Insofern scheitert eine versuchte Steuerhinterziehung auch nicht daran, dass in anderer Weise als durch Täuschung der Hinterziehungserfolg eintreten sollte.
(Leitsätze des Verfassers)
I. Sachverhalt
Verluste aus ausländischem Gewerbebetrieb erklärt
Der Angeklagte hatte am 6.3.2010 beim Finanzamt seine Einkommensteuererklärung für das Jahr 2007 eingereicht. In der Anlage AUS (Anlage für ausländische Einkünfte) erklärt er Verluste aus Gewerbebetrieb in Höhe von 1.039.075 EUR (steuerliche Auswirkung 276.000 EUR), wobei er verschwieg, dass diese mangels seiner Gewinnerzielungsabsicht als stiller Gesellschafter einkommensteuerlich nicht anerkennungsfähig waren. Dies geschah, obgleich zuvor bereits das Finanzamt M mit Bescheid vom 7.9.2009 seinen Verlust aus der Auslandsbeteiligung im Zuge eines Feststellungsverfahrens nach § 180 Abs. 5 Nr. 1 AO nicht anerkannt hatte. Gegen diesen Bescheid legte der Angeklagte Einspruch ein und erhob am 27.11.2009 Klage, die am 8.10.2018 abgewiesen wurde. Das LG verurteilte den Angeklagten wegen versuchter Einkommensteuerhinterziehung.
II. Entscheidung
Keine gelungene Täuschung erforderlich
Der BGH bestätigte die Verurteilung wegen versuchter Steuerhinterziehung. Dabei setzt im Unterschied zum Betrug nach § 263 StGB die Steuerhinterziehung in der Tatbestandsvariante des § 370 Abs. 1 Nr. 1 AO bei der Tatvollendung keine gelungene Täuschung voraus. Im Gegensatz zum Wortlaut des § 370 Abs. 1 Nr. 2 AO ist nicht auf eine Kenntnis oder Unkenntnis der Finanzbehörde abzustellen (BGH, Beschl. v. 21.11.2012 – 1 StR 391/12, NZWiSt 2013, 235 m. Anm. Gehm). Dies ist auch bei einer versuchten Steuerhinterziehung zu beachten. Demnach genügt es, wenn die unrichtigen oder unvollständigen Angaben über steuerlich erhebliche Tatsachen in anderer Weise als durch Täuschung für die Steuerverkürzung oder das Erlangen nicht gerechtfertigter Steuervorteile ursächlich werden sollten. Folglich ist es für die versuchte Steuerhinterziehung ohne Belang, wenn der für die Einkommensteuerveranlagung zuständige Finanzamtsbedienstete Kenntnis über alle steuererheblichen Tatsachen gehabt haben bzw. im Besitz der diesbezüglichen Beweismittel gewesen sein sollte.
III. Bedeutung für die Praxis
Bestätigung der h.M.
Der BGH bestätigt die h.M., dass die Steuerhinterziehung zumindest in der Tatbestandsvariant des § 370 Abs. 1 Nr. 1 AO keine Täuschungshandlung voraussetzt. Somit kann eine Steuerhinterziehung nach § 370 Abs. 1 Nr. 1 AO auch begangen werden, wenn der für die Veranlagung zuständige Finanzamtsbedienstete den wahren Sachverhalt kennt und über die erforderlichen Beweismittel verfügt (Schott, in: Hüls/Reichling, Steuerstrafrecht, 2. Aufl. 2020, § 370 Rn 60; Jäger, in: Klein, AO Komm., 18. Aufl. 2024, § 370 Rn 42). Anders soll es sich aber nach strittiger Meinung bei der Unterlassens-Tatbestandsvariante des § 370 Abs. 1 Nr. 2 AO verhalten (Schott, in: Hüls/Reichling, Steuerstrafrecht, 2. Aufl. 2020, § 370 Rn 148, 229; a.A. Jäger, in: Klein, AO Komm., 18. Aufl. 2024, § 370 Rn 60d, allenfalls eine Frage der fehlenden kausalen Verknüpfung zwischen Tathandlung und Erfolg, sodass nur eine versuchte Steuerhinterziehung anzunehmen ist). Letztere Frage hat der BGH in der Besprechungsentscheidung nicht abschließend beantwortet. Klargestellt hat der BGH aber im Hinblick auf § 370 Abs. 1 Nr. 1 AO, dass auch bei der versuchten Steuerhinterziehung keine Täuschungsabsicht erforderlich ist.
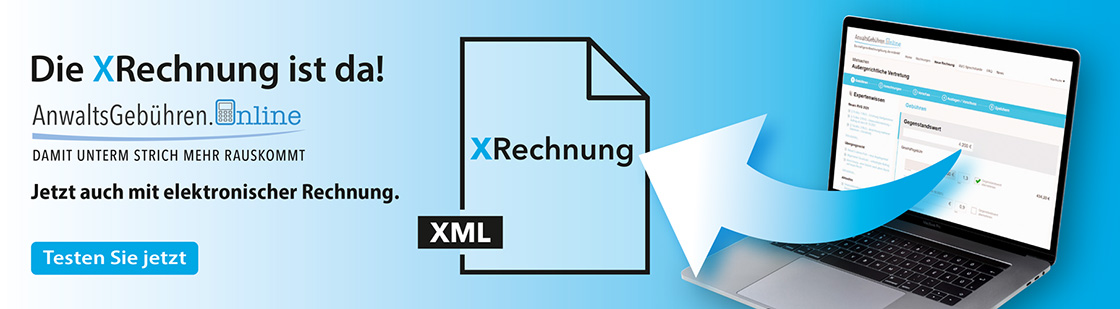



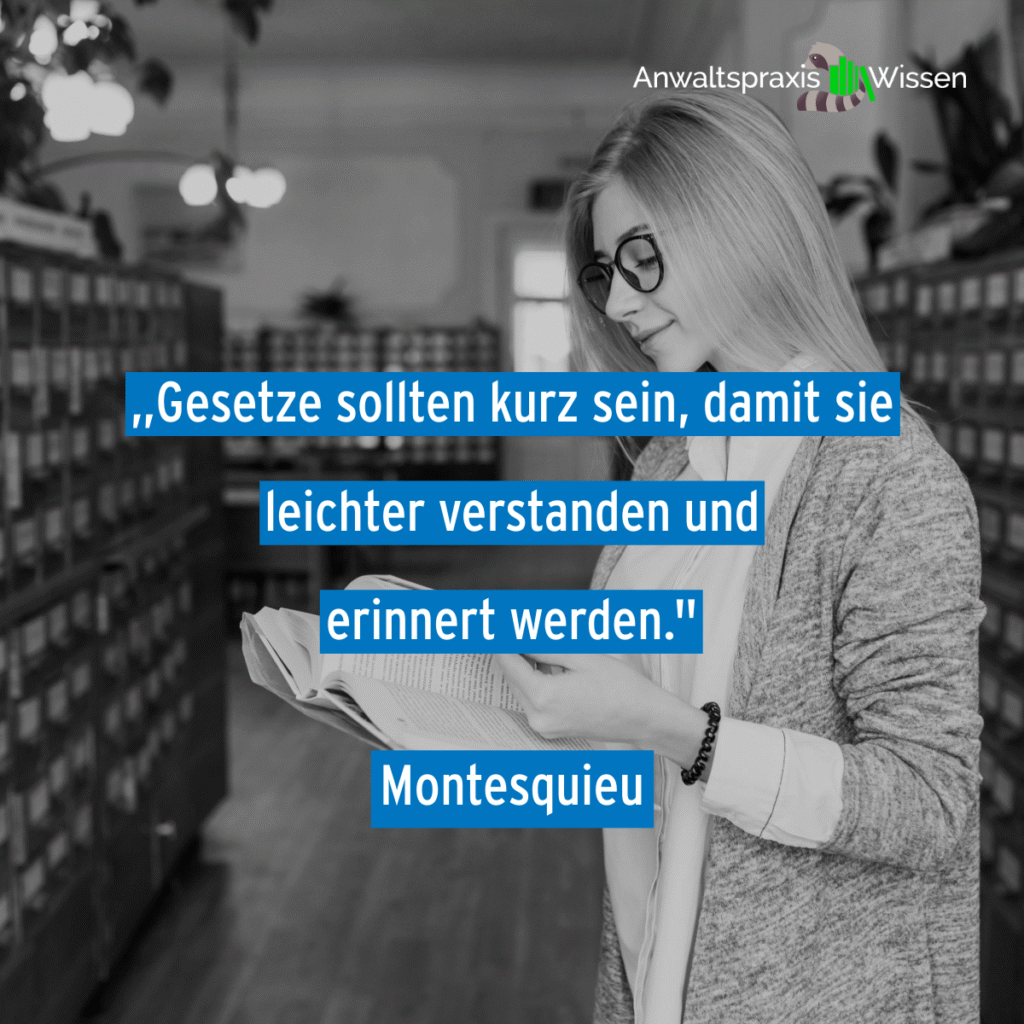
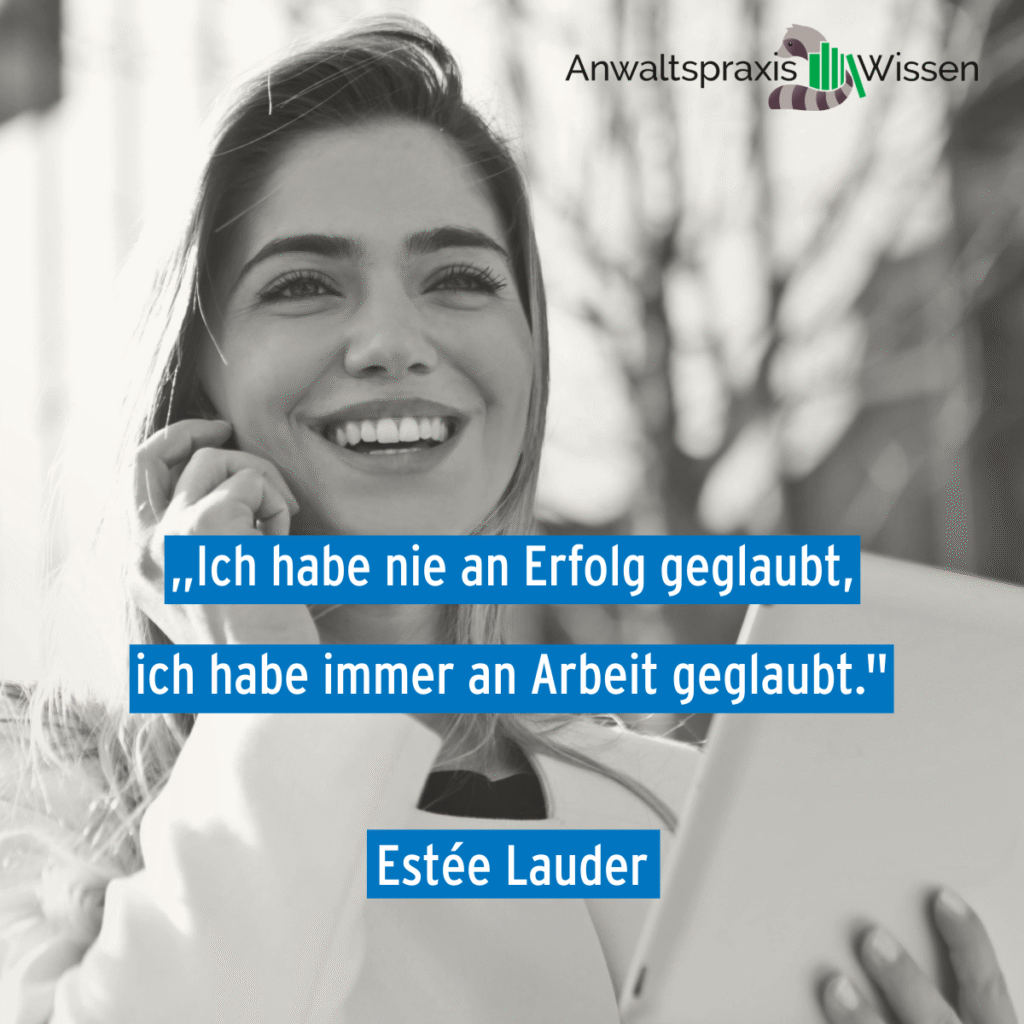

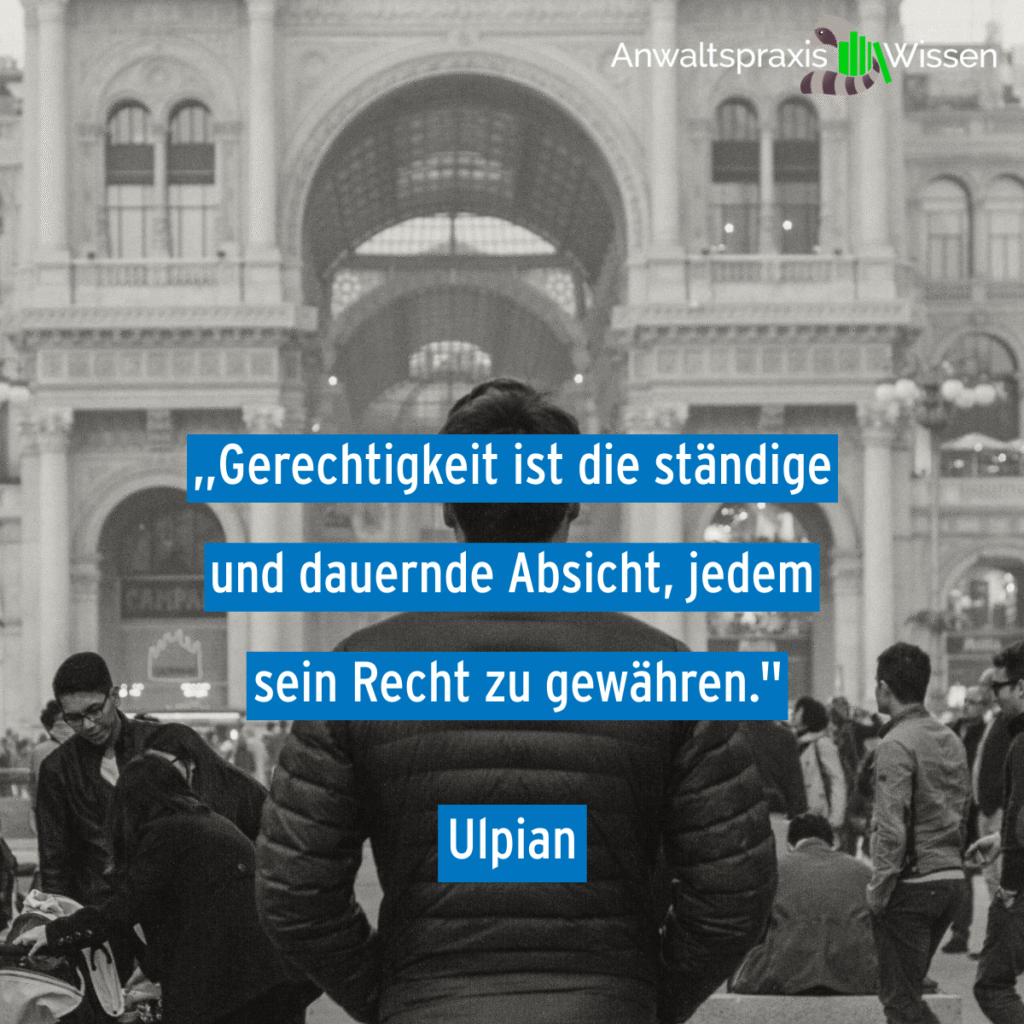

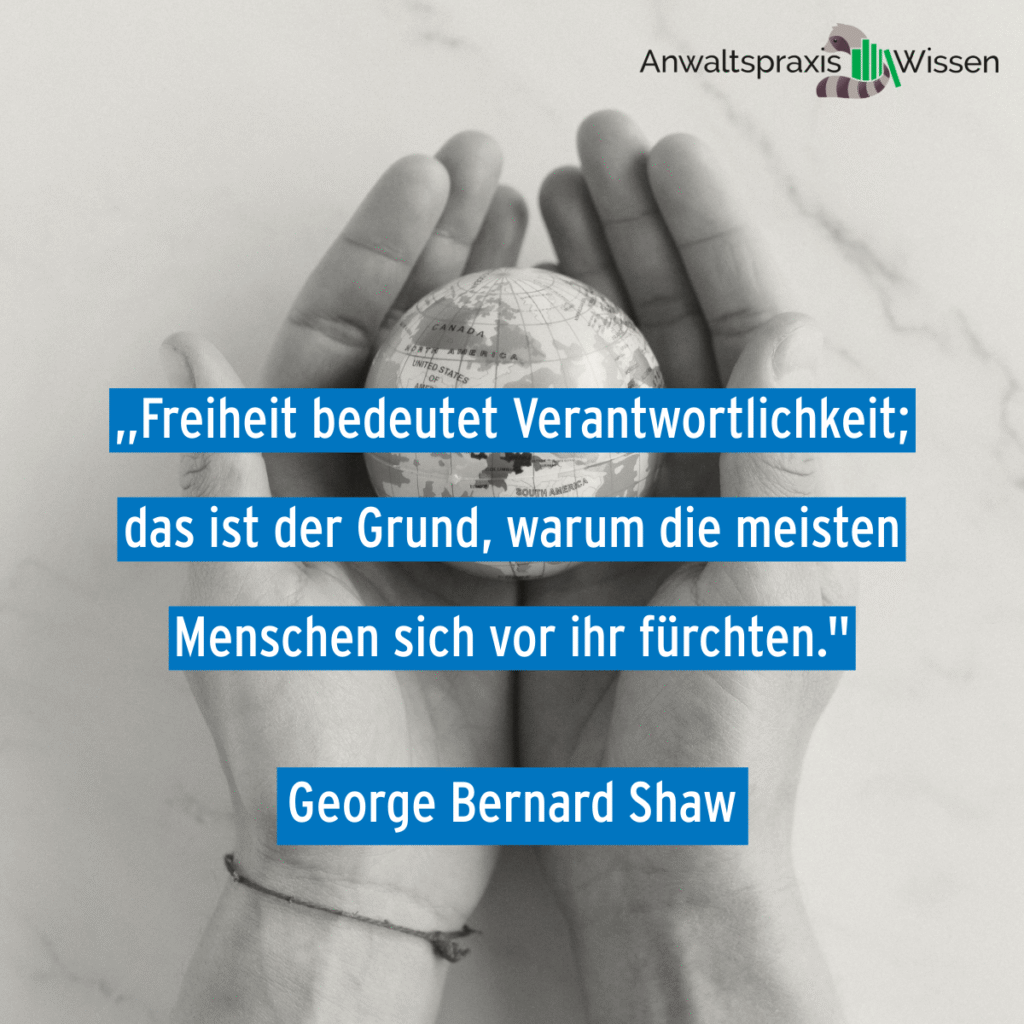

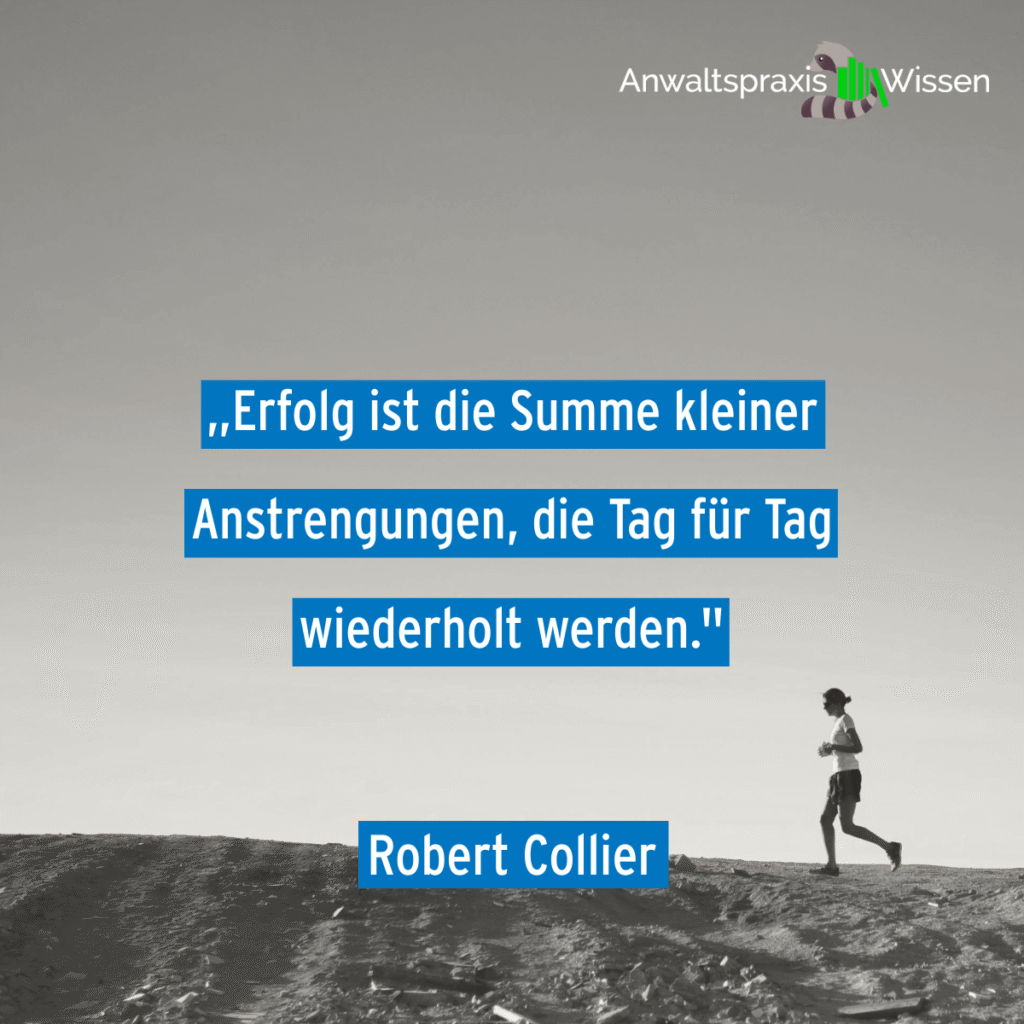

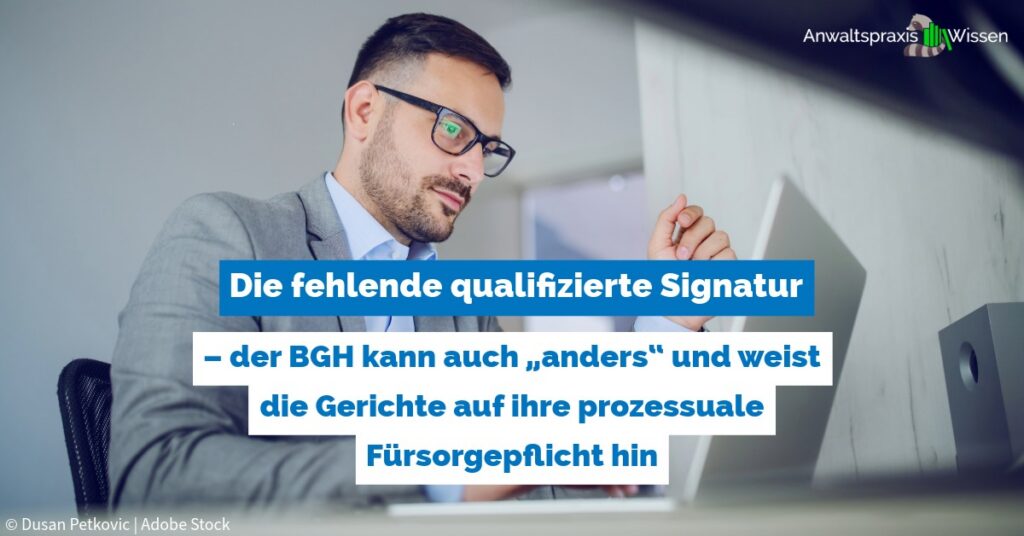

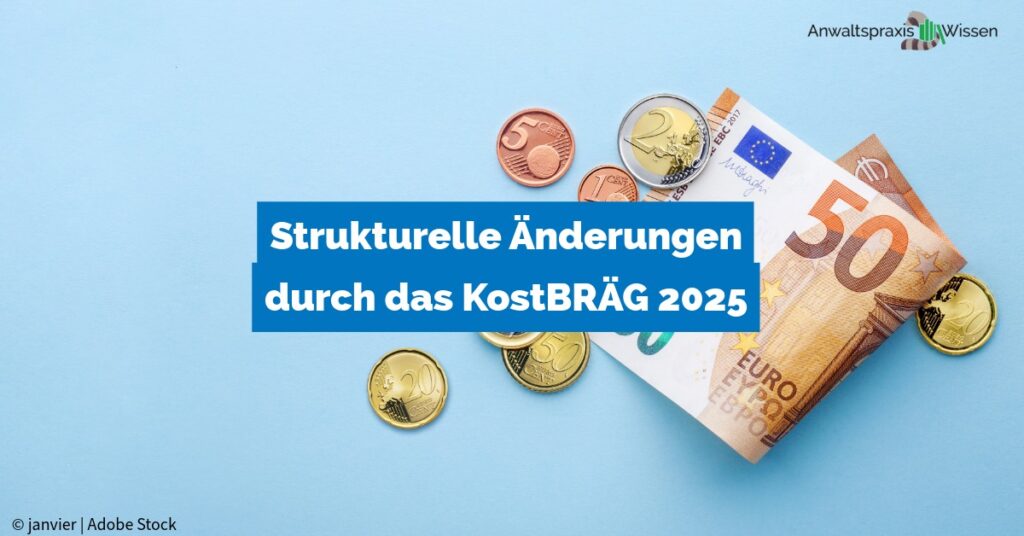

![Erbrecht im Gespräch: Kurze[s] Update: #19 Bestattungsrecht – mit Dr. Bernd Schmalenbach](https://anwaltspraxis-magazin.de/wp-content/uploads/2025/09/Erbrecht-im-Gespraech-19-1024x536.jpeg)