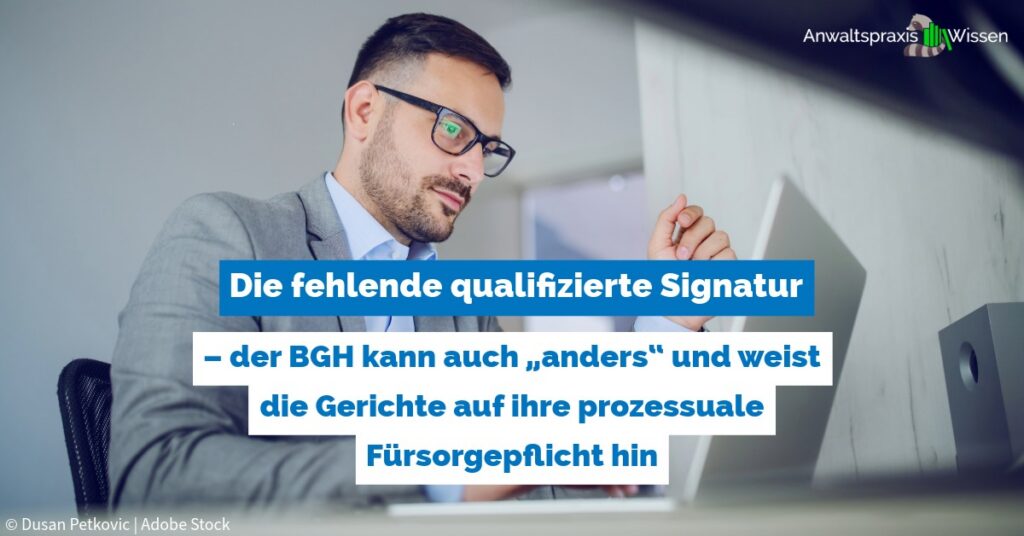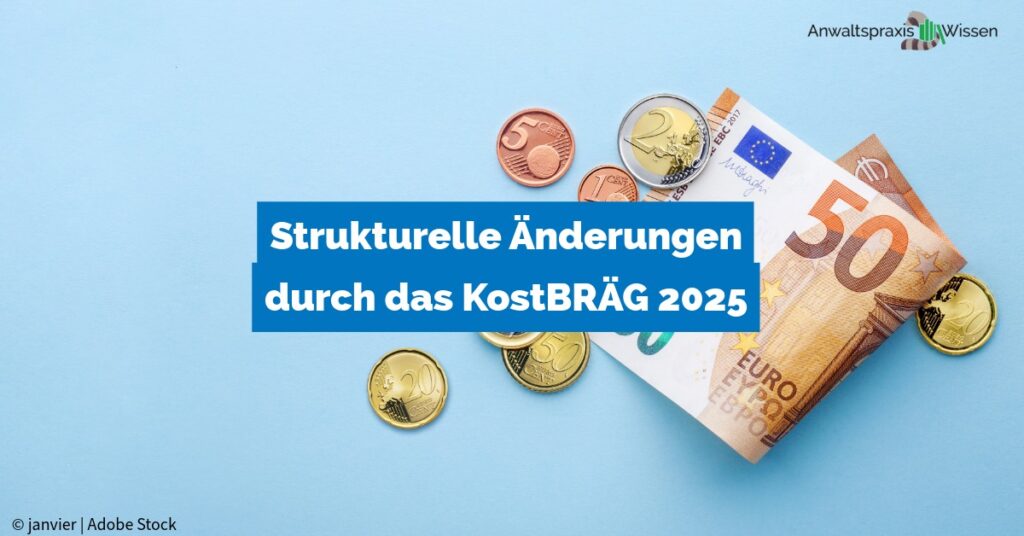1. Nach Wegfall des eine Überschreitung der Urteilsabsetzungsfrist gemäß § 275 Abs. 1 S. 4 StPO rechtfertigenden Umstandes muss das Urteil mit größtmöglicher Beschleunigung zu den Akten gebracht werden.
2. Unter Anwendung dieser Rechtsprechung ist bei einem 19-seitigen Berufungsurteil in Haftsachen die Verweildauer des Urteilsdiktats bei der Kanzlei von vier Arbeitstagen und die anschließende Verweildauer von weiteren drei Arbeitstagen bei dem mit einem Arbeitskraftanteil von 0,5 eingesetzten, parallel die Hauptverhandlung in einer – nachrangigen – Nichthaftsache vorbereitenden Vorsitzenden zu lang.
(Leitsätze des Gerichts)
I. Sachverhalt
Das AG hat den Angeklagten, der sich in dieser Sache seit dem 1.7.2022 in Untersuchungshaft befindet, mit Urteil vom 21.12.2022 wegen Diebstahls verurteilt. Die gegen dieses Urteil gerichtete Berufung des Angeklagten hat das LG Hannover mit Urteil vom 1.9.2023 nach fünftägiger Hauptverhandlung verworfen.
Mit seiner Revision rügt der Angeklagte insbesondere, dass das angefochtene Urteil nach einer zunächst begründeten Überschreitung der Frist gemäß § 275 Abs. 1 S. 2 und 4 StPO nach Wegfall des Hindernisses nicht mit der größtmöglichen Beschleunigung zu den Akten gebracht worden sei. Die Revision hatte beim OLG Erfolg.
II. Entscheidung
Verfahrensgang
Mit seiner Verfahrensrüge hatte der Angeklagte dem OLG folgenden Verfahrensgang unterbreitet. Er hatte dargelegt, dass die Berufungshauptverhandlung am 21.8.2023 begann, am 23., 28. und 30.8.2023 fortgesetzt und mit der Urteilsverkündung am 1.9.2023 beendet wurde. Er hat weiter ausgeführt, dass die Frist zur Absetzung des Urteils sieben Wochen betrug und am 20.10.2023 ablief. Die Revisionsschrift gab zudem den Inhalt der dienstlichen Erklärung des Vorsitzenden Richters der Strafkammer vom 7.11.2023 wieder, wonach er am 1.10.2023 einen Unfall erlitten habe und bis zum 30.10.2023 dienstunfähig gewesen sei. Am 1.11.2023 habe er seine Dienstgeschäfte wieder aufgenommen. Um das Urteil schleunigst zu den Akten zu bringen, habe er eine für den 6.11.2023 terminierte Sitzung aufgehoben und das Urteil am 7.11.2023 vollständig in Diktatform niedergelegt. Schließlich wird in der Revisionsschrift mitgeteilt, dass das Urteil am 16.11.2023 auf der Geschäftsstelle einging. Die Verfahrensrüge stellt darauf ab, dass das Urteil bereits am 2.11.2023 hätte abgesetzt werden müssen und die dienstliche Erklärung keine Angaben dazu enthalte, was dem entgegengestanden habe. Zudem verweist sie auf den Beschleunigungsgrundsatz in Haftsachen.
Urteil zu spät bei den Akten
Nach § 275 Abs. 1 S. 4 StPO dürfe die Urteilsabsetzungsfrist, die hier am 20.10.2023 abgelaufen sei, nur überschritten werden, wenn und solange das Gericht durch einen im Einzelfall nicht voraussehbaren unabwendbaren Umstand an ihrer Einhaltung gehindert worden ist. Der Unfall des Vorsitzenden am 1.10.2023 und seine daraus folgende Dienstunfähigkeit bis zum 30.10.2023 einschließlich stellen nach Auffassung des OLG zwar einen solchen nicht voraussehbaren unabwendbaren Umstand dar, der mithin eine Fristüberschreitung gemäß § 275 Abs. 1 S. 4 StPO rechtfertigte. Jedoch hätte das Urteil – so das OLG – nicht erst am 16.11.2023 zu den Akten gelangen dürfen.
Urteil muss in Schriftform vorliegen
Das Urteil sei nicht bereits am 7.11.2023 i.S.v. § 275 Abs. 1 S. 2 StPO zu den Akten gebracht worden. An diesem Tag habe der Vorsitzende das Urteil vielmehr nur „in Diktatform niedergelegt“. Das auf einen Tonträger diktierte Diktat genüge aber nicht. Vielmehr müsse das zu den Akten gebrachte Urteil in Schriftform vorliegen und von allen Berufsrichtern unterzeichnet sein (vgl. Meyer-Goßner/Schmitt, StPO, 66. Aufl. 2023, § 275 Rn 3 m.w.N.). Das sei erst am 16.11.2023 der Fall gewesen. Am Morgen dieses Tages habe der Vorsitzenden gegen 9:30 Uhr das von ihm unterschriebene Urteil persönlich auf die Geschäftsstelle gebracht.
Nachfrist unter den besonderen Umständen des Falles an sich nicht zu lang
Nach Wegfall des Hindernisses müsse das Urteil mit größtmöglicher Beschleunigung zu den Akten gebracht werden (vgl. BGH NStZ 1982, 519; StV 1995, 514). Nach dieser Rechtsprechung des BGH seien insoweit Verzögerungen von vier Arbeitstagen nicht mehr zu rechtfertigen. Im vorliegenden Fall waren es von der Wiederaufnahme der Dienstgeschäfte des Vorsitzenden am 1.11.2023 bis zum Eingang des unterschriebenen Urteils auf der Geschäftsstelle am 16.11.2023 zwölf Arbeitstage (16 Kalendertage). Im Hinblick darauf, dass auf der einen Seite die Hauptverhandlung fünf Tage in Anspruch nahm, der Angeklagte jede Tatbeteiligung bestritt, eine umfassende Beweiswürdigung unter Auswertung auch eines Sachverständigengutachtens vorzunehmen war und das fertige Urteil 19 Seiten füllt, auf der anderen Seite der Vorsitzende seiner dienstlichen Stellungnahme vom 14.2.2024 zufolge nur mit einem Arbeitskraftanteil von 0,5 eingesetzt ist, nach Wiederaufnahme seiner Tätigkeit am 1.11.2023 und Durchsicht sämtlicher aufgelaufener von insgesamt 37 in der Kammer anhängigen Sachen die vorrangig zu bearbeitenden Verfahren gesichtet und sodann unverzüglich mit der Bearbeitung der vorliegenden Sache begonnen, eine auf den 6.11.2023 terminierte Hauptverhandlung aufgehoben und zudem trotz seiner halben Stelle das Urteil am 7.11.2023 ganztägig zu Ende diktiert sowie unter „Eilt sehr! Haft!“ persönlich zur Geschäftsstelle gebracht habe, wo es um 16:53 Uhr zur weiteren Bearbeitung durch die Phonokanzlei ins Netz gestellt worden sei, erscheinen die vom Vorsitzenden für das vollständige Diktieren des Urteils insgesamt benötigten fünf Arbeitstage (sieben Kalendertage) nicht als unangemessen lang.
„Schreibdauer“ und Korrekturphase aber zu lang
Unangemessen lang sei hingegen die Zeit von sieben weiteren Arbeitstagen (neun Kalendertagen) vom Eingang des Diktats auf der Geschäftsstelle am 7.11.2023 bis zum Eingang des unterschriebenen Urteils dort am 16.11.2023. Die dienstliche Stellungnahme des Vorsitzenden vom 14.2.2024 führe dazu aus, dass die zuständige Justizangestellte der Phonokanzlei, die auf Fünf-Stunden-Basis täglich beschäftigt sei, sowohl für den Straf- als auch für den Zivilbereich zu schreiben habe und zusätzlich eine seit Oktober 2023 erkrankte Kollegin vertreten müsse, das Schreiben des Diktats nach ihrer Erinnerung entweder am 8.11.2023, eher aber am 9.11.2023 begonnen und ihm das geschriebene Diktat am 13.11.2023 zugeleitet habe. Er habe den Urteilsentwurf am Morgen des 14.11.2023 auf seinem Schreibtisch vorgefunden und neben der Sitzungsvorbereitung für die auf den 16.11.2023 angesetzte Hauptverhandlung mit Fortsetzungstermin am 20.11.2023 unverzüglich weiterbearbeitet.
Angesichts des Urteilsumfangs von 19 Seiten sei sowohl die Verweildauer des Diktats von vier Arbeitstagen (sechs Kalendertagen) bei der Phonokanzlei als auch die Verweildauer beim Vorsitzenden von drei weiteren Arbeitstagen zu lang. Da Strafsachen stets Zivilsachen vorgehen und nicht ersichtlich sei, dass die zuständige Kanzleikraft am 8.11.2023 Diktate in vorrangigen Strafsachen zu schreiben hatte, hätte sie die vorliegende, als solche gekennzeichnete Haftsache gleich am 8.11.2023 bearbeiten müssen und hätte das Schreiben des 19-seitigen Urteils auch gut im Rahmen ihrer fünfstündigen Arbeitszeit an diesem Tag bewältigen können, sodass der Entwurf dem Vorsitzenden bereits am nächsten Tag (9.11.2023) hätte wieder vorliegen können. Auch dieser hätte den Entwurf noch am Tag des Vorfindens auf seinem Schreibtisch (14.11.2023) sowie – im Hinblick auf seine halbe Stelle auch noch – am Folgetag (15.11.2023) Korrektur lesen, fertigstellen, unterschreiben und zu den Akten bringen müssen, anstatt dies wegen der parallelen Vorbereitung auf eine nicht vorrangige neue Hauptverhandlung am 16.11.2023, die er vielmehr – wie zuvor schon die Sitzung vom 6.11.2023 – hätte aufheben müssen, um einen weiteren Tag (bis zum Morgen des 16.11.2023) zu verschieben. Dann wären es von der Wiederaufnahme der Dienstgeschäfte des Vorsitzenden bis zum Eingang des unterschriebenen Urteils auf der Geschäftsstelle insgesamt nur acht statt zwölf Arbeitstage (zehn statt 16 Kalendertage) gewesen. Die Vorbereitung einer Nichthaftsache hat gegenüber der raschen Absetzung eines überfälligen Urteils zurückzutreten (KG StV 2016, 798).
Mangelnde Gerichtsorganisation
Der Umstand, dass drei der insgesamt vier und damit der Großteil der zu viel benötigten Arbeitstage nicht vom Vorsitzenden selbst, sondern von der gleichzeitig mit Straf- und Zivilsachen sowie einer Krankheitsvertretung belasteten Teilzeitkraft der Phonokanzlei verursacht worden sei, führe nicht zu einer anderen Würdigung, weil es sich um Umstände handele, die die Organisation des Gerichts betreffen, und solche Umstände in der Regel schon eine Fristüberschreitung nicht zu rechtfertigen vermögen (vgl. Meyer-Goßner/Schmitt, a.a.O., § 275 Rn 14 m.w.N.), was dann erst recht für die Zeit nach Wegfall des Hindernisses gelten müsse. Auch aus Sinn und Zweck der Vorschrift lasse sich nichts anderes ableiten. Die Urteilsabsetzungsfrist, die das Beschleunigungsgebot konkretisiere, solle verhüten, dass ein längeres Hinausschieben der Urteilsabfassung die Zuverlässigkeit der Erinnerung der erkennenden Richter beeinträchtigt und zu einer Darstellung der Sach- und Rechtslage in den Urteilsgründen führe, bei der nicht mehr gesichert sei, dass sie der das Urteil tragenden Ansicht der Richter bei der Beratung entspreche (vgl. LR-StPO, 27. Aufl., § 275 Rn 2 m.w.N.). Dieser Gesetzeszweck sei auch dann verletzt, wenn zwischen dem vollständigen Diktieren des Urteils und der abschließenden Unterschrift unangemessen viel Zeit verstreiche. Das gelte im vorliegenden Fall umso mehr, als zusätzlich das besondere Beschleunigungsgebot in Haftsachen zu beachten gewesen sei.
III. Bedeutung für die Praxis
Dauerbrenner
1. Die Versäumung der Urteilsabsetzungsfrist (§ 275 Abs. 1 S. 4 StPO) spielt in der Praxis immer wieder eine Rolle und zählt daher sicherlich zu den verfahrensrechtlichen „Dauerbrennern“. So auch dieser Beschluss des OLG Celle, der allerdings zu einer Abwandlung Stellung nimmt, nämlich zu der Frage: Wie lange darf es nach Wegfall des eine Überschreitung der Urteilsabsetzungsfrist rechtfertigenden Umstandes dauern, bis das Urteil zur Akte gebracht ist? Nun, die Antwort liegt auf der Hand: Nicht zu lange und das OLG erwartet besondere Anstrengungen sowohl von dem verhinderten Richter als auch von der Justiz und der Gerichtsverwaltung. Das erste war hier gegeben, das zweite offensichtlich nicht.
Umfangreiche Begründung der Verfahrensrüge nach Akteneinsicht
2. Für den Verteidiger gilt: Er muss die Überschreitung der Urteilsabsetzungsfrist mit der Verfahrensrüge geltend machen (§ 338 Nr. 7 StPO). Zu deren Begründung muss in tatsächlicher Hinsicht vorgetragen werden, dass das unterschriebene Urteil nicht innerhalb der Frist zur Akte gelangt ist. Dabei sind alle Tatsachen darzulegen, die eine sichere Berechnung der sich aus § 275 Abs. 1 StPO ergebenden Frist ermöglichen. Auch das Datum des Urteilseingangs auf der Geschäftsstelle ist anzugeben (vgl. OLG Celle, Beschl. v. 1.3.2023 – 2 ORs 10/23). Diese Voraussetzungen waren hier erfüllt. Wegen der hohen Anforderungen an eine ausreichende Begründung der Verfahrensrüge sollte der Verteidiger auf jeden Fall noch einmal Akteneinsicht nehmen, um so alle ersichtlichen Verfahrensvorgänge in Zusammenhang mit der Fristversäumung vortragen zu können.
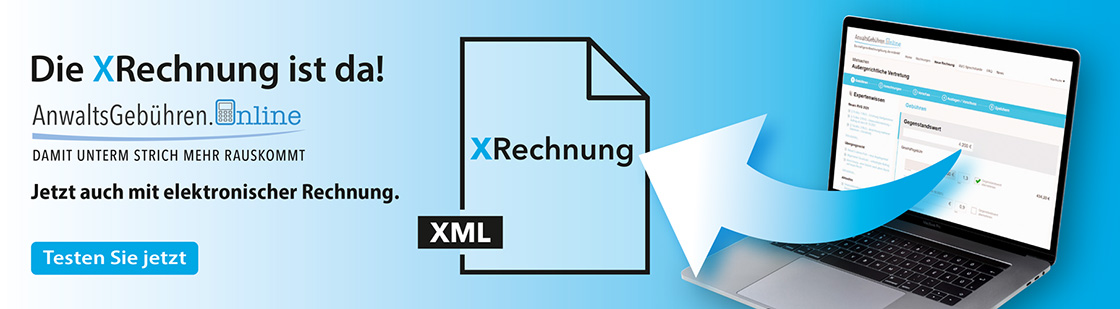





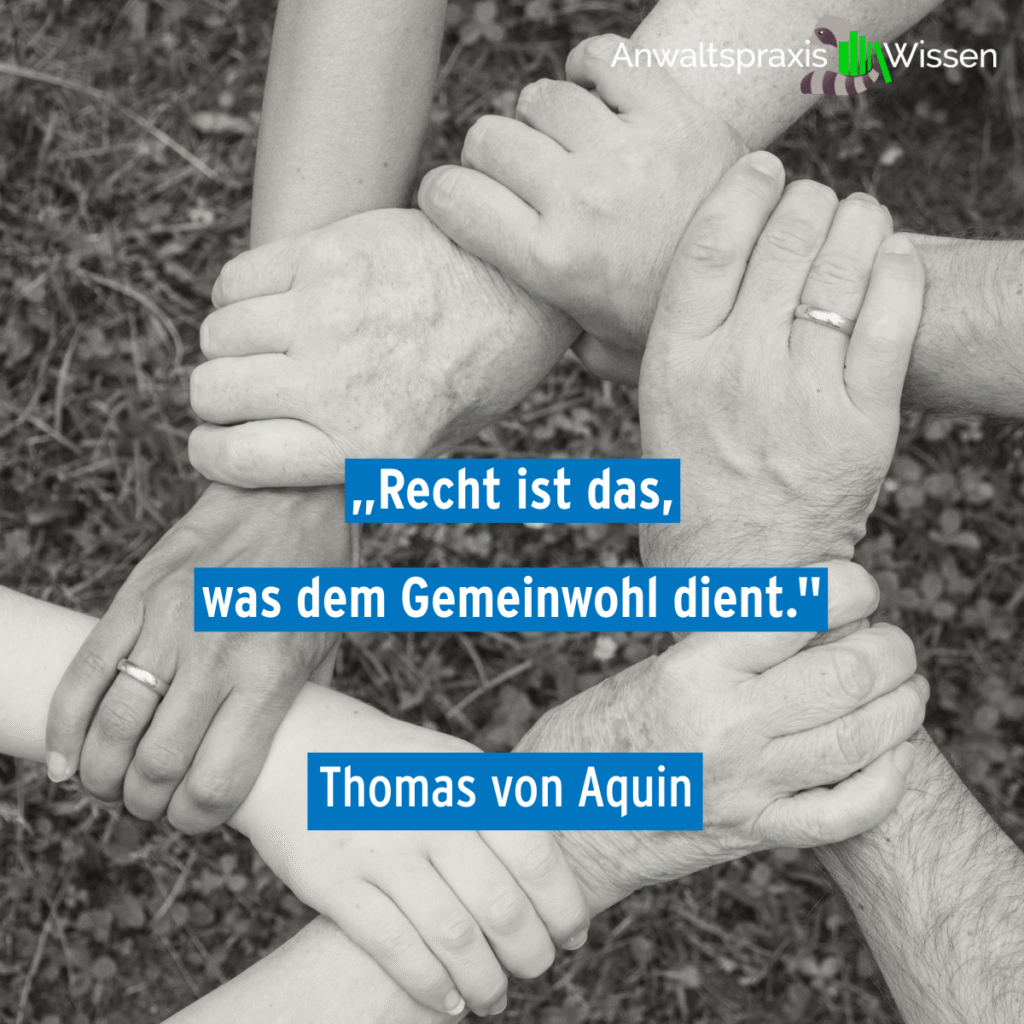
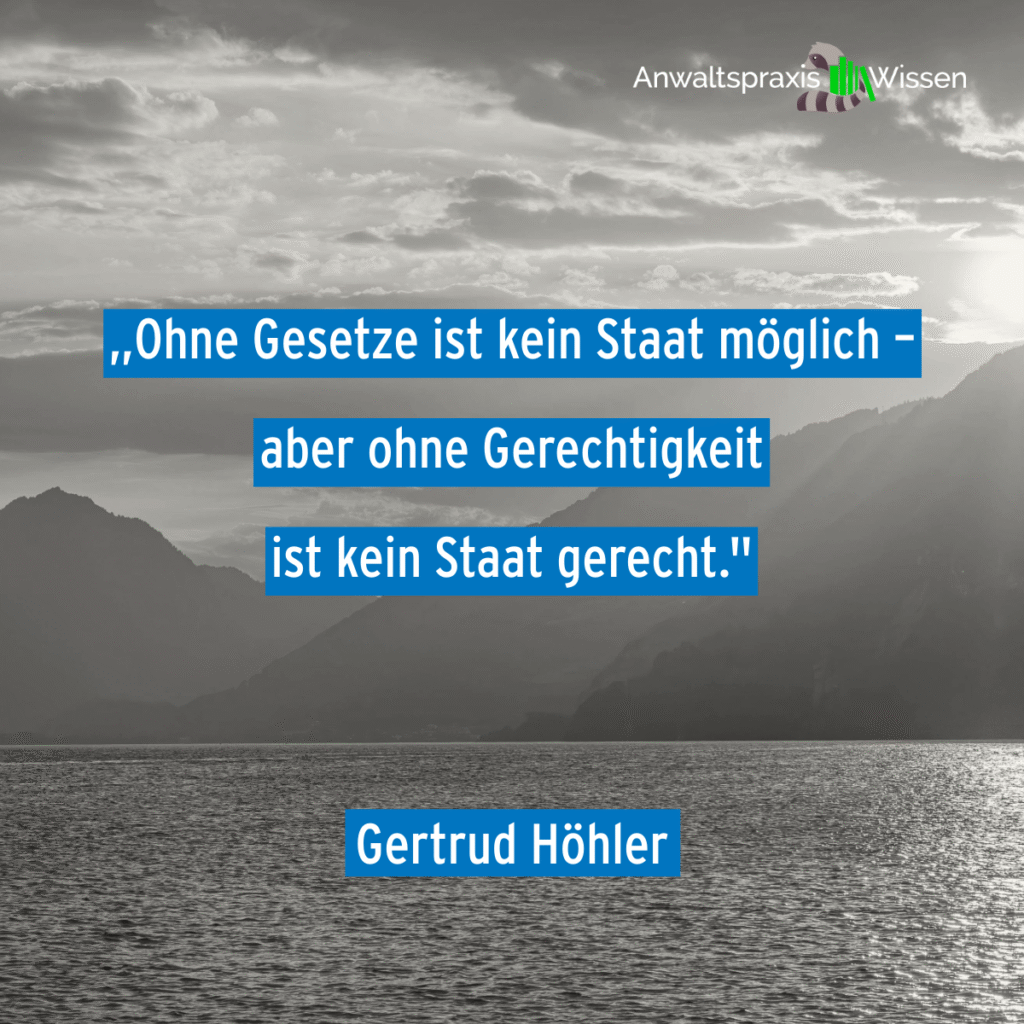
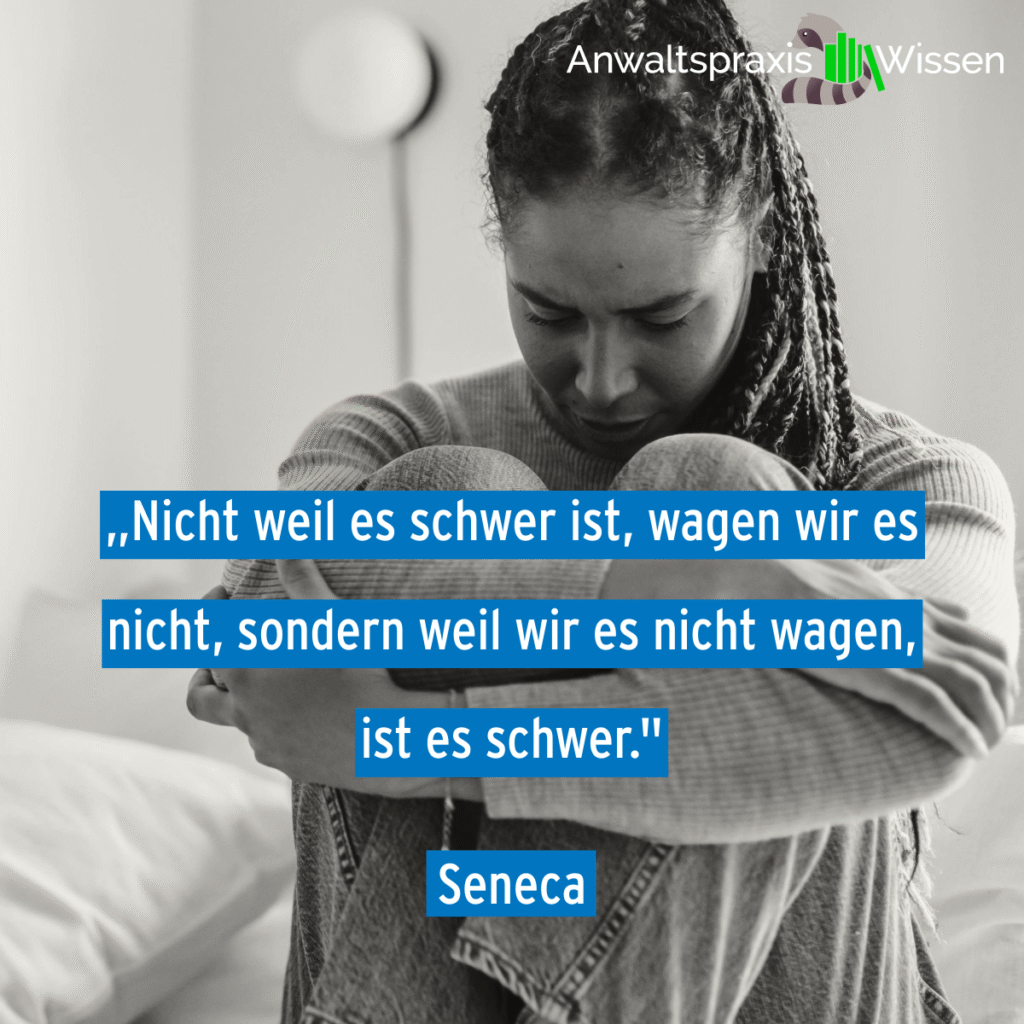
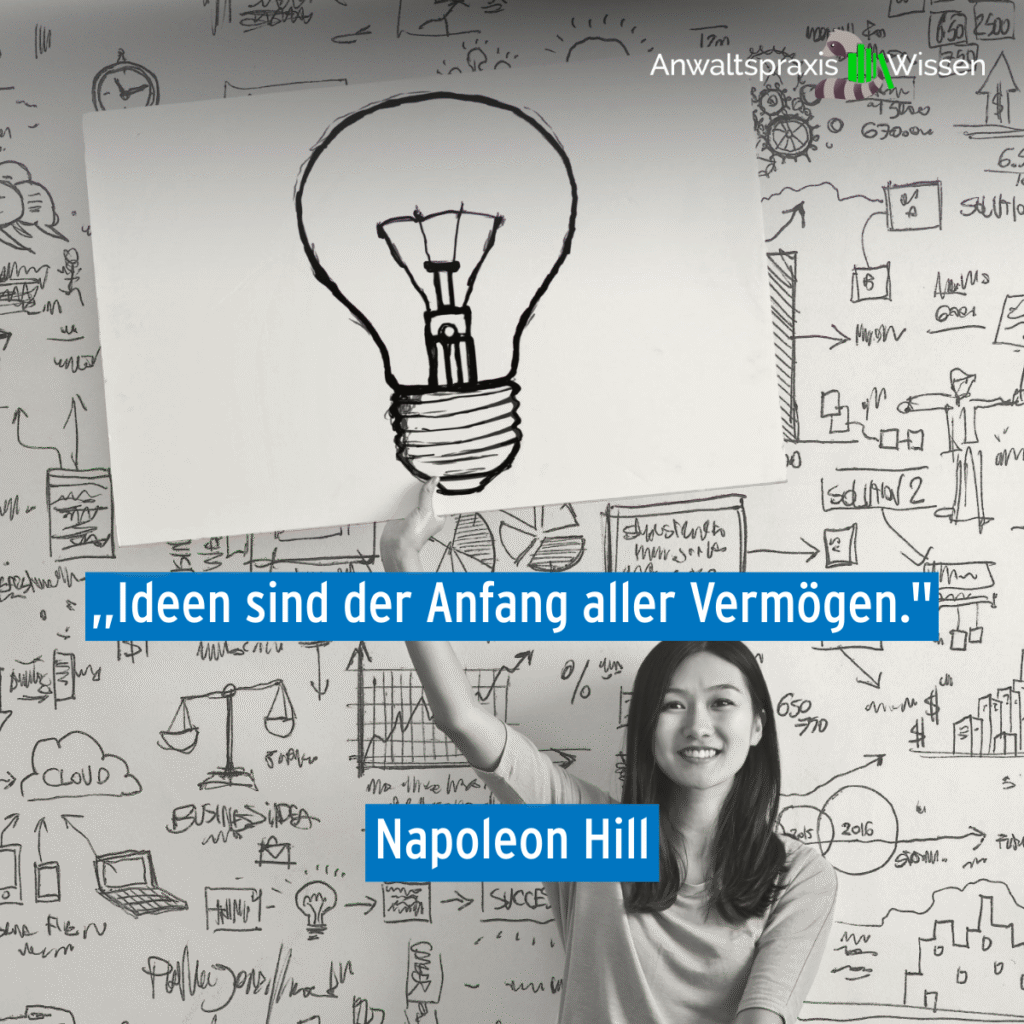
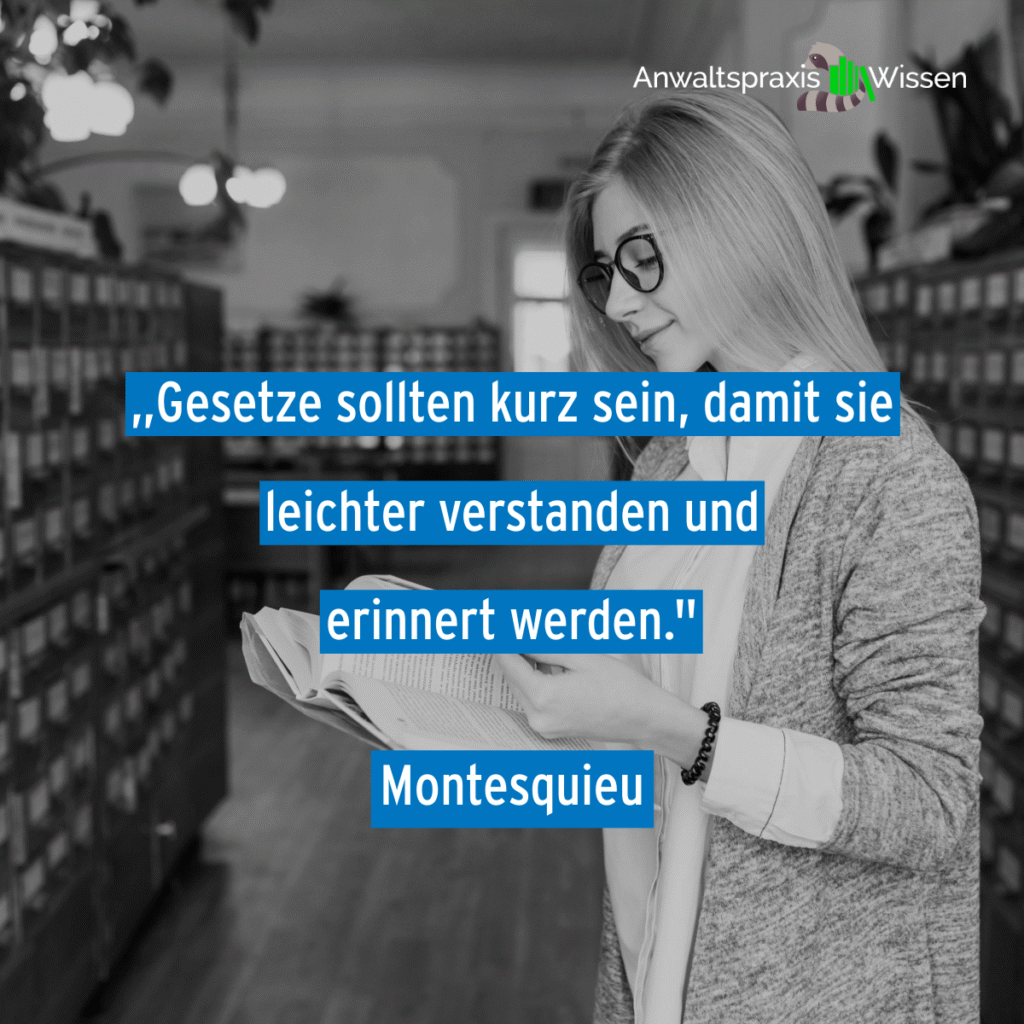
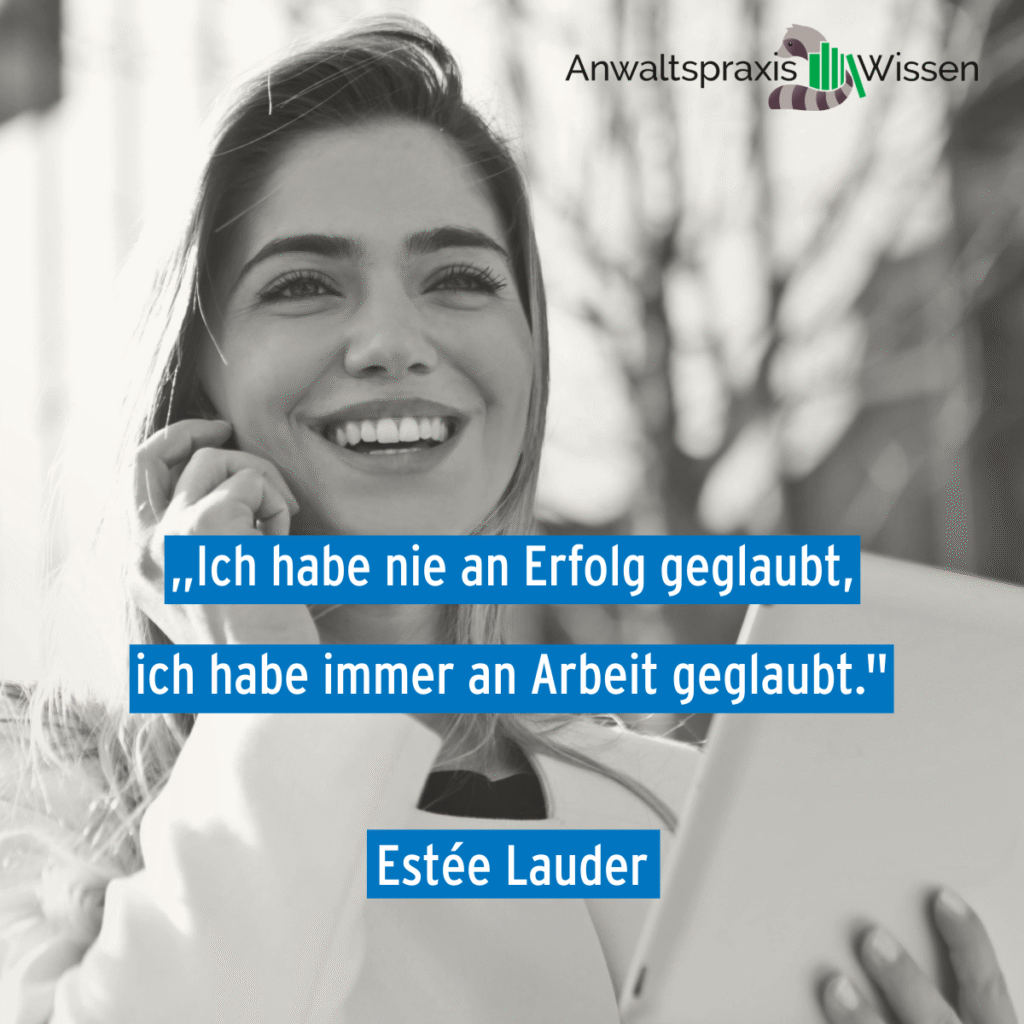


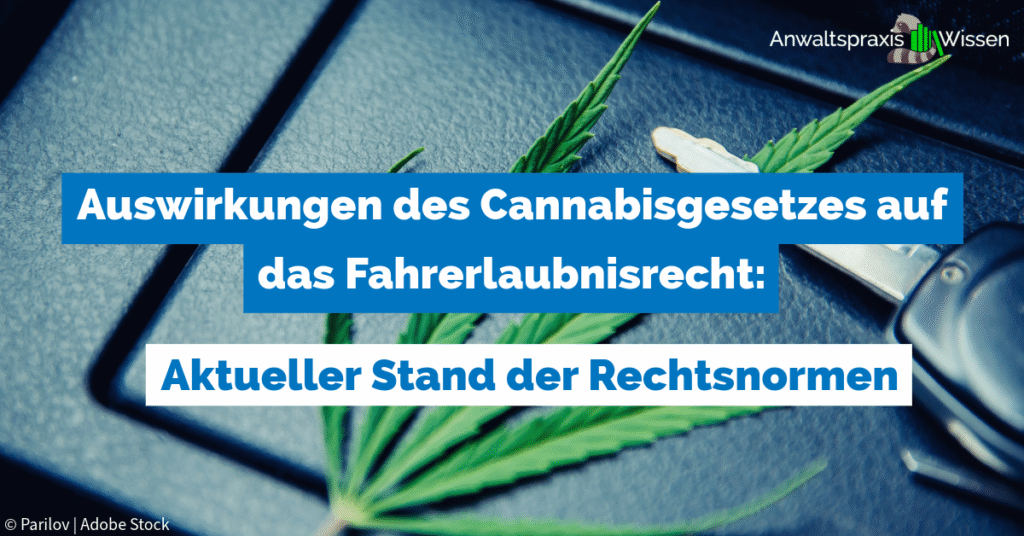

![Erbrecht im Gespräch: Kurze[s] Update: #21 Ehegatten: Testament oder Erbvertrag? – mit Dr. Markus Sikora](https://anwaltspraxis-magazin.de/wp-content/uploads/2025/11/Erbrecht-im-Gespraech-21-1024x536.jpeg)