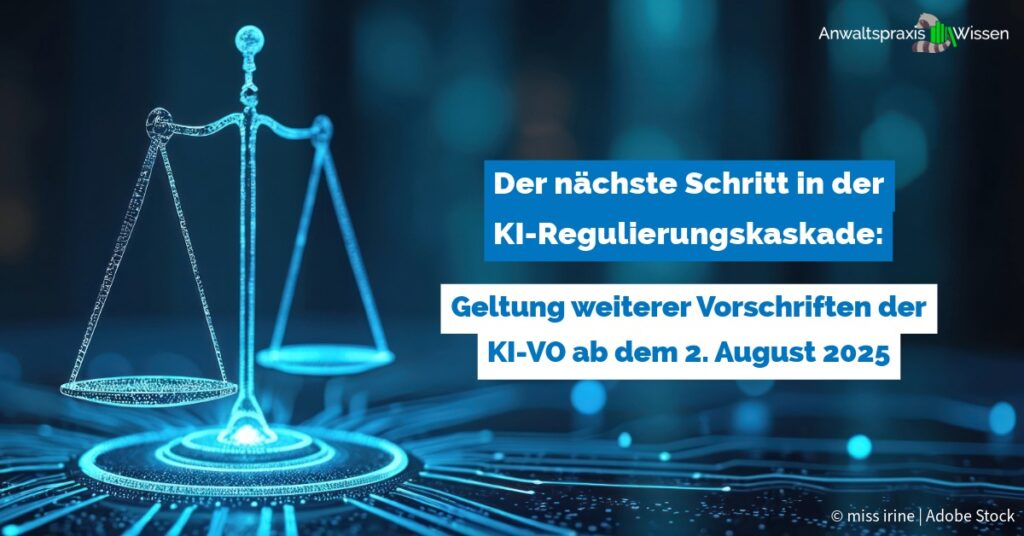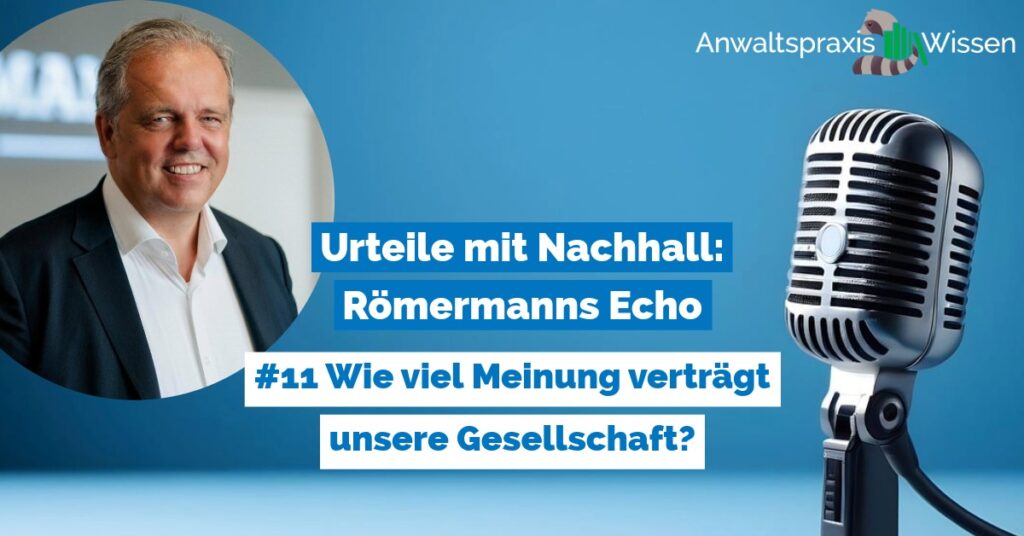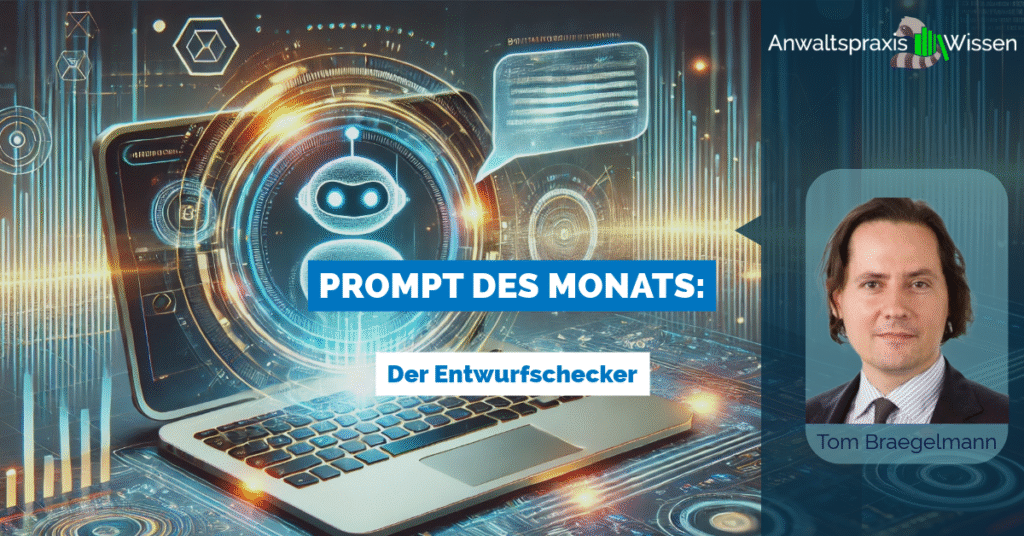1. Zur erforderlichen Terminsdichte der Hauptverhandlung in Haftsachen.
2. Das Hinausschieben der Hauptverhandlung wegen Terminschwierigkeiten der Verteidiger ist kein Umstand, der eine erhebliche Verzögerung der Hauptverhandlung rechtfertigen könnte.
(Leitsätze des Verfassers)
I. Sachverhalt
Wenige Termine
Die Beschwerdeführer befinden sich wegen des dringenden Tatverdachts insbesondere des versuchten Mordes in zehn tateinheitlichen Fällen in Tateinheit mit schwerer Brandstiftung seit dem 1. bzw. 14.7.2023 in Untersuchungshaft. Das LG eröffnete mit Beschluss vom 3.4.2024 das Hauptverfahren und ordnete die Haftfortdauer an. Die Vorsitzende bestimmte den ersten Hauptverhandlungstermin auf den 3.5.2024. Dabei setzte sie zunächst sechs Hauptverhandlungstermine im Zeitraum vom 3.5. bis zum 24.6.2024 an und bestimmte im weiteren Verlauf der Hauptverhandlung sukzessive weitere 15 Termine bis zum 17.12. 2024, mithin insgesamt 21 Termine.
Die Verteidiger der Beschwerdeführer beantragten am 16.10.2024 im Wege der Haftprüfung die Aufhebung des Haftbefehls. Das LG erhielt den Haftbefehl aufrecht und ordnete die Fortdauer der Untersuchungshaft an. Die Vorsitzende teilte dem OLG im Zuge des Beschwerdeverfahrens mit, dass sechs weitere Fortsetzungstermine bis zum 14.2.2025 bestimmt worden seien. Das OLG verwarf die Beschwerden als unbegründet. Gegen diesen Beschluss wenden sich die Beschwerdeführer mit ihren erfolgsreichen Verfassungsbeschwerden.
II. Entscheidung
Grundlagen
Art. 2 Abs. 2 S. 2 GG gewährleistet jedermann die Freiheit der Person und nimmt einen hohen Rang unter den Grundrechten ein. Das komme darin zum Ausdruck, dass Art. 2 Abs. 2 S. 2 GG die Freiheit der Person als „unverletzlich“ bezeichnet, Art. 104 Abs. 1 S. 1 GG ihre Beschränkung nur aufgrund eines förmlichen Gesetzes zulässt und Art. 104 Abs. 2 bis 4 GG besondere Verfahrensgarantien für ihre Beschränkung statuiert. Die Freiheit der Person dürfe nur aus besonders gewichtigen Gründen und unter strengen formellen Gewährleistungen eingeschränkt werden. Bei der Anordnung und Aufrechterhaltung der Untersuchungshaft sei daher stets das Spannungsverhältnis zwischen dem in Art. 2 Abs. 2 S. 2 GG gewährleisteten Recht des Einzelnen auf persönliche Freiheit und den unabweisbaren Bedürfnissen einer wirksamen Strafverfolgung zu beachten. Der Entzug der Freiheit eines der Straftat lediglich Verdächtigen sei wegen der Unschuldsvermutung, die ihre Wurzel im Rechtsstaatsprinzip des Art. 20 Abs. 3 GG hat und auch in Art. 6 Abs. 2 EMRK ausdrücklich hervorgehoben ist, nur ausnahmsweise zulässig. Der Verhältnismäßigkeitsgrundsatz sei nicht nur für die Anordnung, sondern auch für die Dauer der Untersuchungshaft von Bedeutung. Er verlange, dass die Dauer der Untersuchungshaft nicht außer Verhältnis zur erwarteten Strafe steht, und setzt ihr auch unabhängig von der Straferwartung Grenzen. Das Gewicht des Freiheitsanspruchs vergrößere sich gegenüber dem Interesse an einer wirksamen Strafverfolgung regelmäßig mit zunehmender Dauer der Untersuchungshaft. Daraus folge zum einen, dass die Anforderungen an die Zügigkeit der Arbeit in einer Haftsache mit der Dauer der Untersuchungshaft steigen. Zum anderen nähmen auch die Anforderungen an den die Haftfortdauer rechtfertigenden Grund zu. Im Rahmen der von den Fachgerichten vorzunehmenden Abwägung zwischen dem Freiheitsanspruch des Betroffenen und dem Strafverfolgungsinteresse der Allgemeinheit sei die Angemessenheit der Haftfortdauer anhand objektiver Kriterien des jeweiligen Einzelfalles zu prüfen; insofern seien in erster Linie die Komplexität der einzelnen Rechtssache, die Vielzahl der beteiligten Personen und das Verhalten der Verteidigung von Bedeutung. Der Vollzug der Untersuchungshaft von mehr als einem Jahr bis zum Beginn der Hauptverhandlung oder dem Erlass des Urteils werde dabei auch unter Berücksichtigung der genannten Aspekte nur in ganz besonderen Ausnahmefällen zu rechtfertigen sein (BVerfG NJW 2019, 915 Rn 56 m.w.N.). Das Beschleunigungsgebot in Haftsachen verlange, dass die Strafverfolgungsbehörden und Strafgerichte alle möglichen und zumutbaren Maßnahmen ergreifen, um die notwendigen Ermittlungen mit der gebotenen Schnelligkeit abzuschließen und eine gerichtliche Entscheidung über die einem Beschuldigten vorgeworfenen Taten herbeizuführen. An den zügigen Fortgang des Verfahrens seien dabei umso strengere Anforderungen zu stellen, je länger die Untersuchungshaft schon andauert. Bei absehbar umfangreicheren Verfahren sei nach ständiger Rechtsprechung des BVerfG stets eine vorausschauende, auch größere Zeiträume umgreifende Hauptverhandlung mit mehr als einem durchschnittlichen Hauptverhandlungstag pro Woche notwendig (BVerfG a.a.O. Rn 57). Von dem Beschuldigten nicht zu vertretende, sachlich nicht gerechtfertigte und vermeidbare erhebliche Verfahrensverzögerungen stünden regelmäßig einer weiteren Aufrechterhaltung der Untersuchungshaft entgegen. Allein die Schwere der Tat und die sich daraus ergebende Straferwartung könnten bei erheblichen, vermeidbaren und dem Staat zuzurechnenden Verfahrensverzögerungen nicht zur Rechtfertigung einer ohnehin schon lang andauernden Untersuchungshaft dienen (BVerfG a.a.O. Rn 58).
Hier keine tragfähige Begründung
Diesen Vorgaben genüge der angegriffene Beschluss des OLG nicht. Das OLG selbst weise zunächst zutreffend darauf hin, dass Verhandlungsdichte und -intensität der Strafkammer den – auch aus verfassungsrechtlichen Gründen – grundsätzlich an die Wahrung des Beschleunigungsgrundsatzes zu stellenden Anforderungen nicht entsprechen. Das LG habe in jedem der vom OLG in den Blick genommenen Betrachtungszeiträume weit weniger als an durchschnittlich einem Tag pro Woche verhandelt. Die Verhandlungsdichte sinke noch weiter, wenn man die fünf Sitzungstage vom 31.7., 9.8., 4.10., 23.10.2024 und 7.1.2025 nicht einbezieht, an denen zwar Urkunden verlesen beziehungsweise Zeugen vernommen wurden, jedoch weniger als eine Stunde verhandelt und das Verfahren dadurch nicht entscheidend gefördert wurde (BVerfG StraFo 2013, 160 = StRR 2013, 228 [Herrmann]. Angesichts der gegebenen Terminfrequenz hätte für das OLG Anlass dazu bestanden zu prüfen, ob die Strafkammer ihrer Aufgabe einer vorausschauenden straffen Hauptverhandlungsplanung bei einem – wie hier – umfangreichen Verfahren hinreichend nachgekommen ist. Eine tragfähige Begründung, die die weitere Fortdauer der Untersuchungshaft trotz der geringen Verhandlungsdichte und -intensität – ausnahmsweise – rechtfertigen könnte, enthalte der angegriffene Beschluss nicht. Dem angegriffenen Beschluss lässt sich nicht nachvollziehbar entnehmen, warum im Zeitraum vom 5.9. bis zum 1.11. 2024 ein Verstoß gegen das Beschleunigungsgebot nicht vorliegen soll (wird ausgeführt). Soweit einer Terminierung im November und Dezember 2024 nach der Mitteilung der Vorsitzenden der Strafkammer Verhinderungen eines oder mehrerer Verteidiger entgegenstanden, vermöge im Übrigen auch dies eine unzureichende Terminsdichte im Grundsatz nicht zu rechtfertigen. Kollidiert wegen Terminschwierigkeiten des Verteidigers das Recht des Angeklagten, in der Hauptverhandlung von dem Verteidiger seines Vertrauens vertreten zu werden, mit seinem Recht auf zeitliche Begrenzung der Untersuchungshaft, so könne die Terminlage der Verteidigung nur insoweit berücksichtigt werden, wie dies nicht zu einer erheblichen Verzögerung des Verfahrens führt. Das Hinausschieben der Hauptverhandlung wegen Terminschwierigkeiten der Verteidiger sei – auch wenn das Recht, sich vom Rechtsanwalt seines Vertrauens verteidigen zu lassen, Verfassungsrang hat – kein Umstand, der eine erhebliche Verzögerung rechtfertigen könnte (BVerfG, Beschl. v. 1.4.2020 – 2 BvR 225/20 Rn 74; wird ausgeführt).
Das OLG habe es schließlich versäumt, die ihm bekannte und damit absehbare weitere Planung der Hauptverhandlung in den Monaten Januar und Februar 2025 einer am Maßstab des in Haftsachen geltenden Beschleunigungsgebots orientierten Betrachtung zu unterziehen. Hierzu habe besonderer Anlass bestanden, denn auch die laut Mitteilung der Vorsitzenden der Strafkammer vorgesehenen weiteren Hauptverhandlungstage erreichen mit sechs Terminen in sieben Wochen und einer weiteren Verhandlungspause von knapp drei Wochen nicht das verfassungsrechtlich geforderte Mindestmaß von mehr als einem durchschnittlichen Hauptverhandlungstag pro Woche (BVerfG StV 2008, 198 Rn 52 = StRR 2008, 155 [Herrmann]).
III. Bedeutung für die Praxis
Das lag auf der Hand
Erneut sieht sich das BVerfG veranlasst, eine Entscheidung zur Haftfortdauer wegen Verstoßes gegen das Beschleunigungsgebot aufzuheben. Das Gericht weist darauf hin, dass bei Anwendung der dargestellten Grundsätze alle Umstände des Einzelfalls maßgeblich zu berücksichtigen sind. Das haben hier augenscheinlich weder LG noch OLG in ausreichendem Maß getan. Es liegt auf der Hand, dass die hier gewählte Terminsdichte bei einer über ein Jahr andauernden Untersuchungshaft nicht mehr genügt. Und Terminkollisionen mit Verteidigern in größeren Verfahren sind alltägliches Geschäft von Vorsitzenden. Dem ist durch die frühzeitige Bestellung von Sicherungsverteidigern zu begegnen. Eine vorausschauende Planung ist obligatorisch (aktuell dazu KG StraFo 2024, 12 = StRR 1/2024, 29 [Deutscher]).




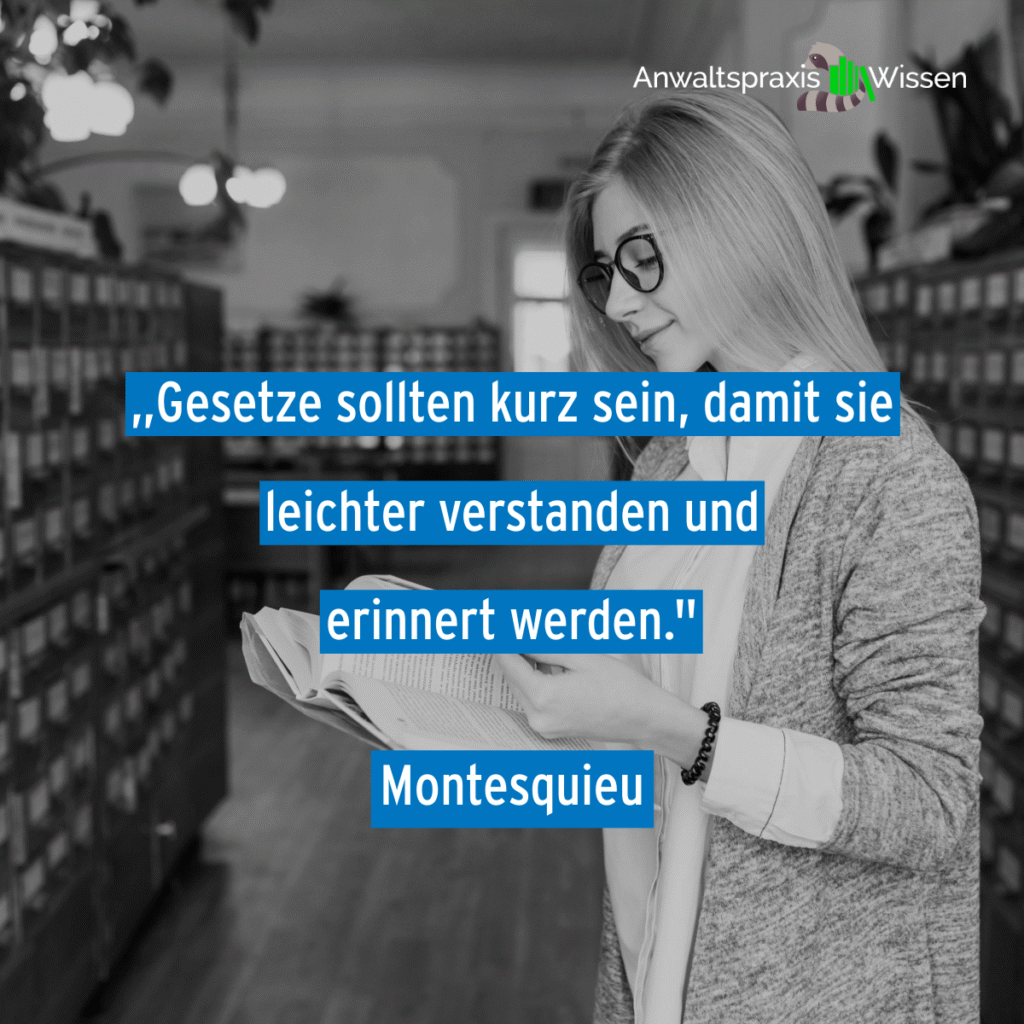
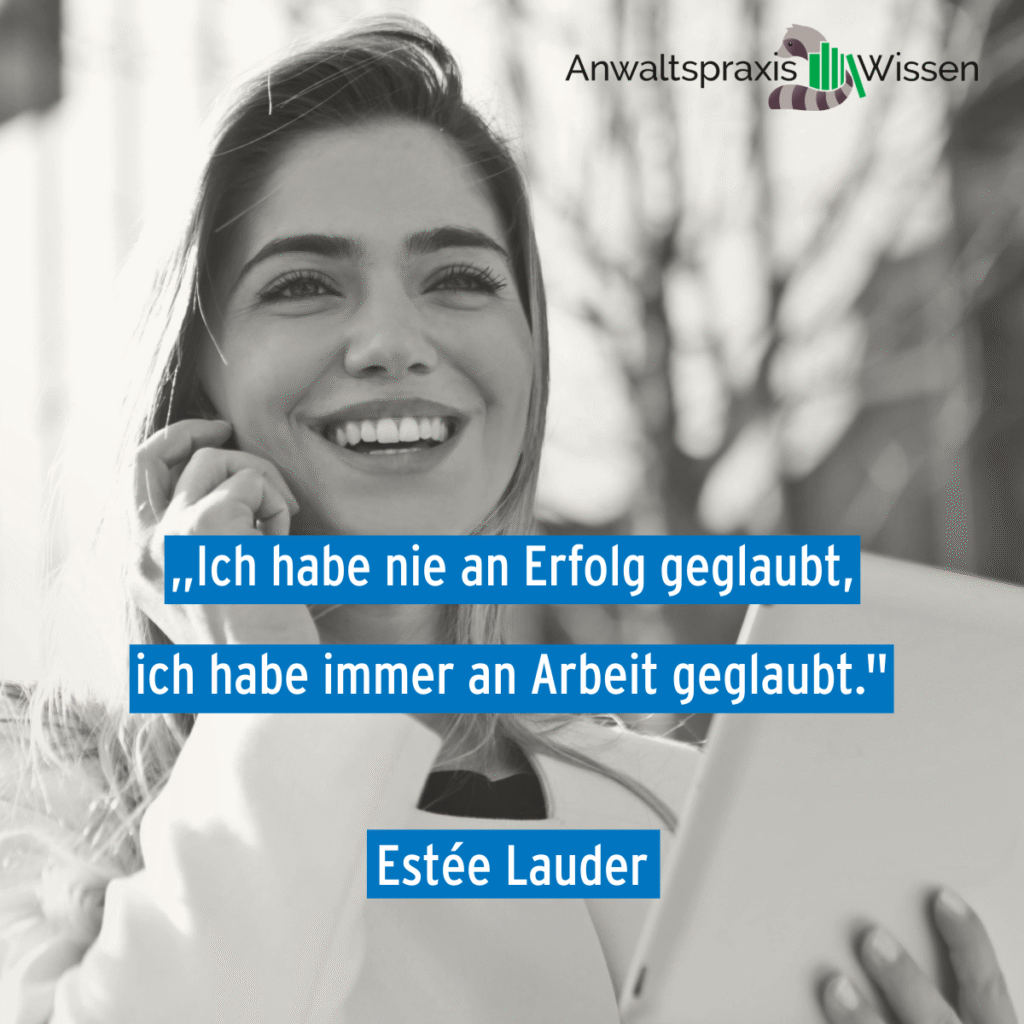

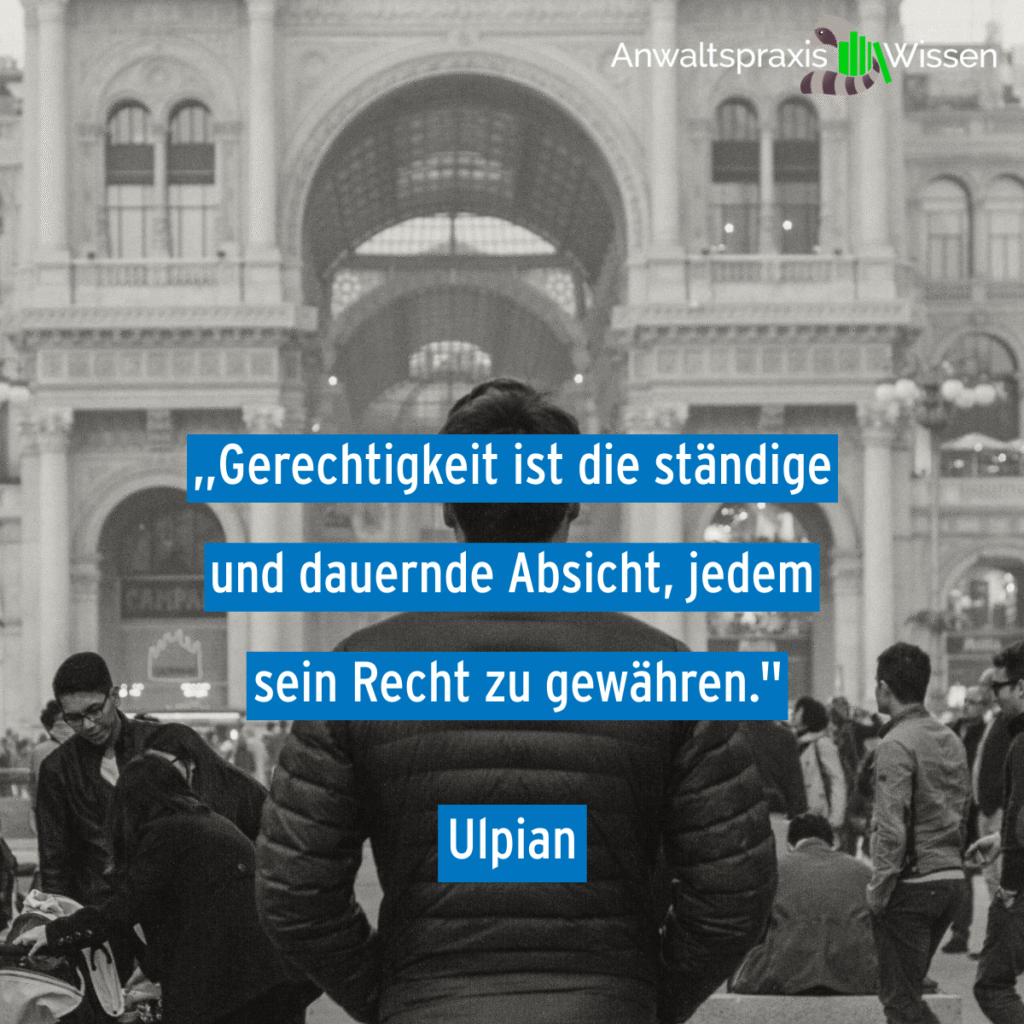

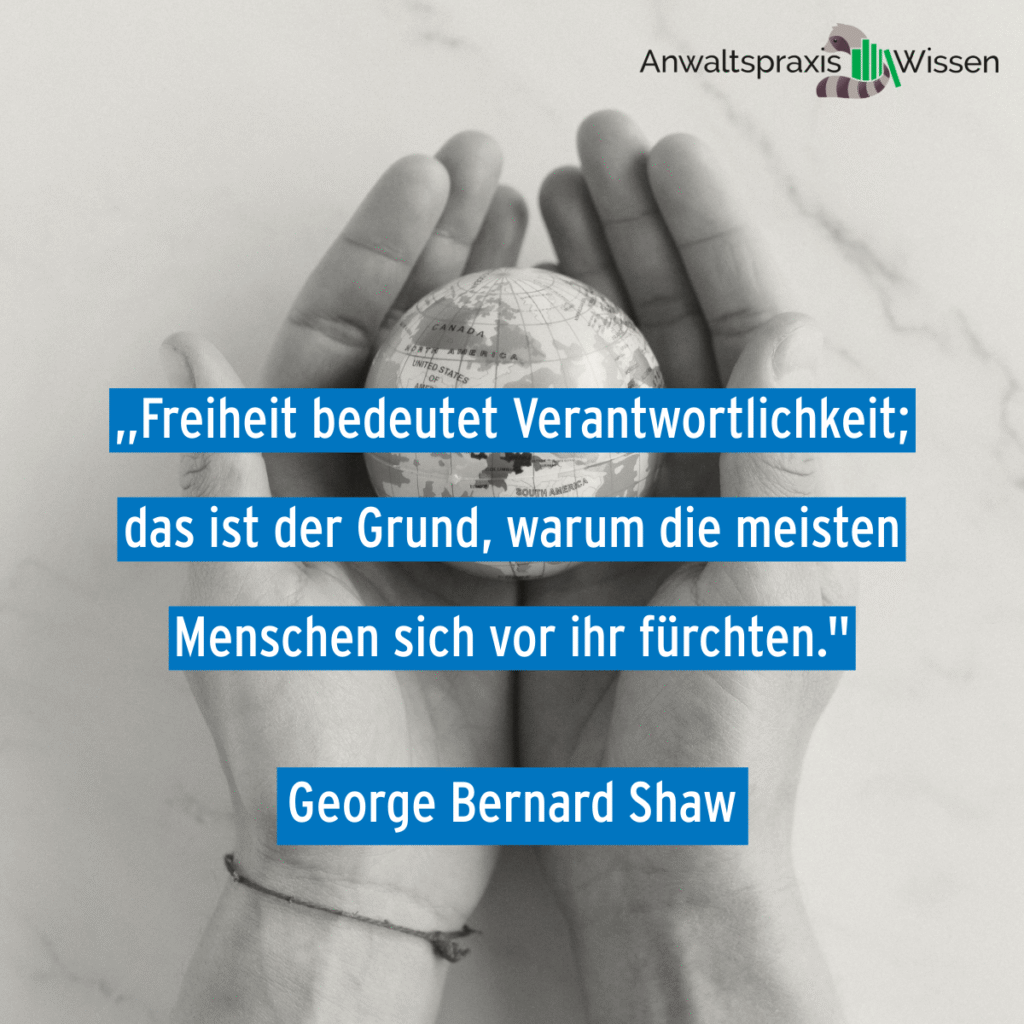

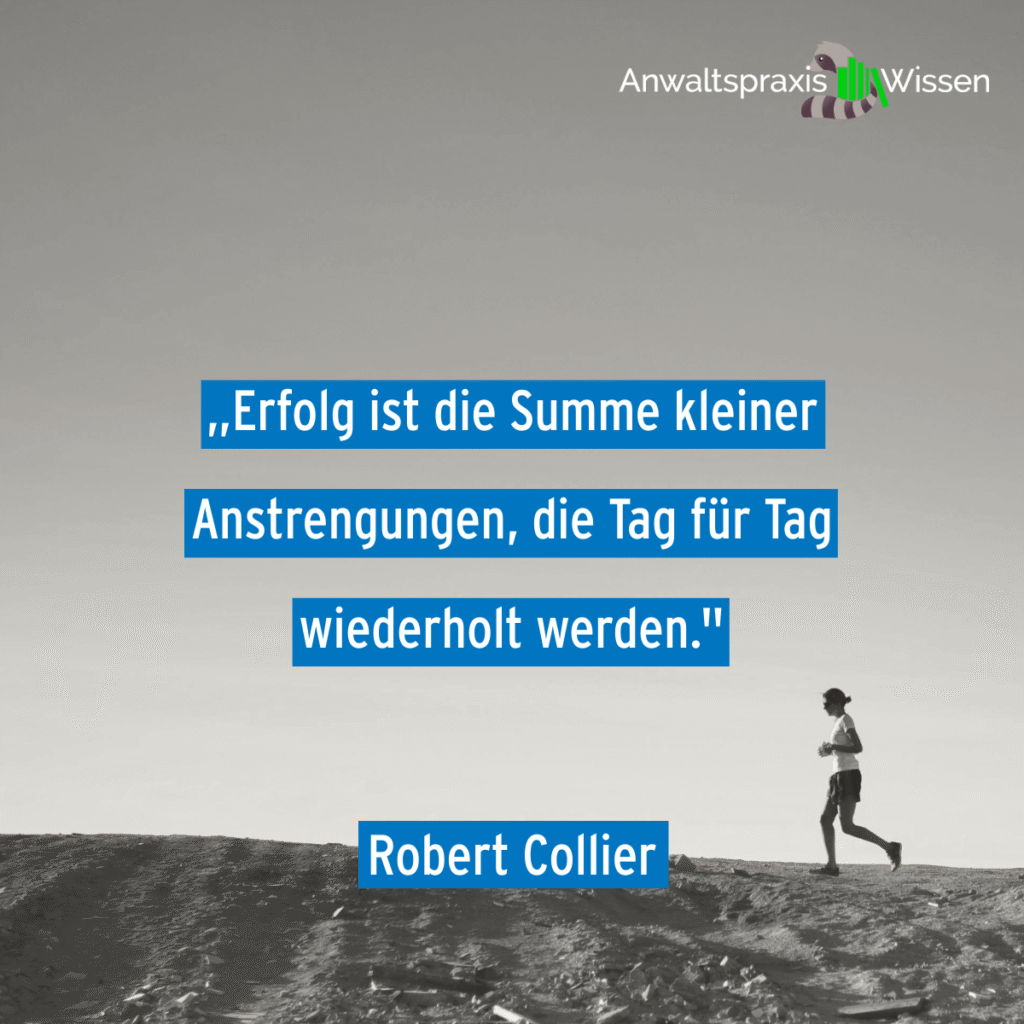

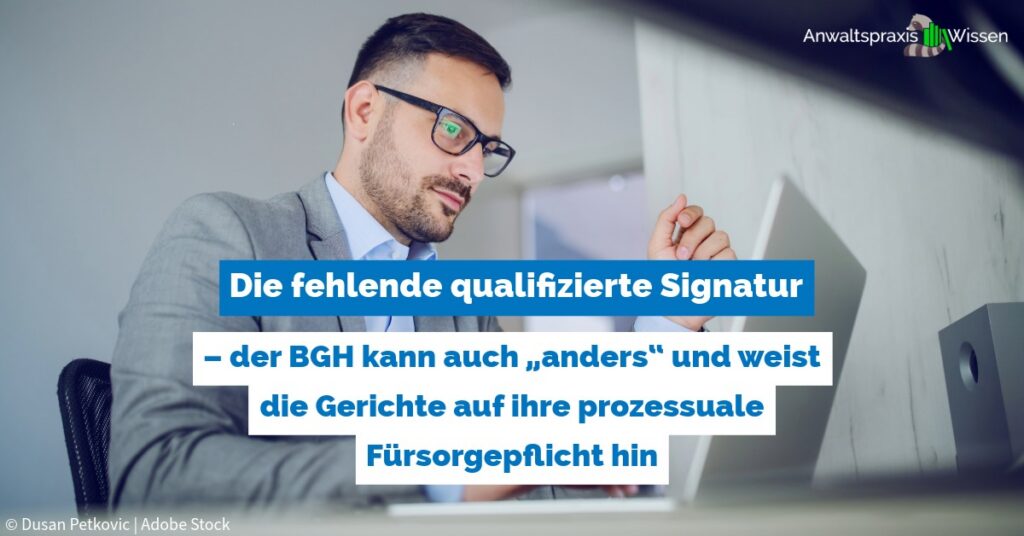

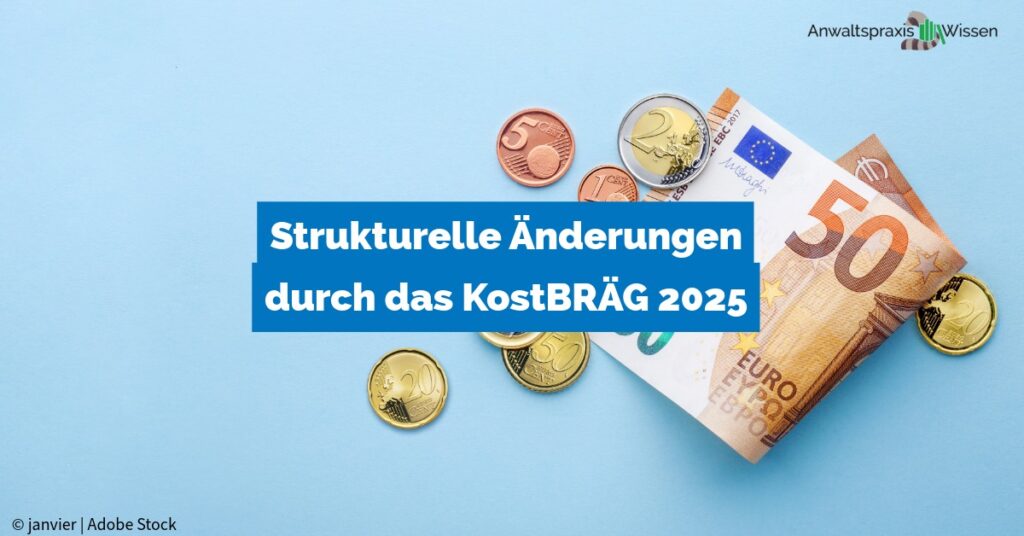

![Erbrecht im Gespräch: Kurze[s] Update: #19 Bestattungsrecht – mit Dr. Bernd Schmalenbach](https://anwaltspraxis-magazin.de/wp-content/uploads/2025/09/Erbrecht-im-Gespraech-19-1024x536.jpeg)