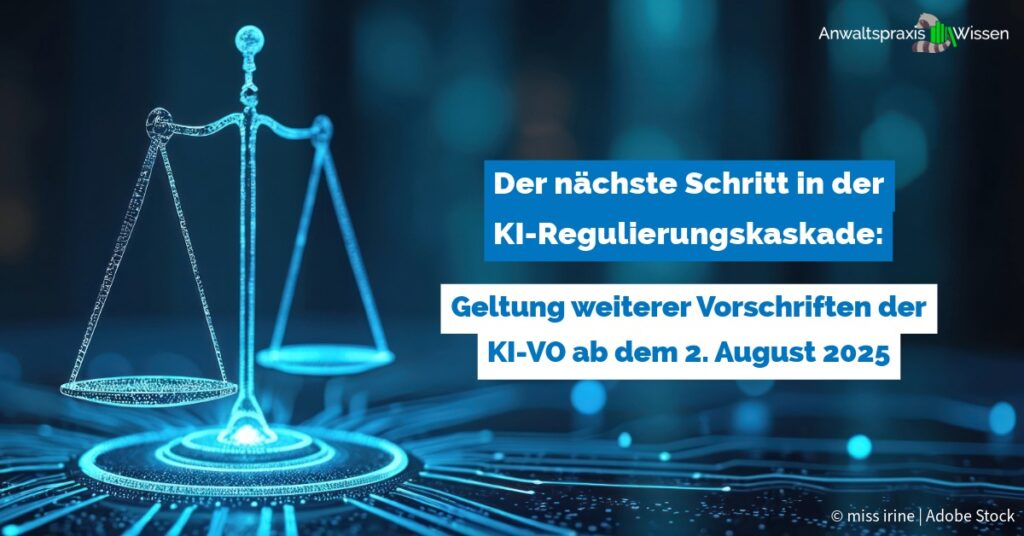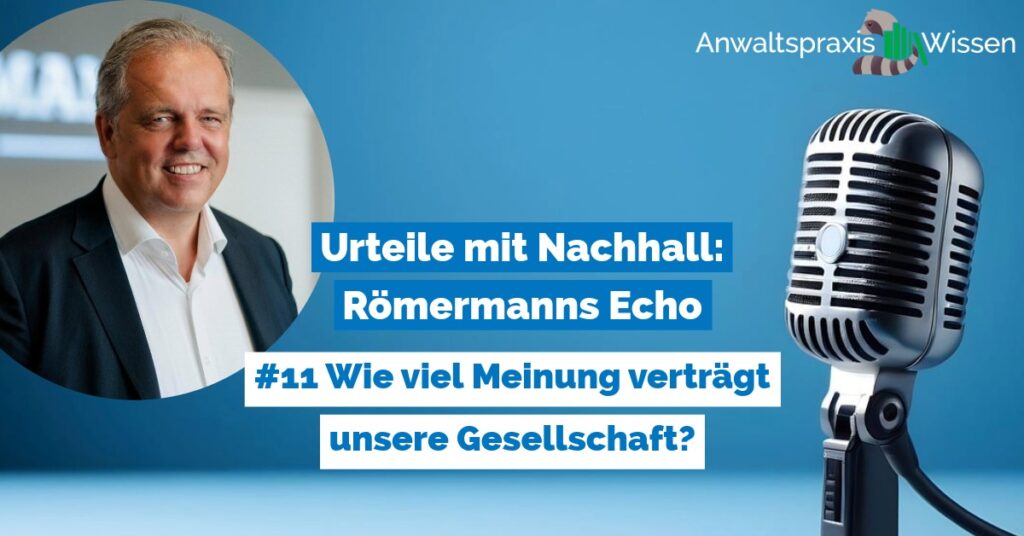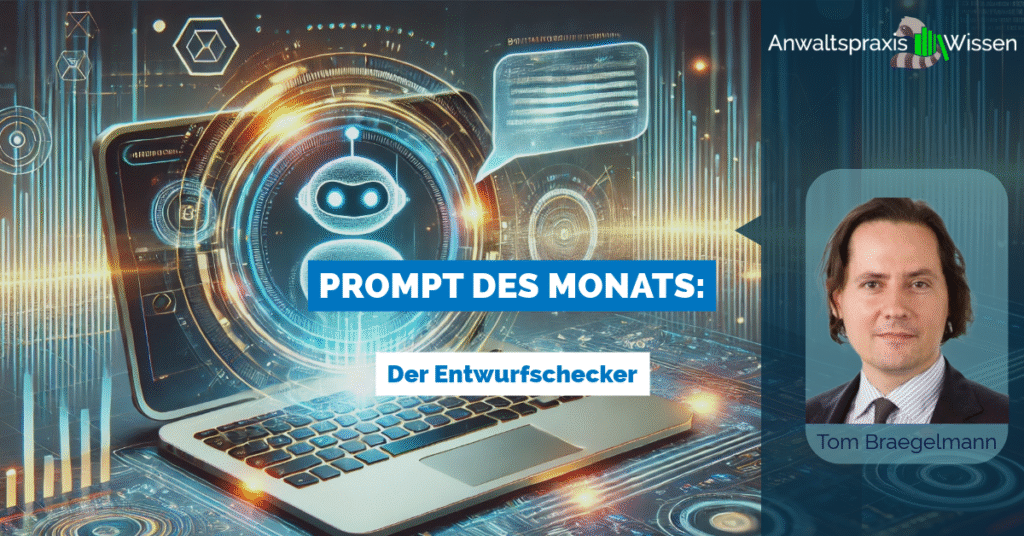Die Einziehung des Nachlasses gemäß § 73 Abs. 1 StGB ist im Fall der Tötung des Erblassers nicht zulässig, weil die Rechtslage betreffend die Erbschaft im Falle einer Tötung des Erblassers durch dessen Erben vorrangig und abschließend in § 2339 Abs. 1 Nr. 1, §§ 2340 ff. BGB geregelt ist. (Leitsatz des Verfassers)
BGH,Beschl.v.23.1.2020–5 StR 518/19
I. Sachverhalt
Der Angeklagte ist wegen der Ermordung seiner Mutter (§ 211 StGB) verurteilt worden. Das LG hat das im Wege der Erbfolge Erlangte, u.a. ein Hausgrundstück, ein Kraftfahrzeug und mehreren Bankguthaben, nach §§ 73 ff. StGB eingezogen. Der BGH hat auf die Revision des Angeklagten den Ausspruch über die Einziehung entfallen lassen.
II. Entscheidung
Der BGH führt aus: Zwar habe das LG zutreffend angenommen, dass der Angeklagte den Nachlass durch die abgeurteilte rechtswidrige Tat erlangt habe (§ 73 Abs. 1 StGB). Denn der Vermögenszufluss in Form der Erbschaft (§ 1922 BGB) gehe ursächlich auf die Tötung der Erblasserin durch den Angeklagten zurück. Eine Einziehung nach den §§ 73 ff. StGB sei aber ausgeschlossen, wenn – wie hier – der Anwendungsbereich der Vorschriften über die strafrechtliche Vermögenabschöpfung nicht eröffnet sei (vgl. zur Einziehung des Geldwäscheobjekts BGH StRR 9/2019, 16). Der Abschöpfung deliktisch erlangten Vermögens liege der sämtliche Rechtsgebiete übergreifende Gedanke zugrunde, eine nicht mit der Rechtsordnung übereinstimmende Vermögenslage zu berichtigen (vgl. BT-Drucks 18/9525, S. 58, 66; BVerfGE 110, 1, Rn 20; BGH NStZ-RR 2018, 241). Soll die durch die rechtswidrige Tat entstandene Störung der Vermögenslage nach der Rechtsordnung erkennbar mit anderen Mitteln als der strafrechtlichen Vermögensabschöpfung beseitigt oder gar hingenommen werden, habe die Einziehung nach §§ 73 ff. StGB daher ausnahmsweise zu unterbleiben, sofern diese rechtliche Wertung dadurch unterlaufen würde.
Nach diesen Grundsätzen hat der BGH hier die Einziehung des Nachlasses gemäß § 73 Abs. 1 StGB als nicht zulässig angesehen, weil die Rechtslage betreffend die Erbschaft im Falle einer Tötung des Erblassers durch dessen Erben vorrangig und abschließend in § 2339 Abs. 1 Nr. 1, §§ 2340 ff. BGB geregelt sei. Wesentliches Kennzeichen dieser Vorschriften sei es, dass die Folgen der Erbunwürdigkeit nicht unmittelbar kraft Gesetzes eintreten. Vielmehr sei es den Anfechtungsberechtigten überlassen, im Wege einer Gestaltungsklage (§ 2342 BGB) über die Rechte am Nachlass zu bestimmen. Entscheiden sich die Berechtigten gegen die Geltendmachung der Erbunwürdigkeit, widerspreche der Verbleib des Nachlasses beim Täter mithin nicht den Wertungen der Rechtsordnung. Verursache der Erbe den Tod des Erblassers lediglich fahrlässig, betrachte das Gesetz ihn von vornherein nicht als erbunwürdig. Diese gesetzliche Wertung würde durch die Anwendung des § 73 StGB unterlaufen, da die Einziehung des Nachlasses auch in diesem Fall zwingend anzuordnen wäre.
Der BGH weist darauf hin, dass sich die strafrechtliche Einziehung des Nachlasses auch in ihrer Wirkung grundsätzlich von der Erbunwürdigkeitserklärung unterscheidet. Die Einziehung des Nachlasses ändert nämlich nichts an der Stellung des Täters als Erben. Hingegen bestimmt § 2344 Abs. 1 BGB, dass im Fall der Erbunwürdigkeitserklärung der Anfall der Erbschaft auf den Erben als nicht erfolgt gilt. Die Zulassung der Einziehung des Nachlasses nach § 73 Abs. 1 StGB liefe im Ergebnis darauf hinaus, dass eine grundlegende Regelung des Erbrechts für eine Konstellation wie die hier vorliegende außer Kraft gesetzt würde. Außerdem würde die Einziehung des Nachlasses von der Rechtsordnung nicht gewollte Folgen bewirken. So würde der Einziehungsadressat als Erbe für die Nachlassverbindlichkeiten haften (§ 1967 Abs. 1 BGB), ohne allerdings den Nachlass zu erhalten. Zudem würde der Nachlass bei einer Einziehung nach § 73 Abs. 1 StGB – anders als von § 2344 Abs. 2 BGB bestimmt – nicht dem Nächstberufenen zugutekommen, da die Vorschriften über die Opferentschädigung nur die Rückübertragung auf den Verletzten oder dessen Rechtsnachfolger erfassen (§ 459h Abs. 1 StPO). Rechtsnachfolger des Erblassers bleibt im Falle der strafrechtlichen Einziehung aber gerade der Einziehungsadressat.
Angesichts dessen sieht der BGH die Regelungen über die Erbunwürdigkeit gegenüber §§ 73 ff. StGB als abschließend an, zumal auch in rechtssystematischer Hinsicht Bedenken gegen die Einziehung eines Nachlasses bestehen, weil der Staat sich auf diesem Wege solcher Vermögensgegenstände bemächtigen würde, die den Nachlassgläubigern zur Befriedigung ihrer Ansprüche zugewiesen sind (vgl. § 1990 Abs. 1 BGB;Soergel/Stein, BGB, 13. Aufl., § 1990 Rn 1, 9;Erman/Horn, BGB, 15. Aufl., § 1990 Rn 11; MüKo-BGB/Küpper, 8. Aufl., § 1990 Rn 7).
III. Bedeutung für die Praxis
Die Entscheidung ist m.E. zutreffend. Die Fälle, in denen die Entscheidung in der Praxis eine Rolle spielt, sind sicherlich nicht allzu häufig, man muss sie aber, wenn es um die Einziehung geht, im Blick haben und prüfen, ob nicht ggf. die Rechtsordnung andere Möglichkeiten der Abschöpfung des rechtswidrig erlangten Vermögensvorteils vorsieht.
RADetlef Burhoff, RiOLG a.D., Leer/Augsburg


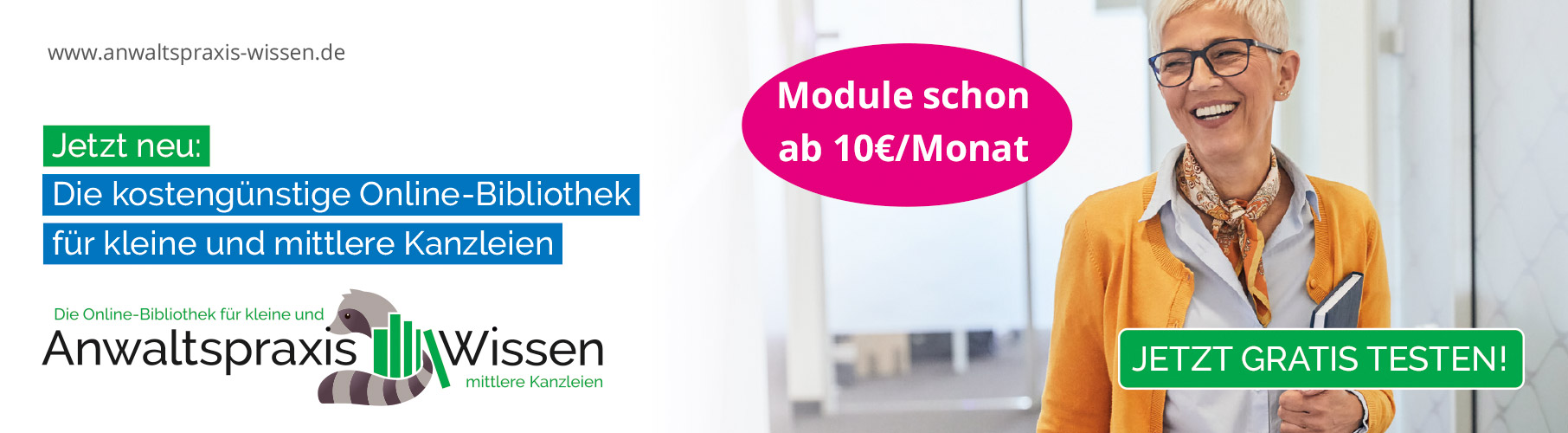

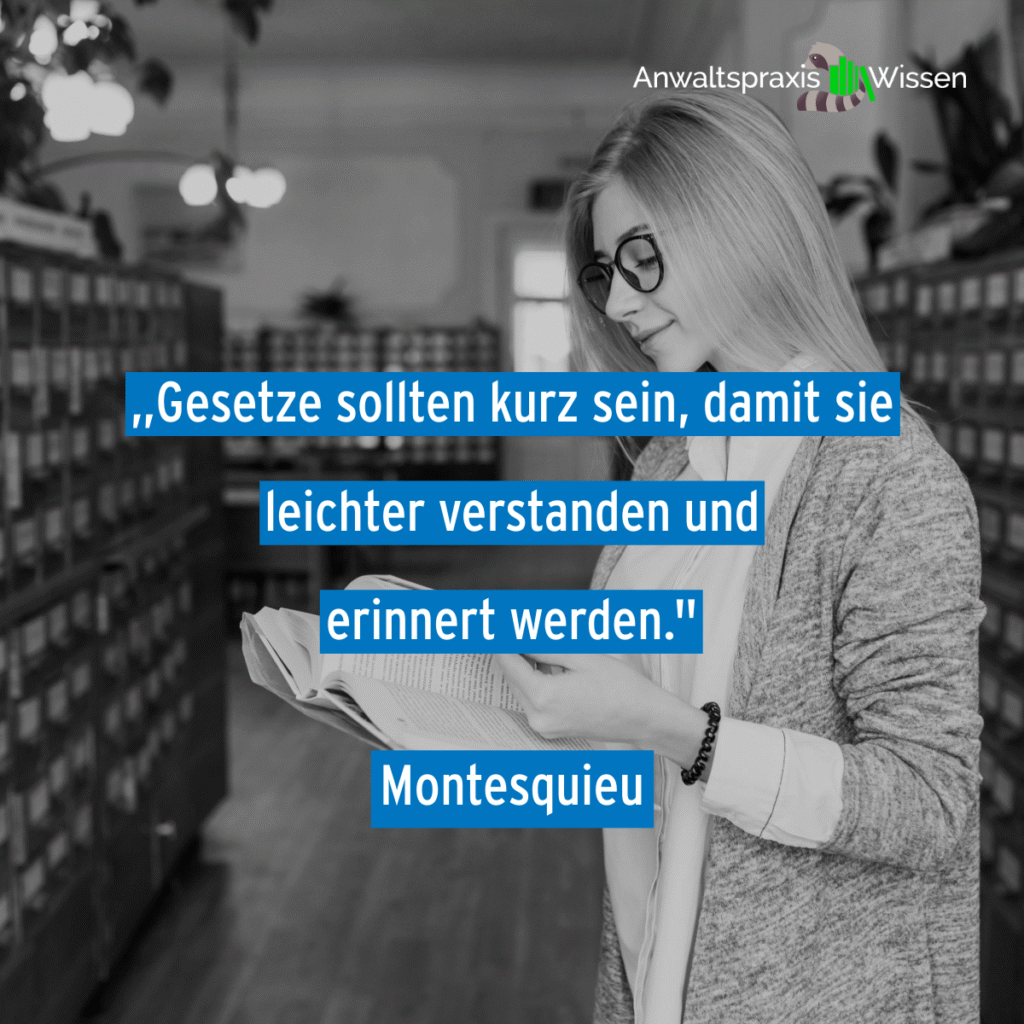
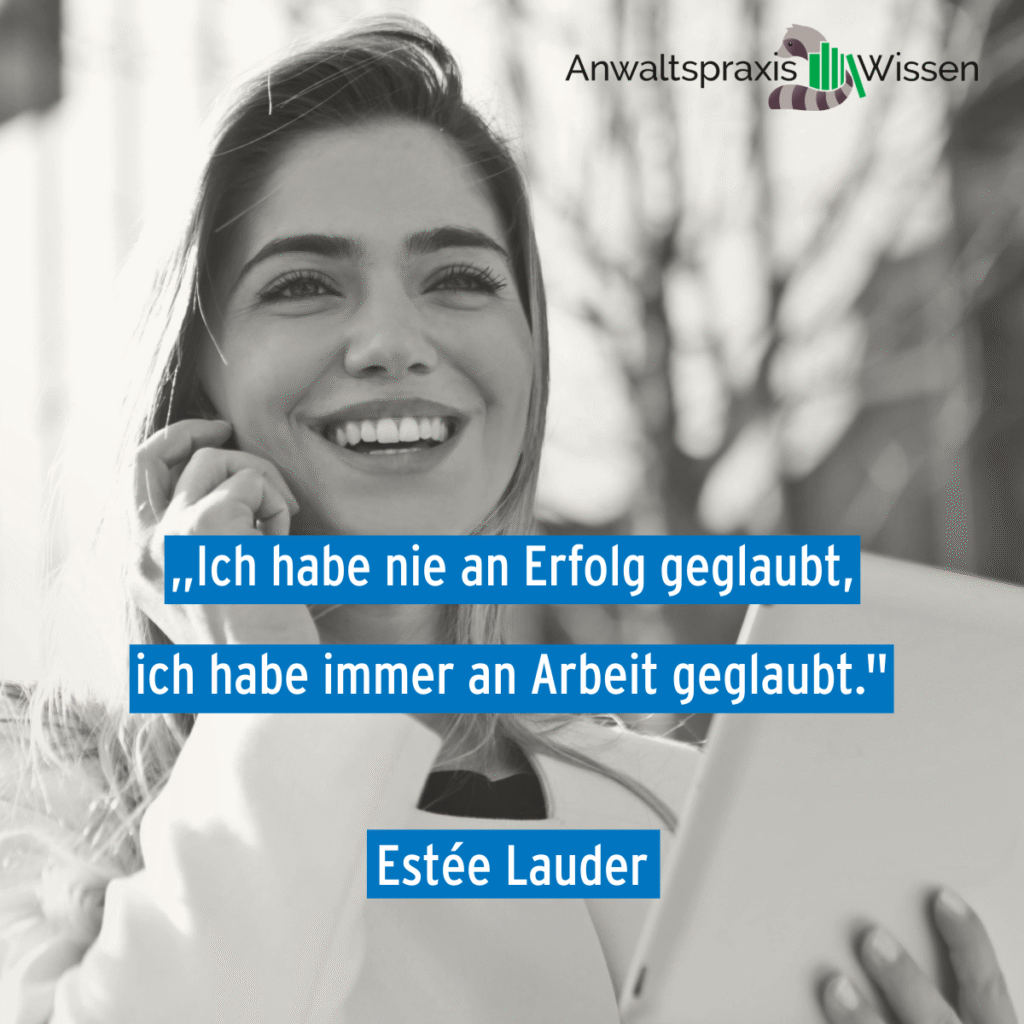

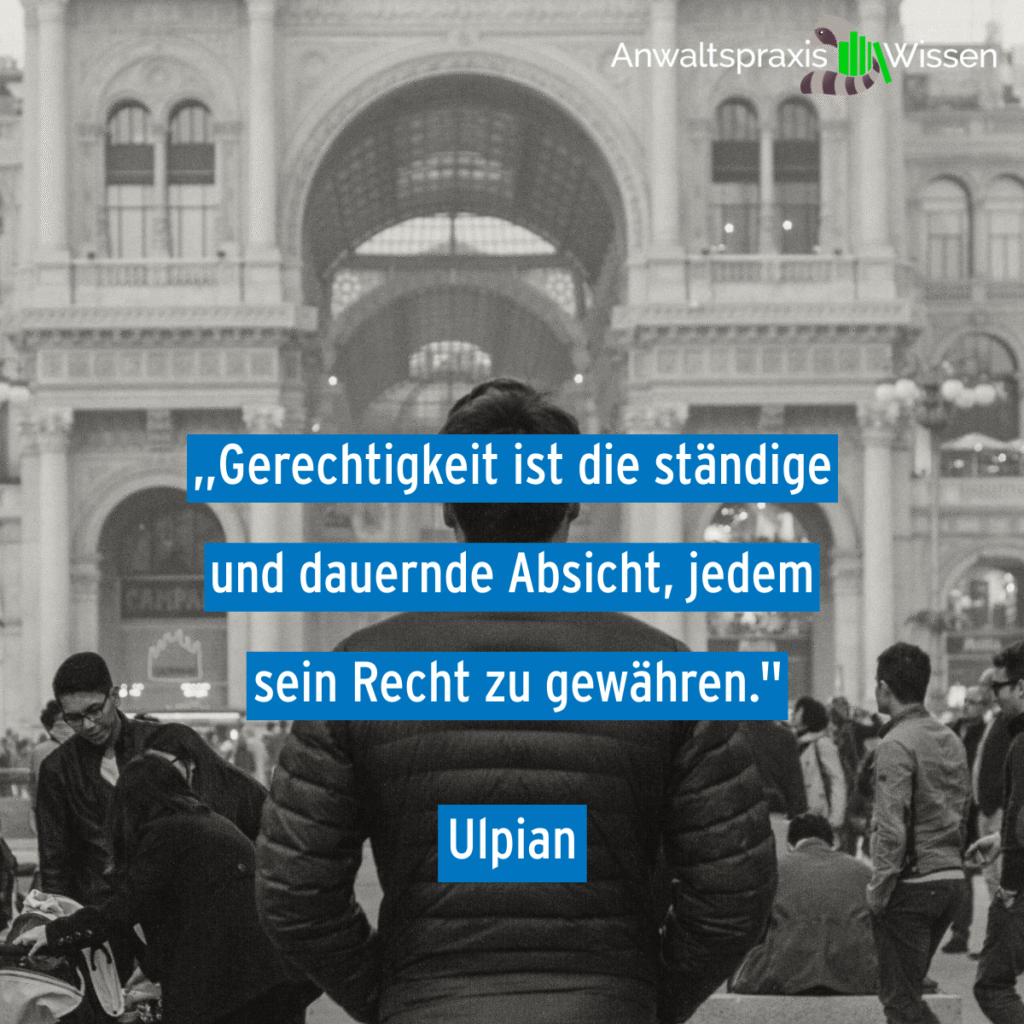

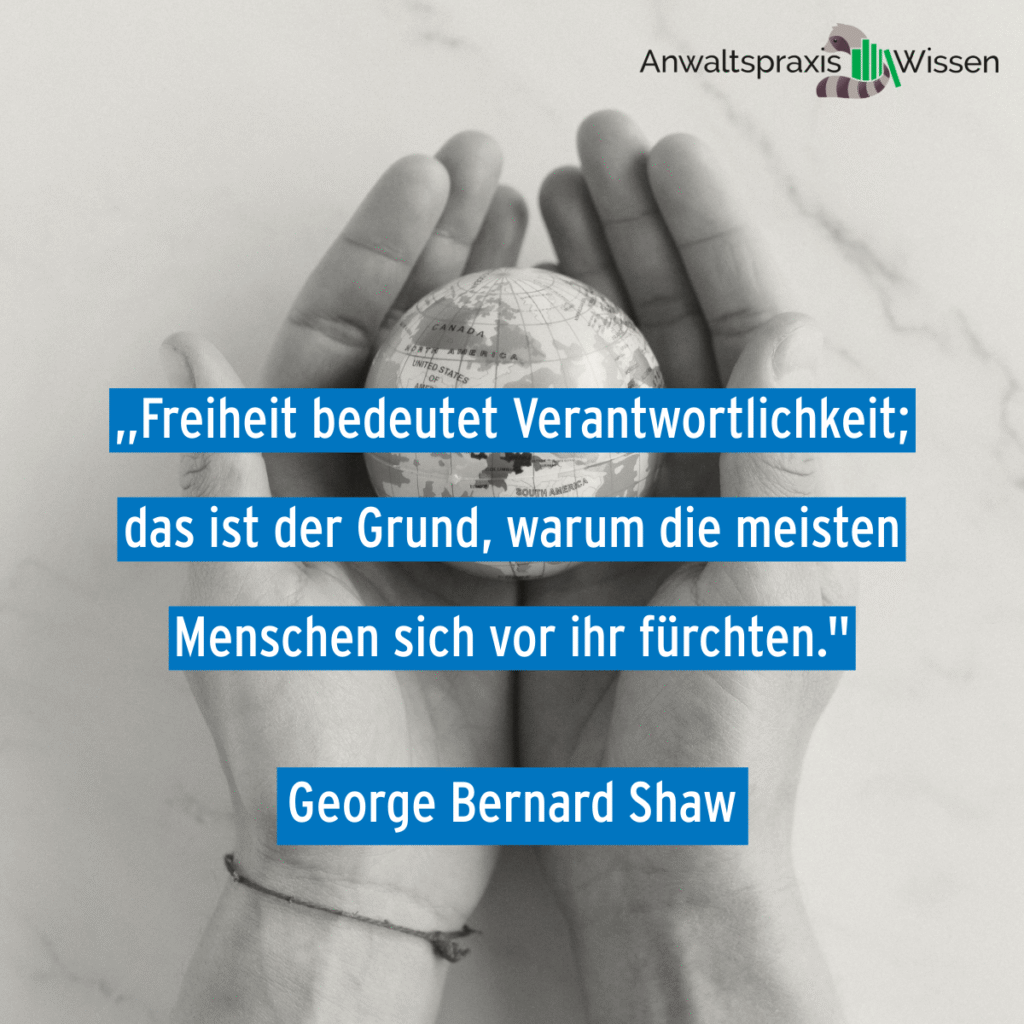

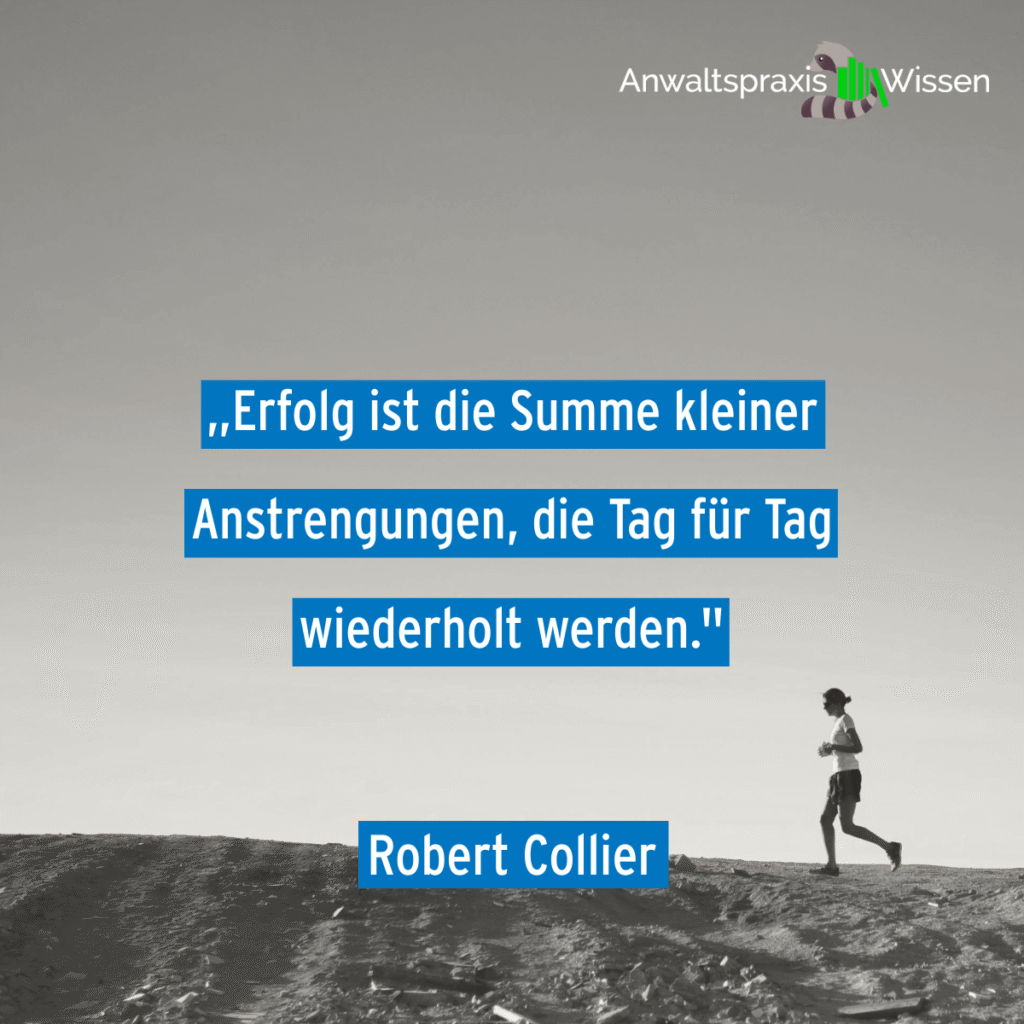

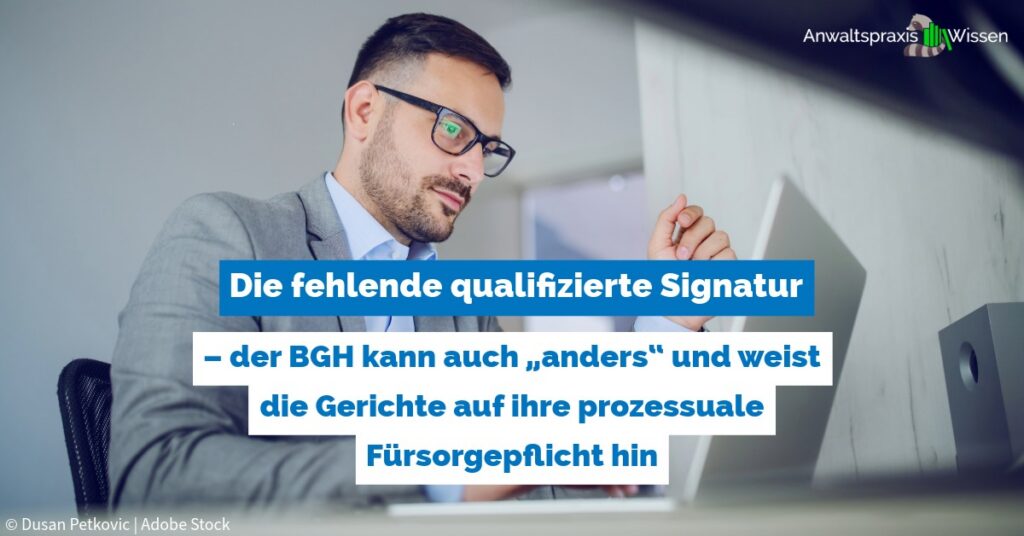

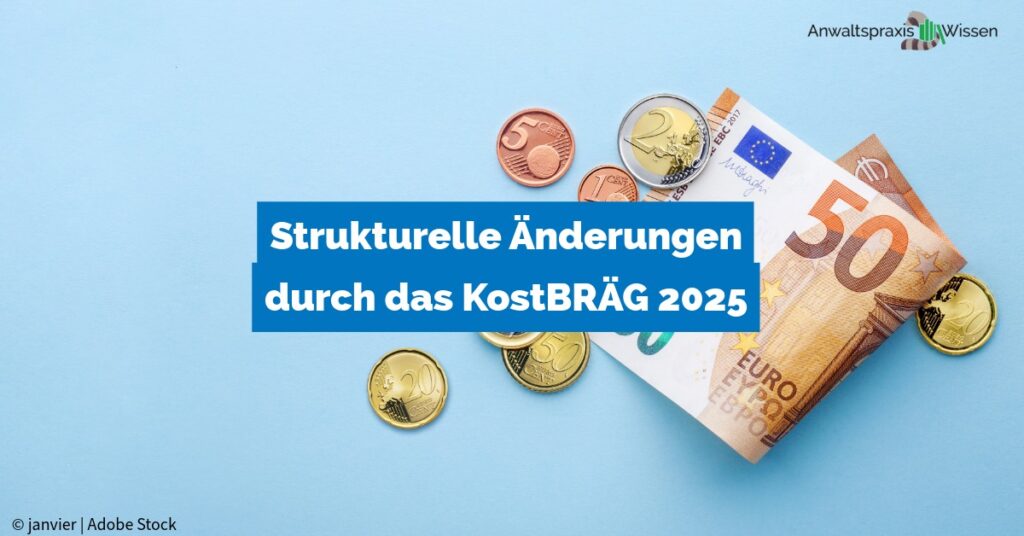

![Erbrecht im Gespräch: Kurze[s] Update: #19 Bestattungsrecht – mit Dr. Bernd Schmalenbach](https://anwaltspraxis-magazin.de/wp-content/uploads/2025/09/Erbrecht-im-Gespraech-19-1024x536.jpeg)