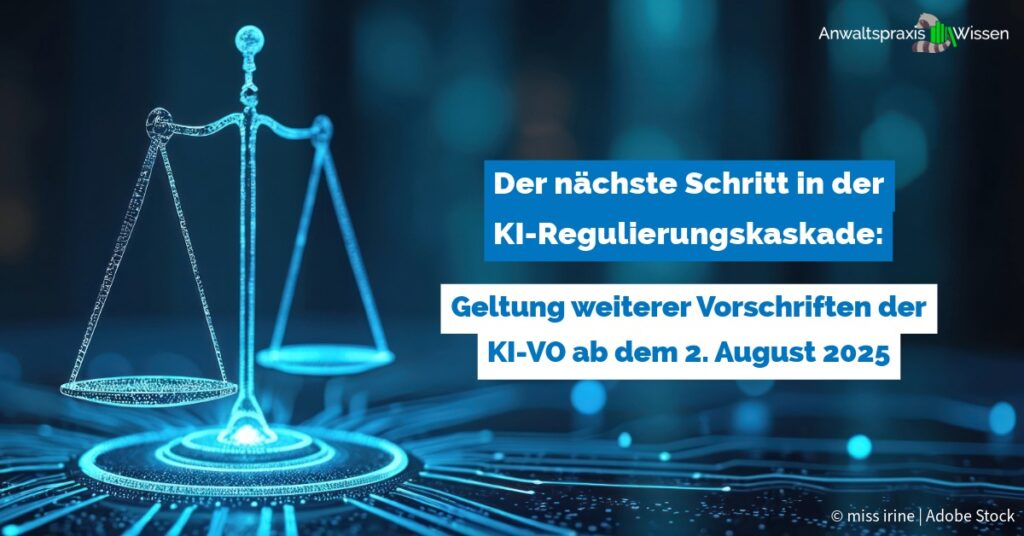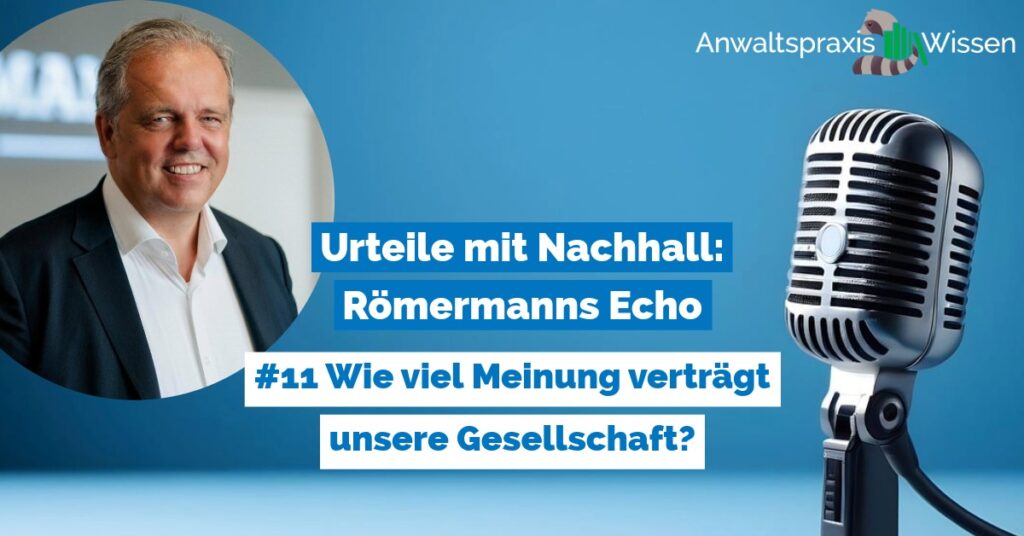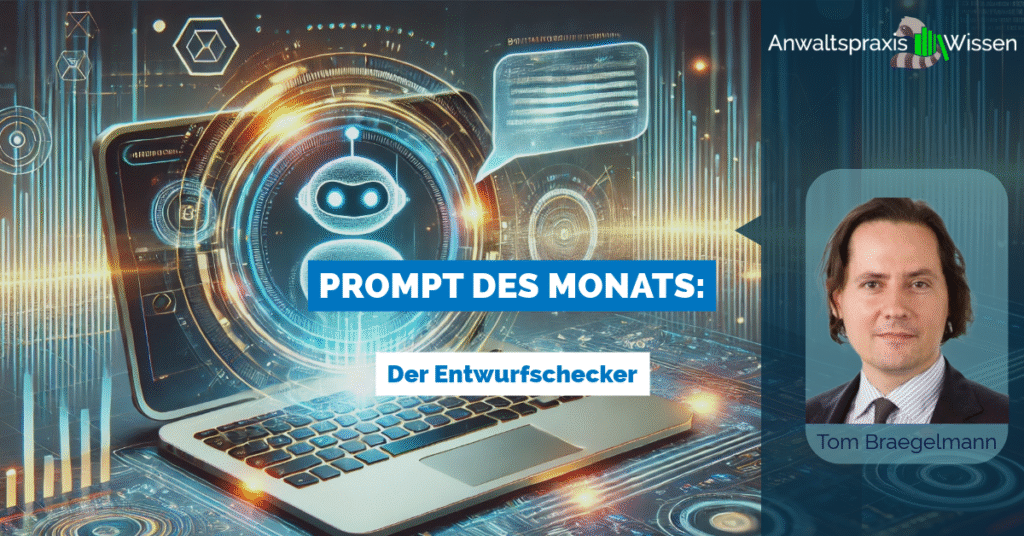Seit 1.1.2025 ist sie da: die Pflicht zur elektronischen Rechnung – kurz E-Rechnung genannt. Mit dem Wachstumschancengesetz wurden die Regelungen zur Ausstellung von Rechnungen nach § 14 UStG für ab diesem Jahr ausgeführte Umsätze neu gefasst. Doch was bedeutet das genau für die anwaltliche Praxis? Es kommt wie immer darauf an.
I. Was muss ich auf die Schnelle wissen?
Die E-Rechnungspflicht trifft alle Anwält:innen in Deutschland – allerdings in unterschiedlichem Ausmaß und zu verschiedenen Zeitpunkten.
Zum einen besteht die Pflicht zum Empfang von elektronischen Rechnungen (Eingangsrechnungen), denn auch Anwält:innen sind im Geschäftsverkehr oft Leistungs- und damit Rechnungsempfänger. Hier besteht sofort Handlungsbedarf: Eine Übergangsregelung gibt es nicht; die Pflicht, eine elektronische Rechnung empfangen zu können, gilt bereits für alle – unabhängig von Umsatz, Kleinunternehmereigenschaft oder der Mandantenstruktur. Für die kommende Lieferung von Druckerpapier kann daher bereits eine E-Rechnung im Postfach landen.
Zum anderen stellt sich die Frage der Ausstellung von elektronischen Rechnungen (Ausgangsrechnungen). Hier ist noch etwas Zeit, sich damit intensiv zu befassen – frühestens zum 1.1.2027 tritt die Pflicht in Kraft, abhängig vom Umsatz und auch nicht in allen Mandaten. Kleinunternehmer:innen sind – anders als beim Empfang – ebenfalls ausgenommen.
II. Was ist eine elektronische Rechnung überhaupt?
In § 14 Abs. 1 S. 2 UStG wird nunmehr zwischen einer elektronischen Rechnung und einer sonstigen Rechnung unterschieden.
1. Elektronische Rechnung
Eine elektronische Rechnung ist dabei nach der gesetzlichen Definition eine Rechnung, die in einem strukturierten elektronischen Format ausgestellt, übermittelt und empfangen wird und eine elektronische Verarbeitung ermöglicht (§ 14 Abs. 1 S. 3 UStG).
Nach § 14 Abs. 1 S. 6 UStG muss das strukturierte elektronische Format einer elektronischen Rechnung
1. der europäischen Norm für die elektronische Rechnungsstellung und der Liste der entsprechenden Syntaxen gem. der Richtlinie 2014/55/EU des Europäischen Parlaments und des Rates v. 16.4.2014 über die elektronische Rechnungsstellung bei öffentlichen Aufträgen (ABl L 133 v. 6.5.2014, 1.) entsprechen
oder
2. kann zwischen Rechnungsaussteller und Rechnungsempfänger vereinbart werden, sofern das Format die richtige und vollständige Extraktion der nach diesem Gesetz erforderlichen Angaben aus der elektronischen Rechnung in ein Format ermöglicht, das der Norm nach Nr. 1 entspricht oder mit dieser interoperabel ist.
Beispiele für zulässige nationale elektronische Rechnungsformate sind Rechnungen nach dem Standard XRechnung und nach dem ZUGFeRD-Format ab Version 2.0.1 (mit Ausnahme der Profile MINIMUM und BASIC-WL). Aber auch andere Formate können die Anforderungen erfüllen. Elektronische Rechnungen können dabei sowohl in einem rein strukturierten als auch in einem hybriden Format erstellt werden.
2. Sonstige Rechnung
Eine sonstige Rechnung ist eine Rechnung, die in einem anderen elektronischen Format oder auf Papier übermittelt wird (§ 14 Abs. 1 S. 4 UStG). Da das PDF-Format nicht den engen Voraussetzungen einer elektronischen Rechnung entspricht, gehört eine PDF-Rechnung ebenfalls zu den sonstigen Rechnungen.
III. Wann muss es eine E-Rechnung sein?
Die Pflicht zum Empfang und zur Erstellung elektronischer Rechnungen gilt nur für Leistungen zwischen Unternehmern, wenn der leistende Unternehmer und der Leistungsempfänger im Inland ansässig sind (§ 14 Abs. 2 S. 2 Nr. 1 UStG). Umsätze an Unternehmer in anderen EU-Mitgliedstaaten sind nicht betroffen.
Ist die Mandantschaft Verbraucher, muss ebenfalls keine elektronische Rechnung ausgestellt werden. Diese bedarf dann sogar der Zustimmung des Empfängers (§ 14 Abs. 1 S. 5 UStG).
Betroffen ist also nur der B2B-Bereich im Inland.
Zudem sind einige Ausnahmen von der Verpflichtung zur E-Rechnung für steuerbefreite Umsätze nach § 4 Nr. 8 bis 29 UStG (§ 14 Abs. 2 S. 2 UStG), Kleinbetragsrechnungen bis zu 250,00 EUR (§ 33 UStDV) sowie Verkäufe von Fahrausweisen (§ 34 UStDV) vorgesehen.
IV. Empfang von E-Rechnungen
Seit 1.1.2025 darf jedes Unternehmen an ein anderes Unternehmen eine elektronische Rechnung ohne dessen Zustimmung versenden. Es besteht somit die Pflicht, die technischen Voraussetzungen für die Entgegennahme einer solchen Rechnung zu erfüllen. Grds. reicht dafür die Bereitstellung eines E-Mail-Postfachs aus, was bereits fast alle Anwält:innen haben. Ein gesondertes E-Mail-Postfach für den Rechnungsempfang ist nicht zwingend erforderlich. Es bietet sich aber an, um die Verfahrensabläufe zu optimieren und die Vorteile einer elektronischen Rechnung besser nutzen zu können. Möglich ist es aber auch, andere zulässige Übermittlungswege, wie den Abruf in einem Portal, zu vereinbaren.
Auch weiterhin gilt, dass die Rechnung lesbar sein muss. Lesbarkeit bedeutet jedoch künftig nicht mehr „vom menschlichen Auge lesbar“, sondern „maschinell lesbar“. Es gibt daher rein strukturierte Datenformate, basierend auf einem XML-Format, das in erster Linie der maschinellen Verarbeitung dient und sich nicht unmittelbar für eine Sichtprüfung durch das menschliche Auge eignet (Standard XRechnung). Aber auch hybride Formate stehen zur Verfügung. So besteht das ZUGFeRD-Format neben dem strukturierten Datenteil auch aus einem menschenlesbaren Datenteil (zum Beispiel PDF-Dokument), das beide in einer Datei zusammenfasst.
Es ist davon auszugehen, dass sich i.S.d. Kundenfreundlichkeit das hybride Format durchsetzt, das eine Lesbarkeit auch für das Auge ohne weitere Zwischenschritte ermöglicht. Sollte doch einmal eine reine XML-Datei eingehen, gibt es aber auch für Anwält:innen, die keine Büroprogramme mit entsprechenden Funktionen besitzen, kostenfreie Tools zur Visualisierung, u.a. auch von ELSTER.
V. Ausstellung von E-Rechnungen
Anwält:innen, die Kleinunternehmer:innen sind, brauchen sich mit der Pflicht zur Ausstellung elektronischer Rechnungen nicht zu befassen. Diese sind nach § 34a S. 3 UStDV befreit und können immer eine sonstige Rechnung erstellen, also z.B. im Papier- oder PDF-Format. Dasselbe gilt bei Verbrauchermandaten.
Relevant sind daher nur die Mandate, in denen Unternehmen bzw. Unternehmer:innen Leistungsempfänger sind.
Bis Ende 2026 dürfen für alle 2025 und 2026 ausgeführten Umsätze noch Rechnungen in Papierform oder (vorbehaltlich der Zustimmung des Empfängers) in einem elektronischen Format, das nicht den neuen Anforderungen entspricht (z.B. als einfache PDF-Datei), ausgestellt werden.
Ab dem 1.1.2027 müssen dann Unternehmen, deren Gesamtumsatz im vorangegangenen Kalenderjahr bei mehr als 800.000,00 EUR lag, umstellen und eine elektronische Rechnung ausstellen.
Alle mit einem Umsatz bis zu 800.000,00 EUR haben noch ein Jahr länger Zeit, ab dem 1.1.2028 trifft dann aber auch diese die Pflicht.
Für eine Rechnungsberichtigung gelten i.Ü. die gleichen Anforderungen an Form und Inhalt wie in § 14 UStG. Daher muss auch die Berichtigung einer E-Rechnung in der für diese vorgeschriebenen Form erfolgen (§ 31 Abs. 5 S. 3 UStDV).
Auch für die Erstellung (und den Empfang) elektronischer Rechnungen gibt es Unternehmen, die isolierte Lösungen anbieten. Besonderes Augenmerk sollte dabei natürlich auf die anwaltliche Verschwiegenheit und § 43e BRAO, § 2 BORA gelegt werden.
VI. Aufbewahrung
Der strukturierte Teil einer E-Rechnung ist so aufzubewahren, dass dieser in seiner ursprünglichen Form vorliegt und die Anforderungen an die Unveränderbarkeit erfüllt werden. Für die Finanzverwaltung muss eine maschinelle Auswertbarkeit sichergestellt sein. Sollten für die Besteuerung bedeutende Aufzeichnungen in einem zusätzlich übersandten Dokument (z.B. Bildteil einer hybriden Rechnung) enthalten sein, sind diese in ihrer ursprünglichen Form aufzubewahren und sie müssen die Anforderungen an die Unveränderbarkeit erfüllen.
Der Ausdruck einer elektronischen Rechnung und Aufbewahrung im Papierformat genügt daher den steuerlichen Anforderungen nicht.
VII. Wozu das Ganze?
Bereits seit Ende 2020 müssen Lieferungen und Leistungen gegenüber öffentlichen Auftraggebern mittels elektronischer Rechnung abgerechnet werden. Mit dem Wachstumschancengesetz (Gesetz zur Stärkung von Wachstumschancen, Investitionen und Innovation sowie Steuervereinfachung und Steuerfairness, BGBl 2024 I Nr. 108 v. 27.3.2024) wurde die Pflicht zu elektronischen Rechnungen jetzt auch auf den unternehmerischen Verkehr ausgeweitet.
Der bisherige Vorrang der Papierrechnung wurde aufgegeben.
Mit der jetzigen obligatorischen Pflicht zur elektronischen Rechnung verfolgt der Gesetzgeber zwei Ziele:
- Zum einen soll das Verfahren für die zu einem späteren Zeitpunkt einzuführende Verpflichtung zur transaktionsbezogenen Meldung von Umsätzen im B2B-Bereich durch Unternehmer an ein bundeseinheitliches elektronisches System der Verwaltung (Meldesystem) vorbereitet und für die Unternehmer entzerrt werden.
- Zum anderen soll die Nutzung der bestehenden Möglichkeiten der Digitalisierung in der Wirtschaft gefördert und unternehmensinterne Prozesse bei der Rechnungsverarbeitung vereinfacht werden, was auch dem Bürokratieabbau dient. Durch eine medienbruchfreie Übermittlung der Rechnungsdaten können Fehler bei einer manuellen Erfassung auf Seiten des Rechnungsempfängers vermieden werden (S. Gesetzesbegründung in BT-Drucks 20/ 8628, 204).
Rechnungsprozesse sollen also vereinfacht und Mehrwertsteuerbetrug eingedämmt werden.
VIII. Was ist mit § 10 RVG?
Nach dem RVG ist Schriftform nicht mehr erforderlich. Für eine ordnungsgemäße Berechnung gem. § 10 Abs. 1 S. 1 RVG reicht inzwischen die Textform aus. Diese wird auch mit der elektronischen Rechnung gewahrt. Und auch die Pflichtangaben nach § 10 Abs. 2 RVG sollten keine Probleme verursachen, da auch bei elektronischen Rechnungen neben den reinen umsatzsteuerrelevanten Daten entsprechende Möglichkeiten für ergänzende Angaben vorgesehen sein dürften.
IX. Ausblick
Auch die Anwaltschaft kommt an der elektronischen Rechnung nicht vorbei. Die Umstellung ist zwar mit Aufwand verbunden; Sorge ist aber nicht nötig. Die Pflicht trifft nicht nur die Anwaltschaft, sondern alle Unternehmer und Selbstständigen.
Außerdem sollten auch die Vorteile in den Blick genommen werden, die mit der Einführung und damit der weiteren Digitalisierung der Arbeitsabläufe verbunden sind. Akten werden zunehmend digital geführt, manche arbeiten bereits sogar völlig papierlos. Gerade in Zeiten des Fachkräftemangels können digitalisierte Arbeitsabläufe dabei wertvolle Ressourcen freisetzen. Neben erspartem Papier und Porto ermöglichen elektronische Rechnungen bei entsprechender Organisation eine automatisierte Verarbeitung und Weiterleitung, größere örtliche Flexibilität, eine Beschleunigung der Zahlungsabläufe, eine geringere Fehleranfälligkeit als bei händischer Verarbeitung und Übertragung der Daten und damit weniger Personalaufwand.
Weitere detaillierte Informationen zu den umsatzsteuerlichen Anforderungen lassen sich dem BMF-Schreiben v. 15.10.2024 zur Ausstellung von Rechnungen nach § 14 Umsatzsteuergesetz (UStG) III C 2 – S 7287-a/23/10001 :007 sowie den FAQ des Bundesfinanzministeriums entnehmen.
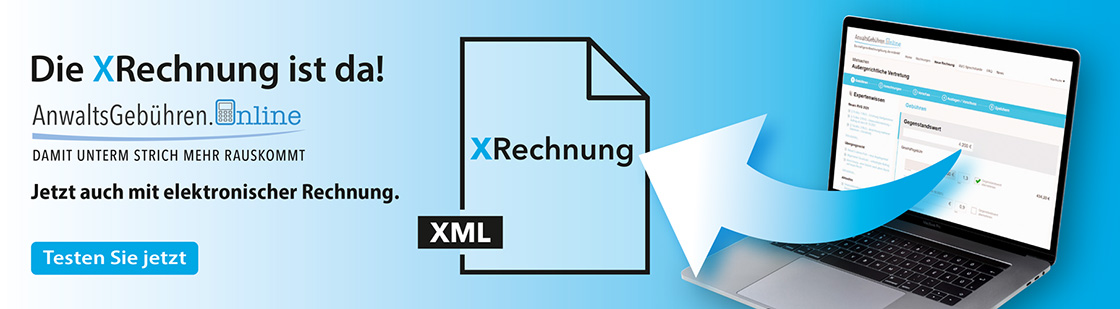

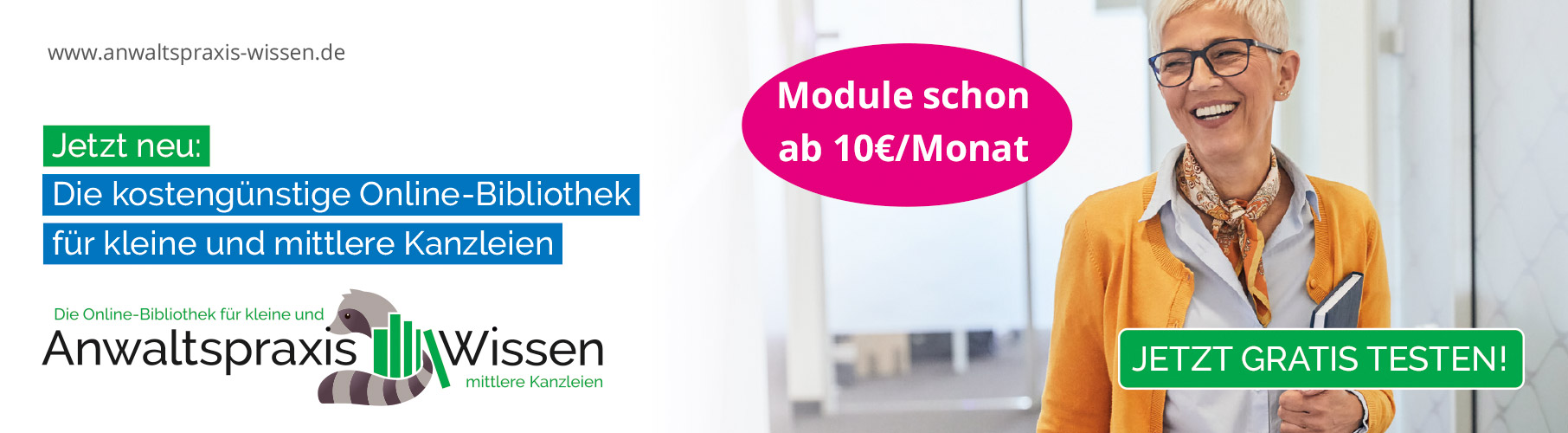

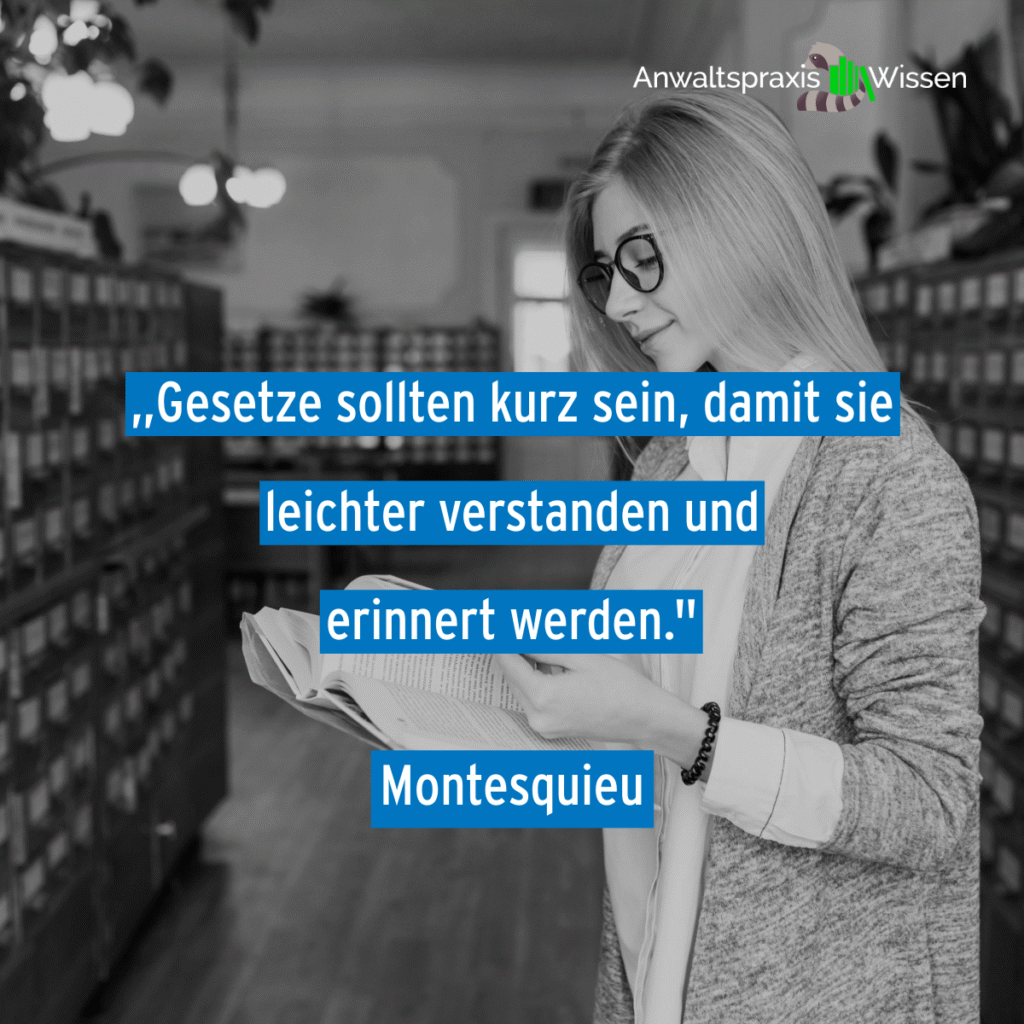
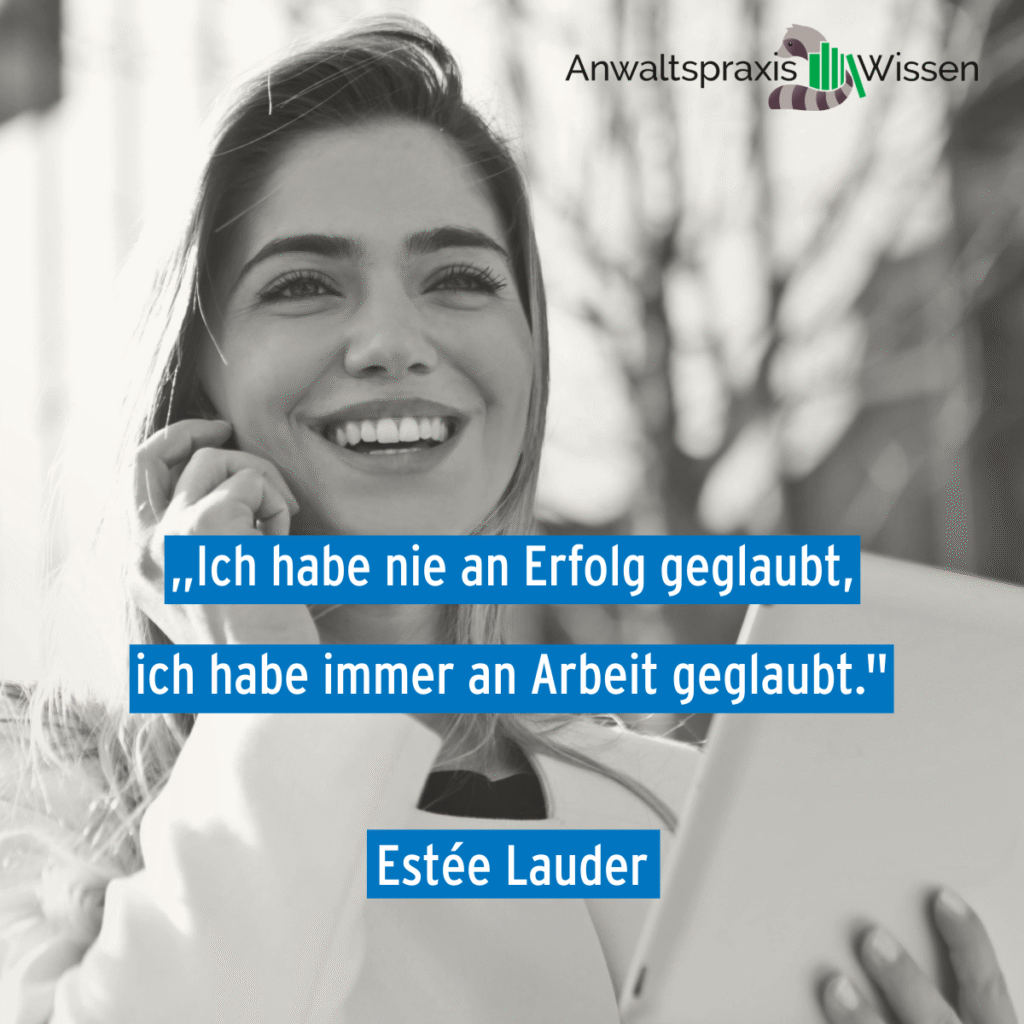

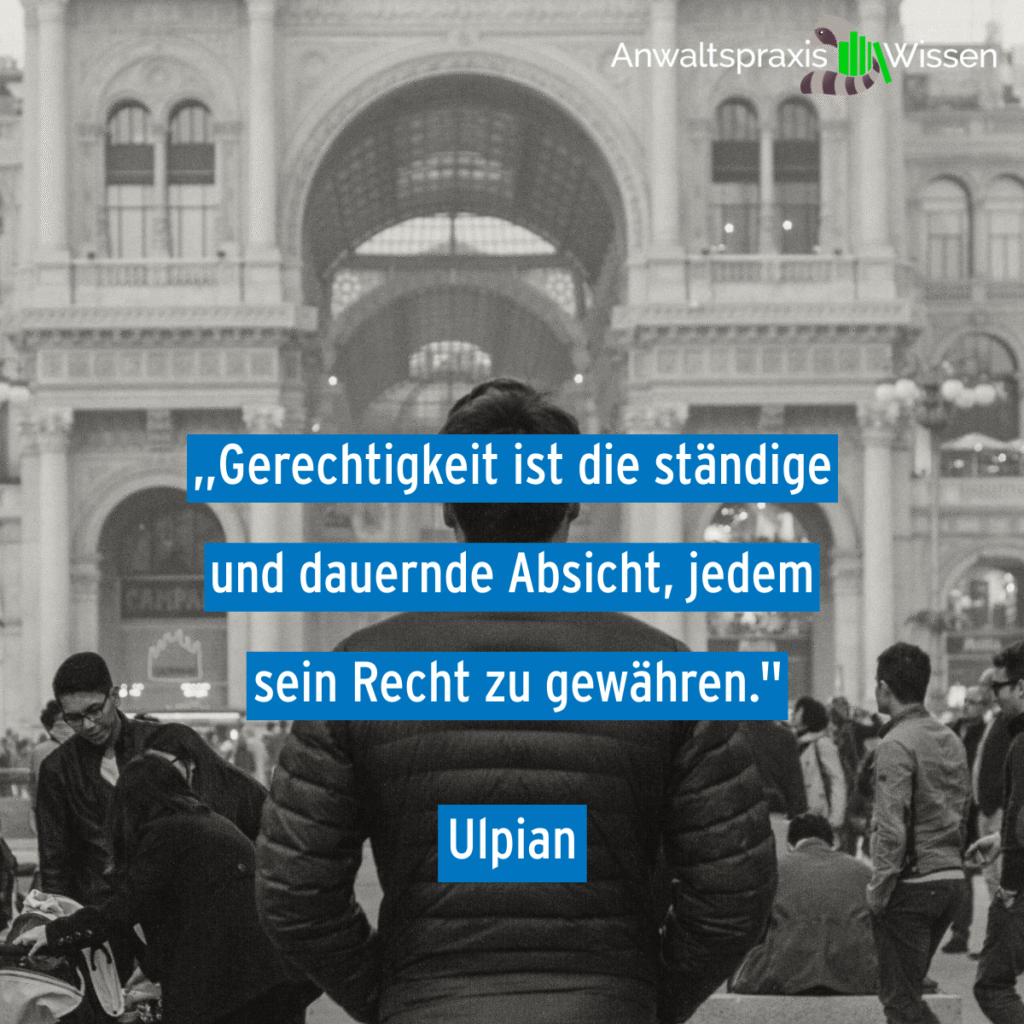

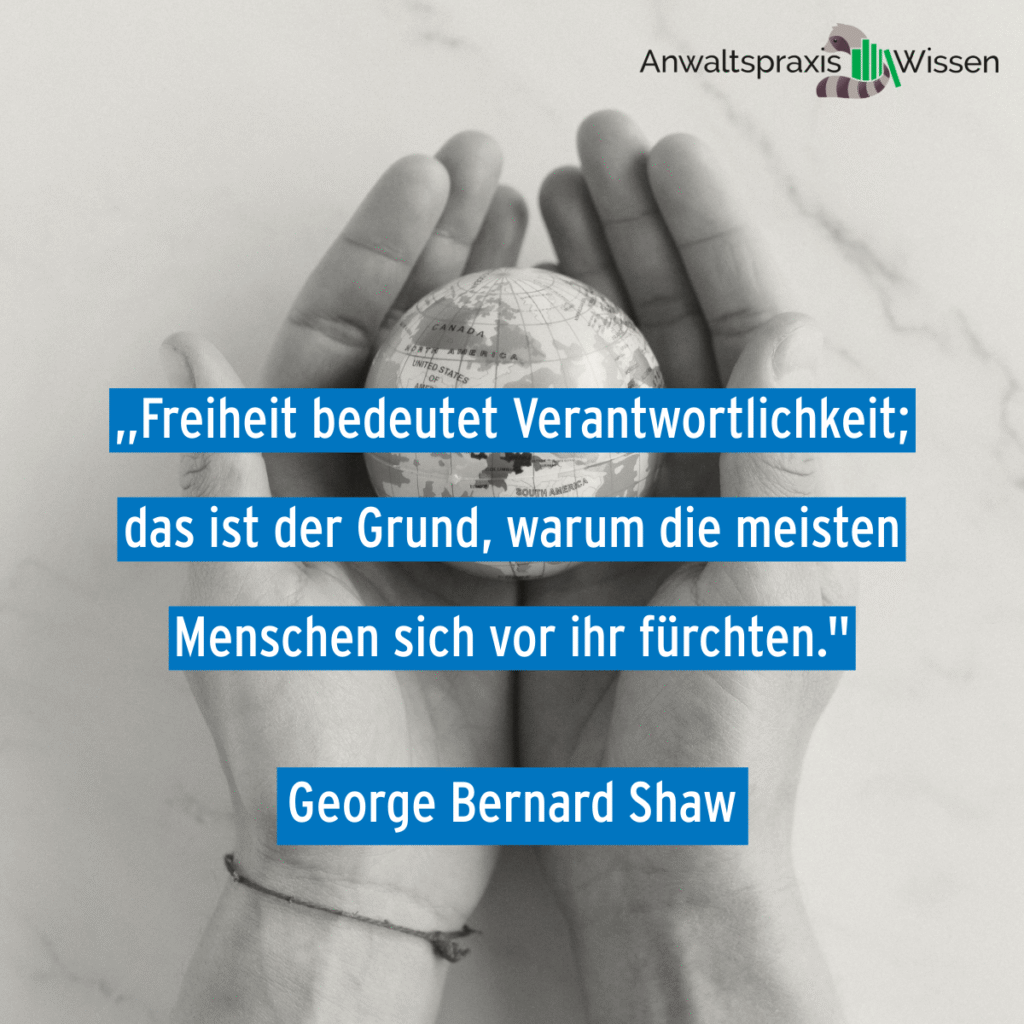

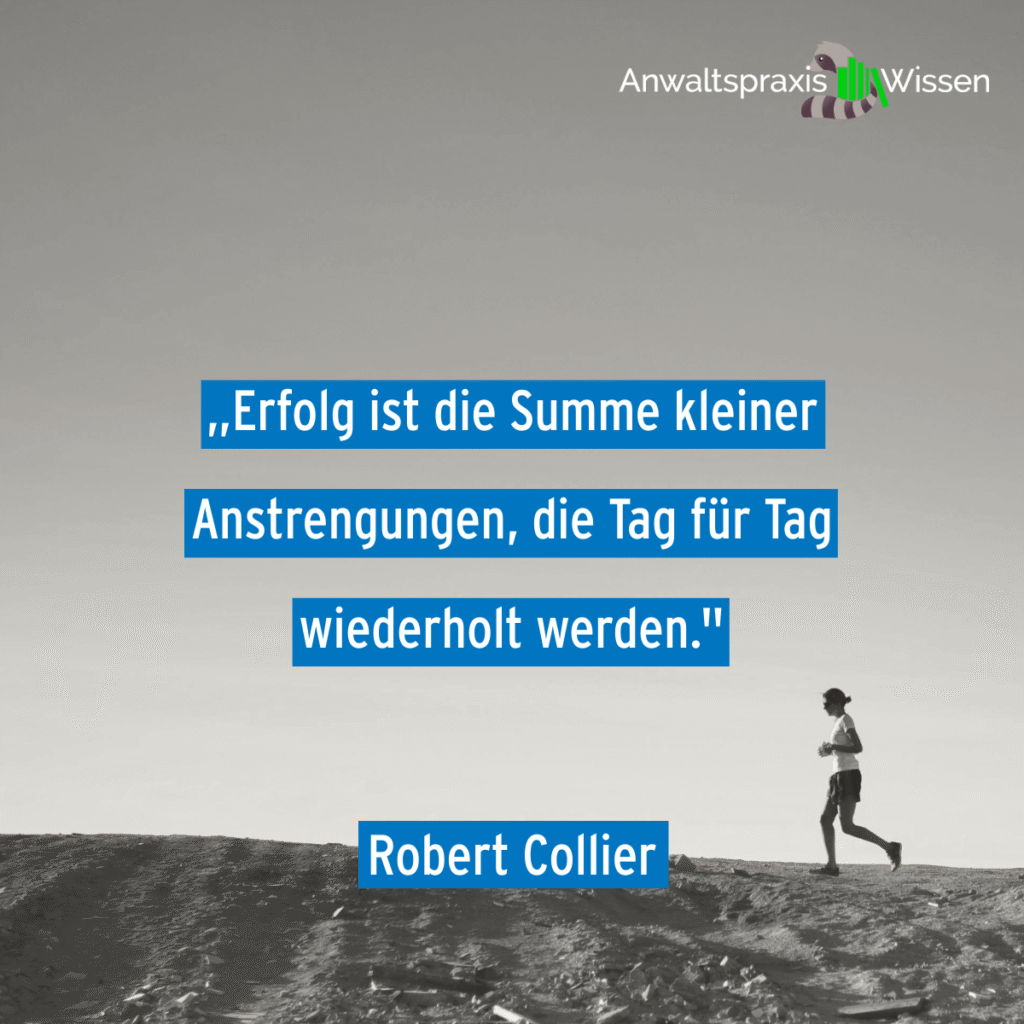

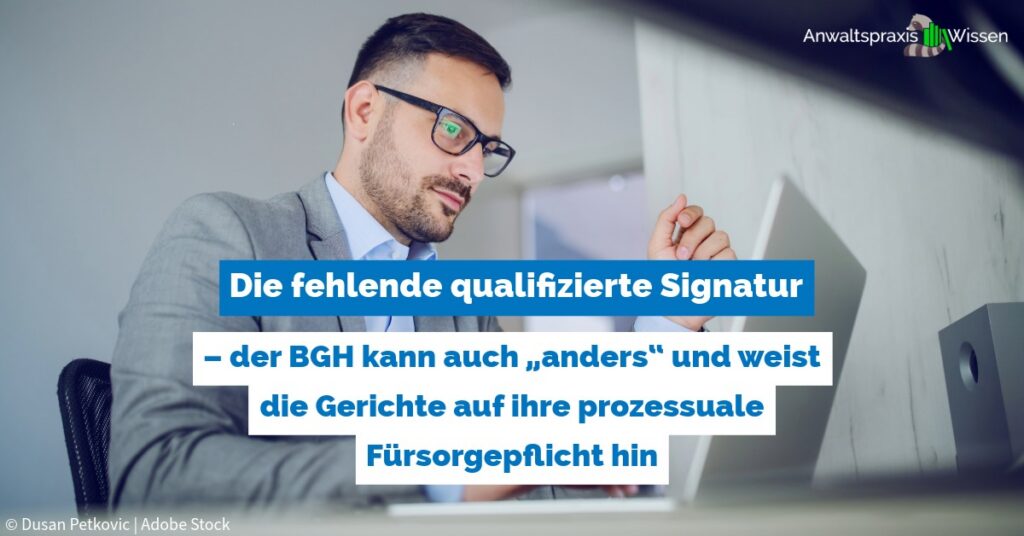

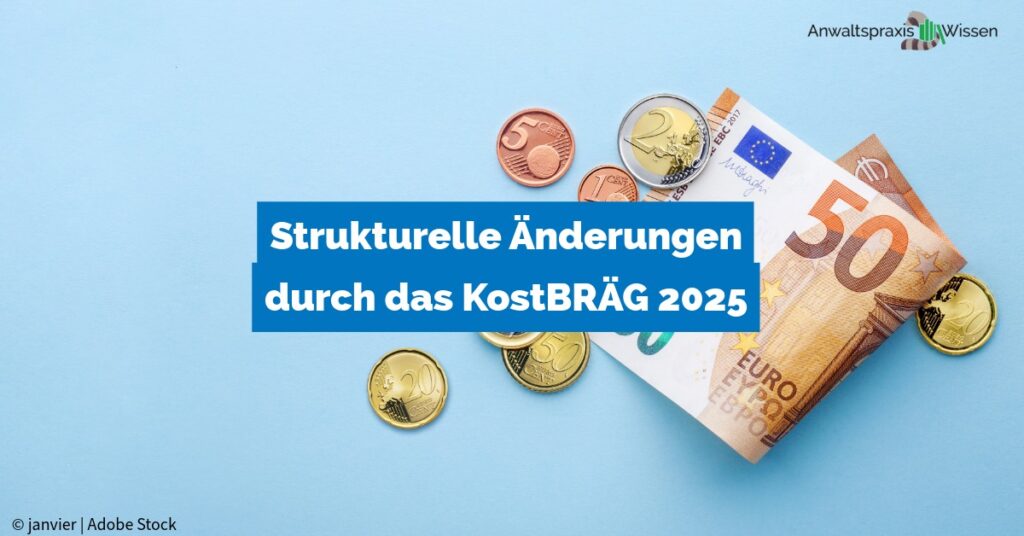

![Erbrecht im Gespräch: Kurze[s] Update: #19 Bestattungsrecht – mit Dr. Bernd Schmalenbach](https://anwaltspraxis-magazin.de/wp-content/uploads/2025/09/Erbrecht-im-Gespraech-19-1024x536.jpeg)