Die einfache Signatur – was das ist und wann und wie sie angewendet wird, haben wir bereits genauer in unserem Beitrag aus Dezember 2024 erläutert: der Namenszug am Ende eines Schriftsatzes, entweder in Textform oder aber auch als eingescannte Unterschrift. Sie reicht für Schriftsätze aus, die Berufsträger selbst mit ihrer beA-Karte oder ihrem Zertifikat aus ihrem eigenen Postfach versenden. Denn die Höchstpersönlichkeit dieses Postfaches – nur der Berufsträger selbst darf aus seinem Postfach mit seiner beA-Karte bzw. seinem Zertifikat versenden – weist die Identität des Absenders und damit zugleich die Verantwortung des Schriftsatzes nach.
Ein „maschinenschriftlicher“ Namensschriftzug, soll – so der Bundesgerichtshof in seinem Beschluss vom 7.9.2022, XII ZB 215/22 – zur einfachen „Identifizierung“ aus Vor- und Nachname bestehen; sofern der Status als Berufsträger nicht aus dem Briefkopf hervorgeht, ist unter dem Namen der Zusatz „Rechtsanwalt“ bzw. „Rechtsanwältin“ anzugeben. Zudem ließ der BGH in diesem Urteil durchblicken, dass eine einfache Signatur in Form von „Rechtsanwalt“ (also ohne eigenhändige lesbare Unterschrift oder „maschinenschriftlichen“ Vor- und Zunamen) grundsätzlich nicht ausreicht.
Das Bundesarbeitsgericht erkennt insoweit aber eine Ausnahme und entschied, dass der Zusatz „Rechtsanwalt“ beim Einzelanwalt ausreicht (BAG, Beschluss vom 25.08.2022, 2 AZN 234/22). Ob das der BGH auch so sieht?
Dass eine eingescannte Unterschrift lesbar sein muss, um die Kriterien der Identifizierbarkeit zu erfüllen, wurde bereits durch das Bundessozialgericht mit Beschluss vom 16.2.2022, B 5 R 198/21 B, bestätigt. Das reiht sich in formalen Anforderungen, die der BGH stellt, ein.
Was letztlich noch fehlte, war eine Entscheidung darüber, ob eine Unterschrift auch leserlich sein muss, wenn es sich bei dem Verfahrensbevollmächtigten um einen Einzelanwalt bzw. eine Einzelanwältin handelt und dies aus dem Briefkopf ersichtlich ist. Mit diesem Thema musste sich der BGH im Verfahren VI /B 91/23 beschäftigen und entschied: Ja – auch in diesen Fällen muss eine eingescannte Unterschrift leserlich und damit identifizierbar sein.
Was war passiert?
Ein Einzelanwalt hatte im Rahmen eines Zivilverfahrens über sein beA einen Schriftsatz bei Gericht eingereicht. Am Ende des Dokuments fand sich eine eingescannte Unterschrift, die jedoch – wie so oft – kaum oder gar nicht leserlich war. Weitere Angaben zur Person, wie ein maschinenschriftlicher Name oder der Zusatz „Rechtsanwalt“, fehlten. Das Berufungsgericht hat die Berufung wegen Nichteinhaltung der Formvorschriften als unzulässig verworfen.
Und der BGH verwarf seine Rechtsbeschwerde ebenfalls mit der Begründung, es fehle an einer ordnungsgemäßen Unterzeichnung und stellte klar: Auch wenn ein Einzelanwalt aus seinem eigenen beA sendet, genügt eine unleserliche eingescannte Unterschrift nicht. Es müsse stets erkennbar sein, wer das Dokument verantwortet – entweder durch eine lesbare eingescannte Unterschrift, einen maschinenschriftlichen Namenszug mit Vor- und Nachnamen, oder den Berufsträgerstatus durch Zusatz wie „Rechtsanwalt“. Der Umstand, dass es sich um einen Einzelanwalt handelt, reicht für sich genommen nicht aus.
Kritik
Die Entscheidung überzeugt formal, wirft jedoch (wie auch schon die vorerwähnte Entscheidung des Bundessozialgerichts) Zweifel an der Praxistauglichkeit auf. Denn das beA ist gerade darauf ausgelegt, dass nur der Berufsträger selbst über sein Postfach senden darf. Die höchstpersönliche Nutzung (Karte und PIN dürfen nicht aus der Hand gegeben werden, anderenfalls ist das Postfach „kompromittiert“) soll die Verantwortung für den Schriftsatz dokumentieren. Wenn nun zusätzlich verlangt wird, dass die Unterschrift leserlich sein oder ein maschinenschriftlicher Namenszug mit Berufsangabe beigefügt werden muss, stellt sich die Frage, wie viel Vertrauen der BGH dem beA-System tatsächlich entgegenbringt.
Im Grunde unterstellt der BGH, dass eine missbräuchliche Nutzung des Postfachs – etwa durch Weitergabe der beA-Karte – möglich, vielleicht sogar häufig ist, obwohl dies berufsrechtlich untersagt ist. Das ist nachvollziehbar, führt aber dazu, dass selbst bei ordnungsgemäßer Nutzung ein Schriftsatz als unzureichend unterzeichnet gelten kann, wenn der Name nicht leserlich ist oder die Signatur nur den Zusatz „Rechtsanwalt“ oder „Rechtsanwältin“ enthält. Die Folge ist ein formales Risiko für Anwältinnen und Anwälte, das sich leicht vermeiden ließe, wenn die Verantwortung für den Schriftsatz – wie ursprünglich vom Gesetzgeber vorgesehen – an die sichere Übermittlung durch den Berufsträger geknüpft würde (Anders natürlich, wenn die Versendung durch Mitarbeiterkarte oder -zertifikat erfolgt: Dann ist stets eine Signatur erforderlich; wenn die Versendung über ein Postfach einer Berufsausübungsgesellschaft erfolgt, muss ebenfalls für eine Identifizierbarkeit der verantwortlichen Person gesorgt werden).
Fazit:
Die oberen Gerichte sind streng und erfordern – insbesondere durch die teilweise widersprüchlichen Entscheidungen – eine Optimierung der Kanzleiabläufe: Wählen Sie immer den sicheren Weg und beenden Sie jeden Schriftsatz mit dem Namen des Berufsträgers bzw. der Berufsträgerin, ergänzt um den Zusatz „Rechtsanwalt“ oder „Rechtsanwältin“.





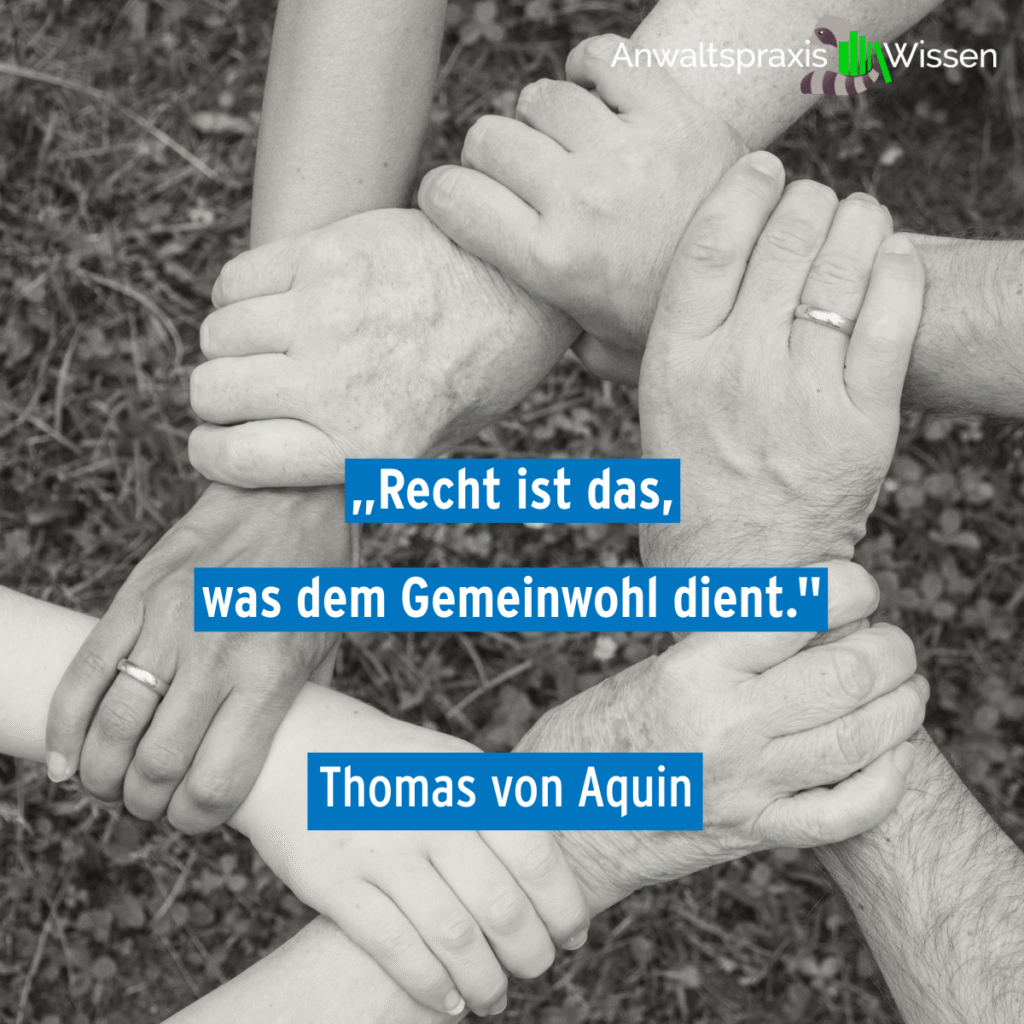
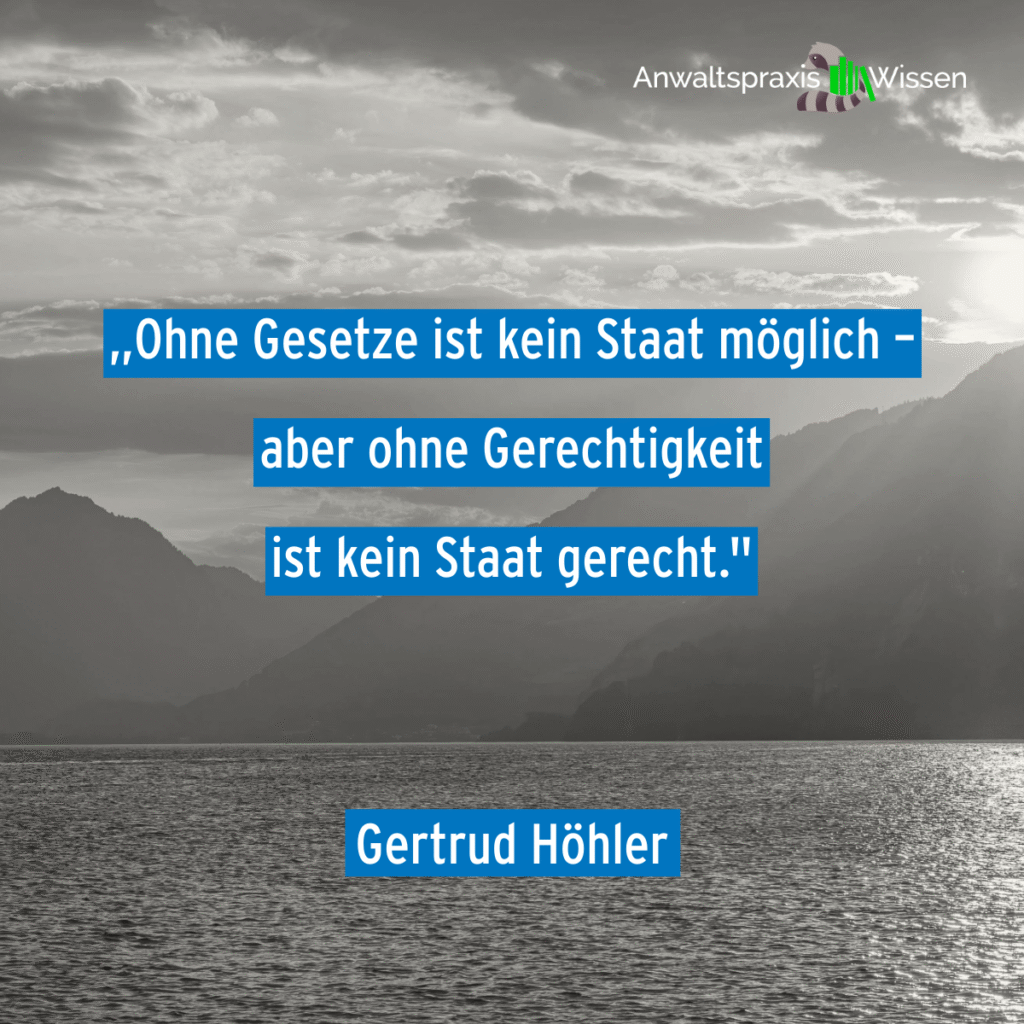
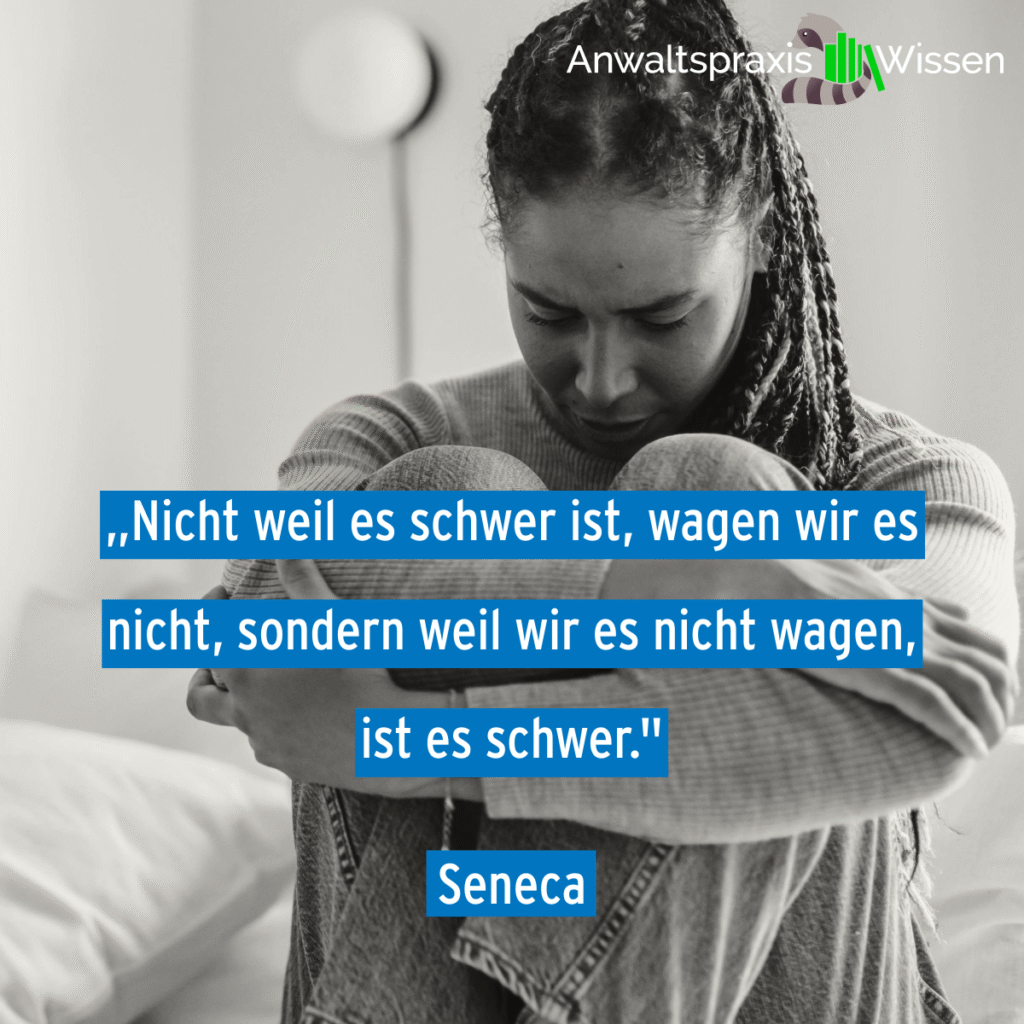
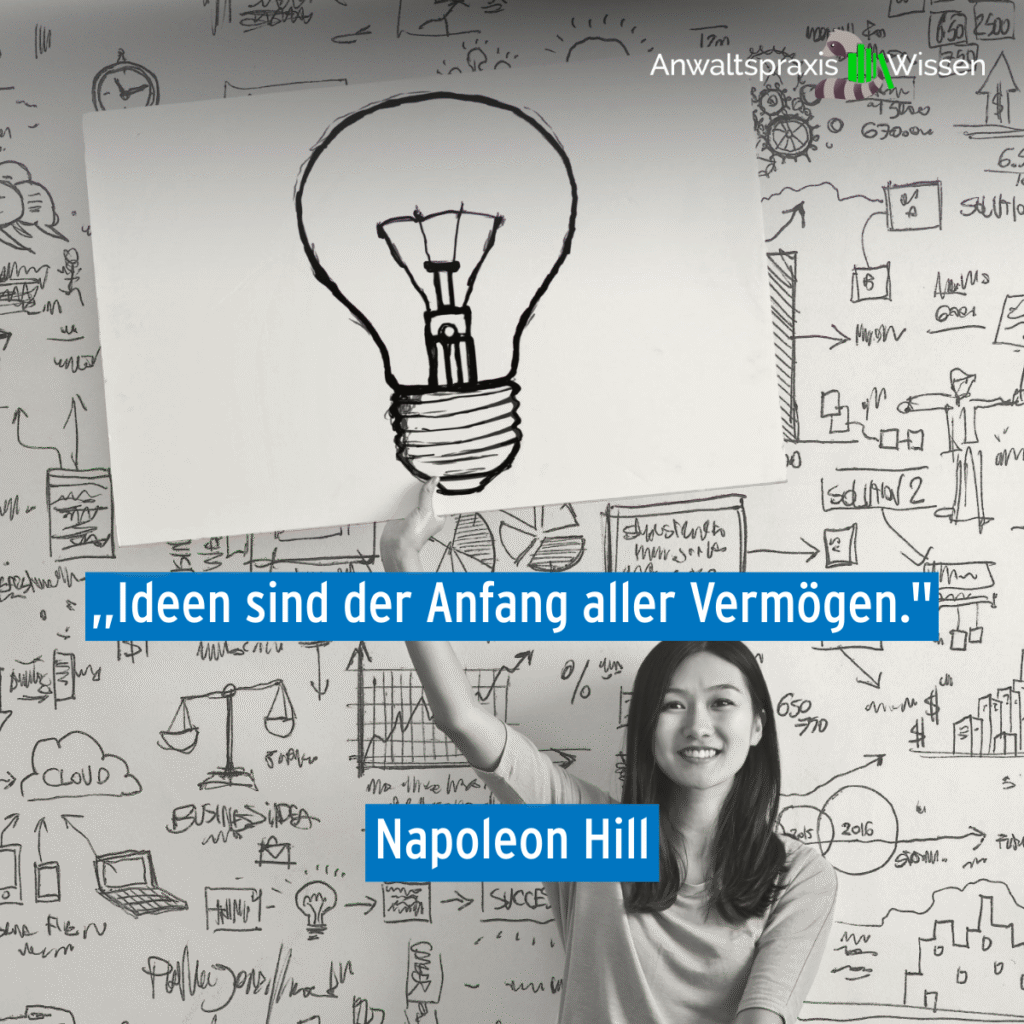
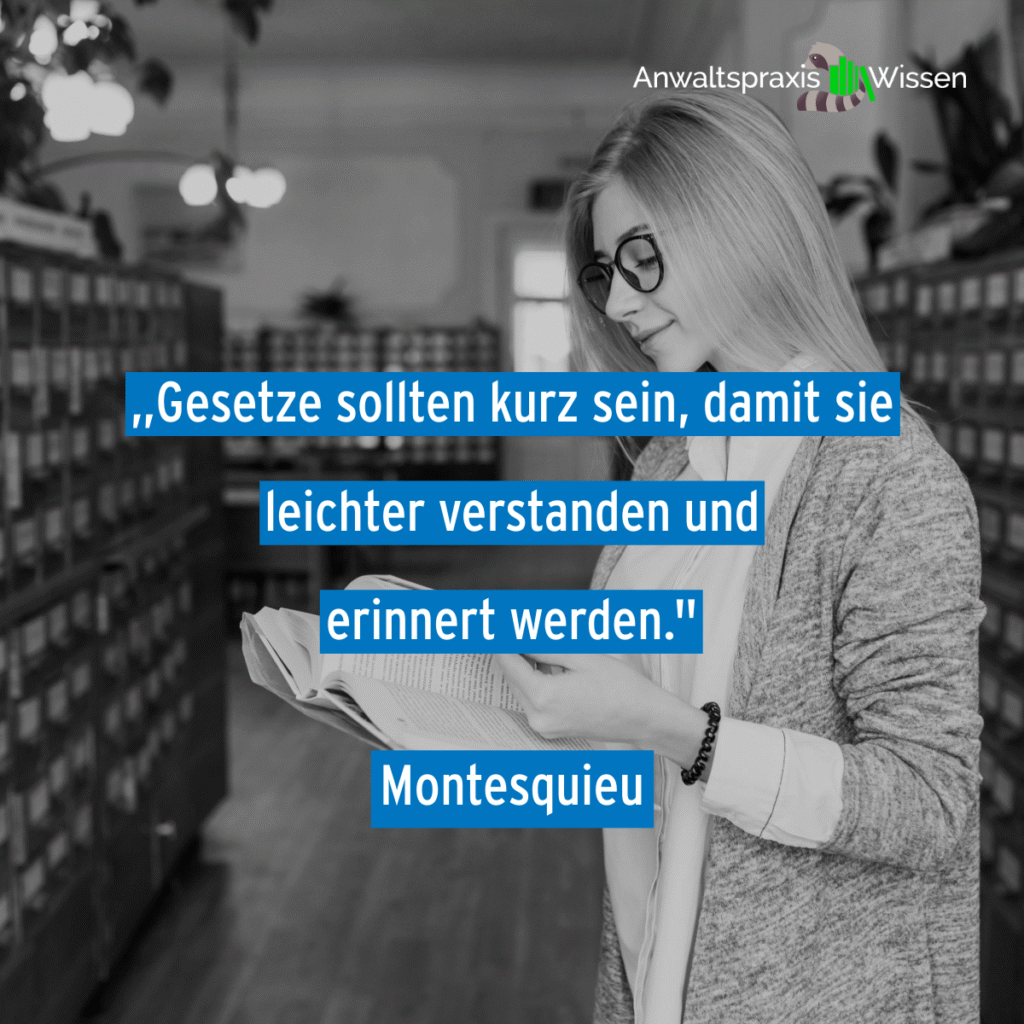





![Erbrecht im Gespräch: Kurze[s] Update: #21 Ehegatten: Testament oder Erbvertrag? – mit Dr. Markus Sikora](https://anwaltspraxis-magazin.de/wp-content/uploads/2025/11/Erbrecht-im-Gespraech-21-1024x536.jpeg)





