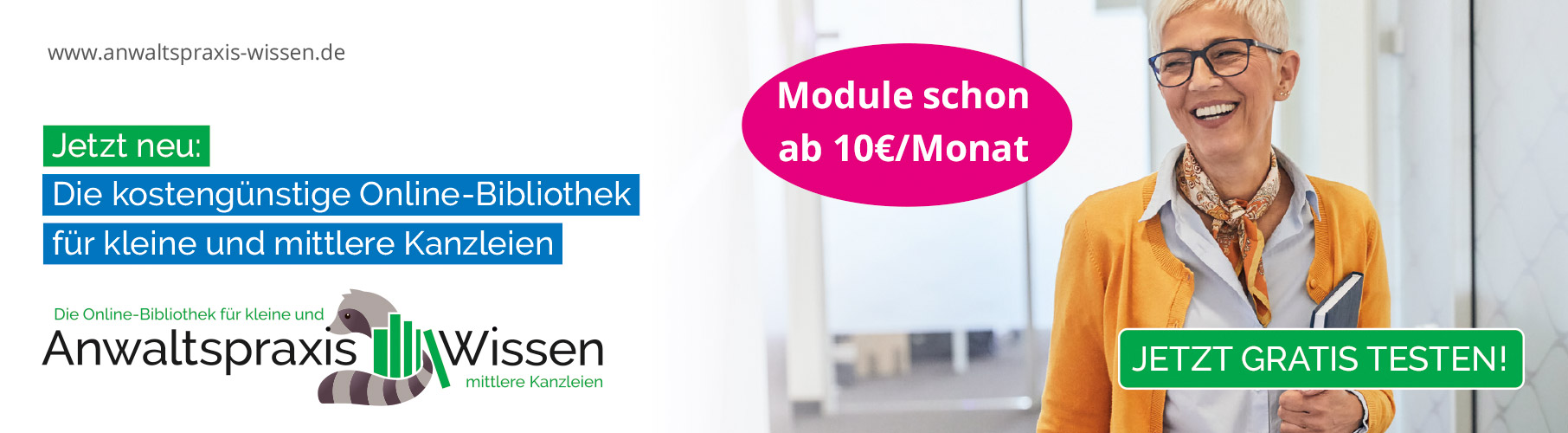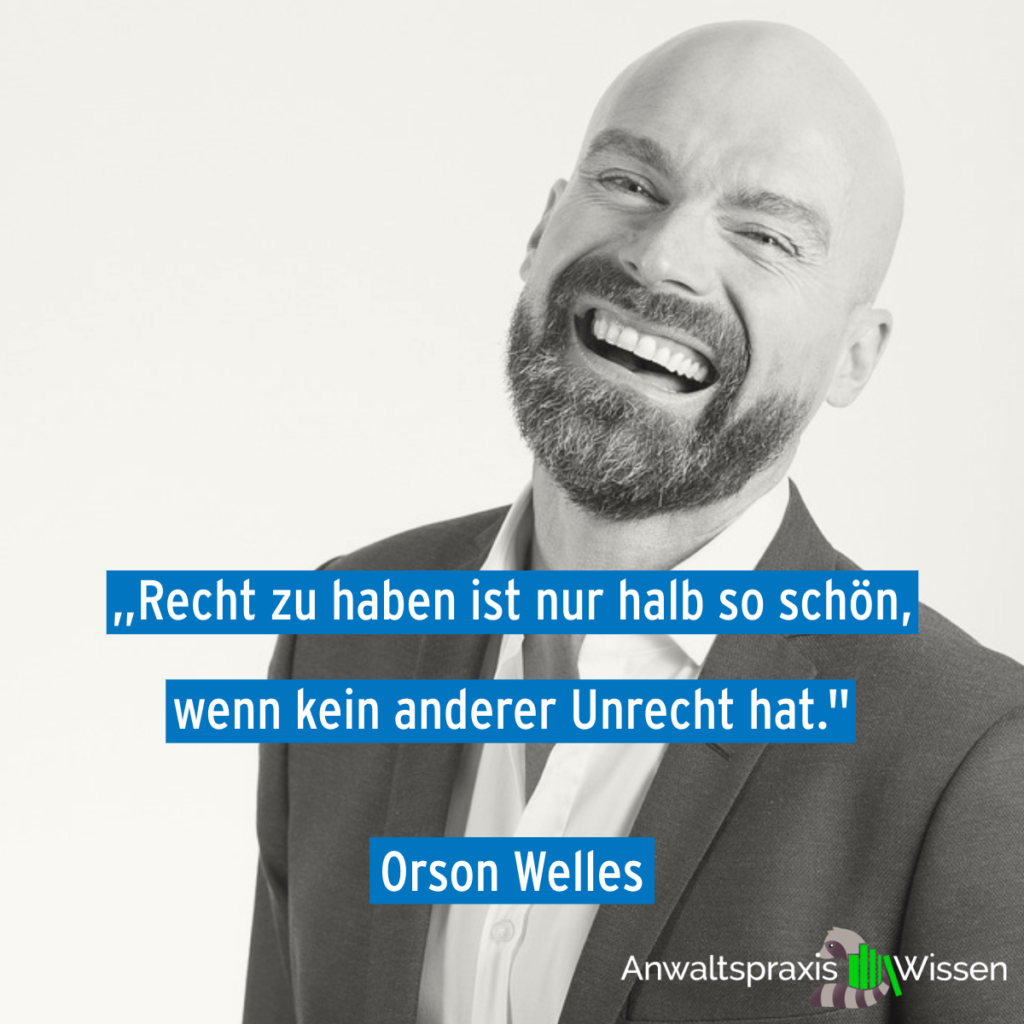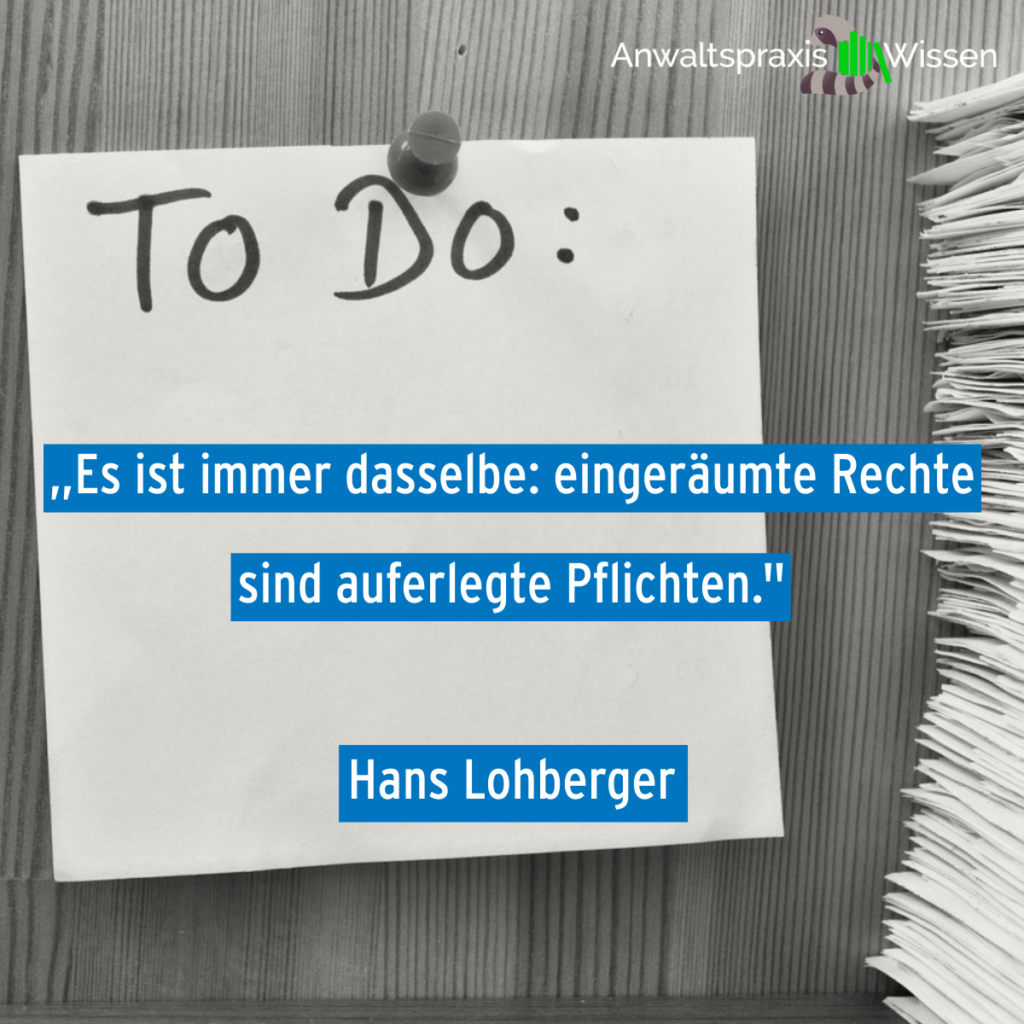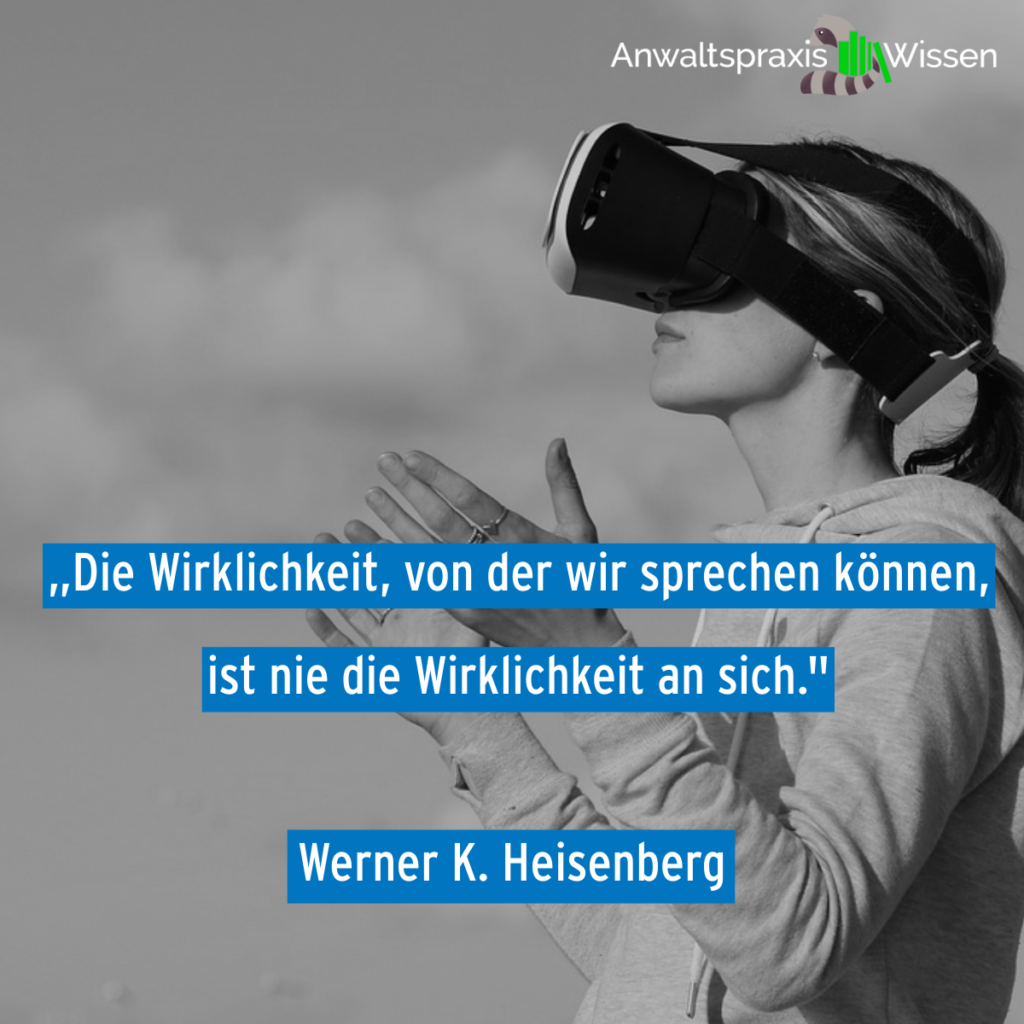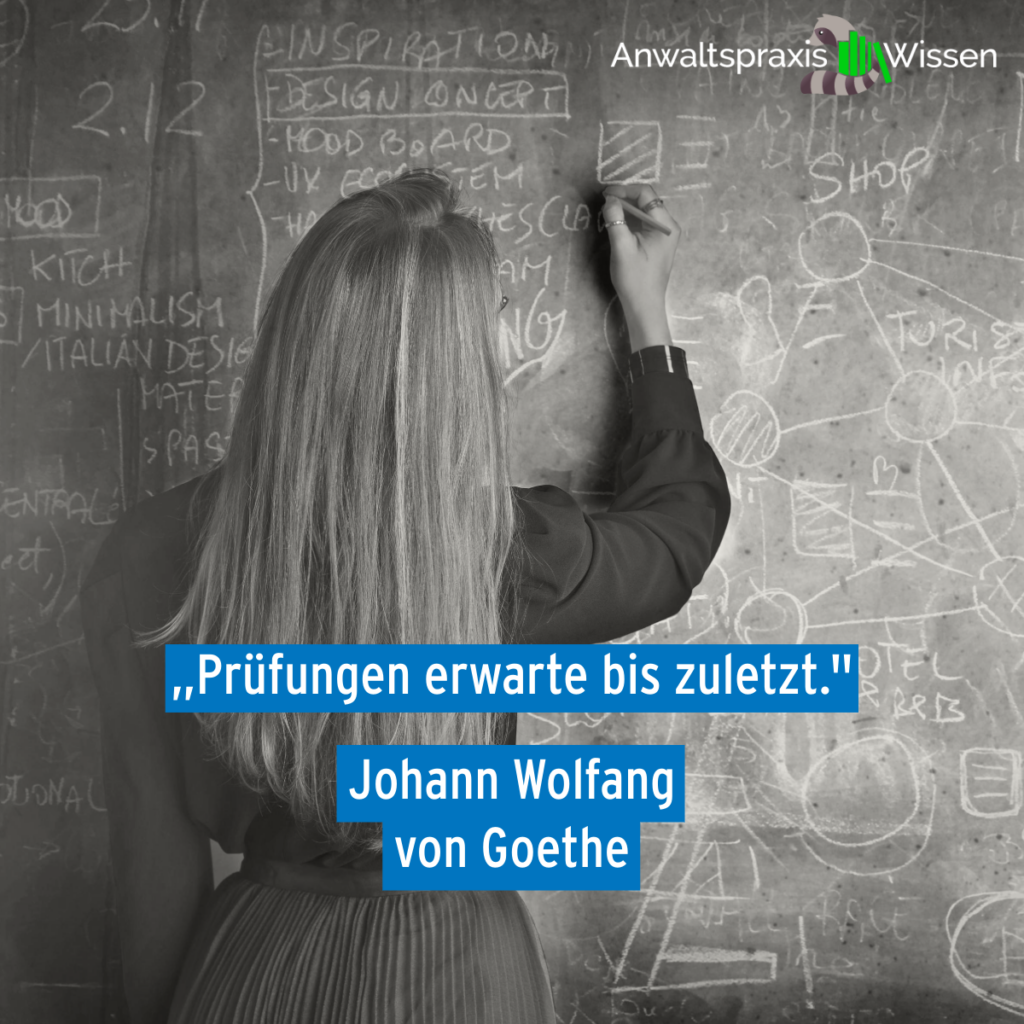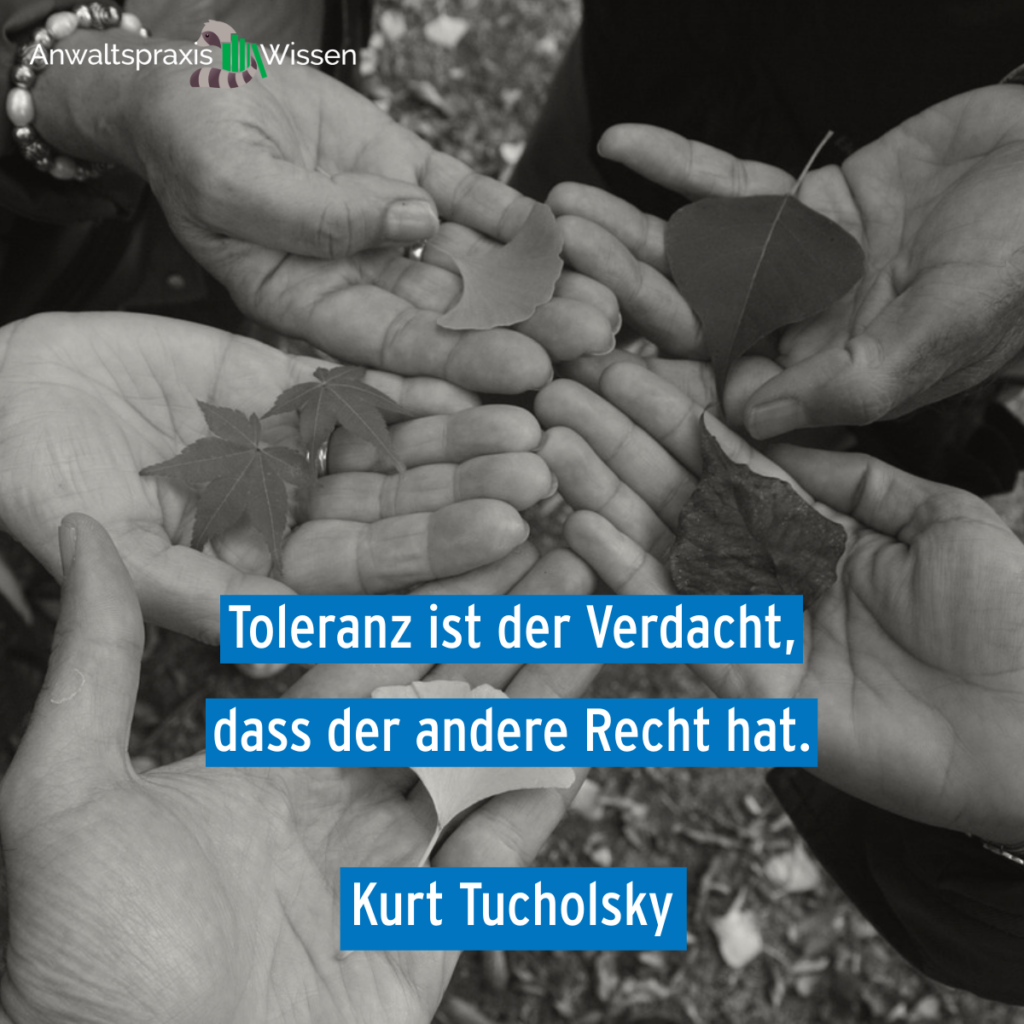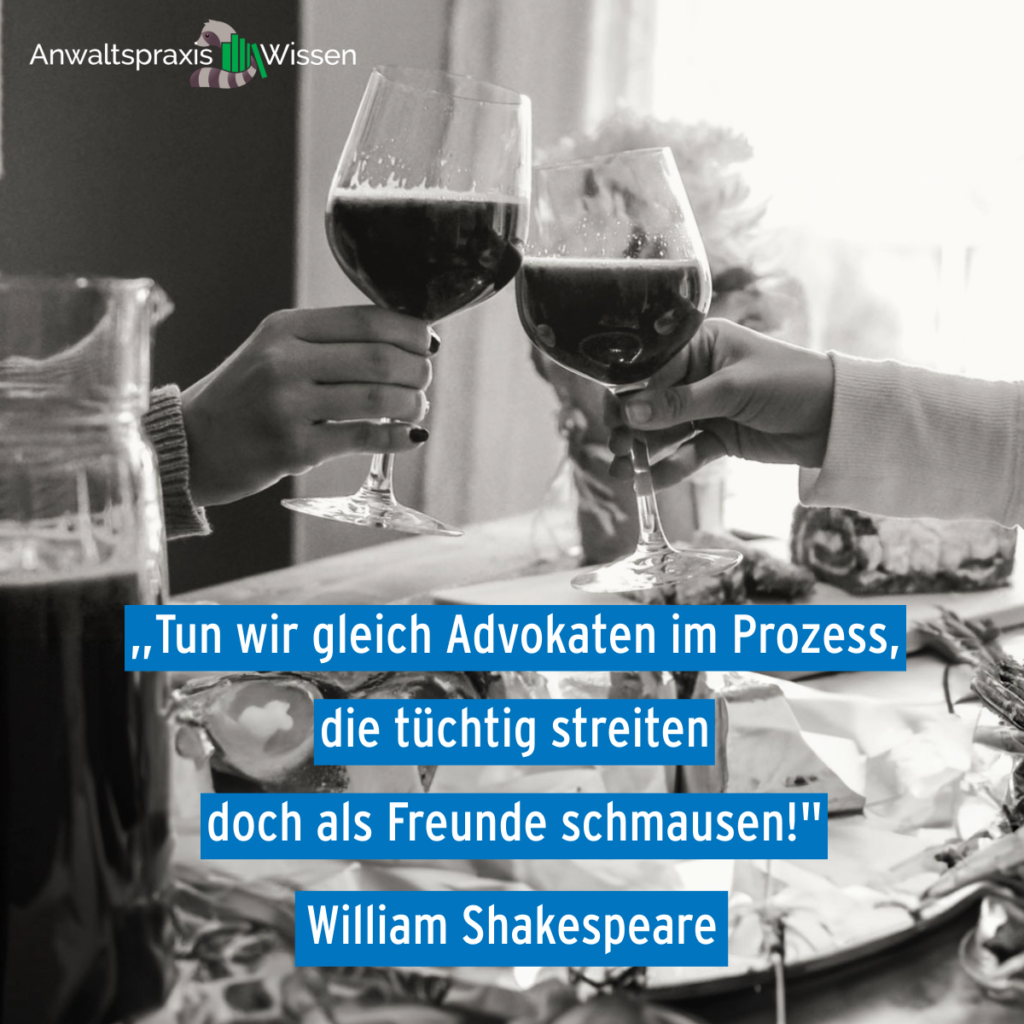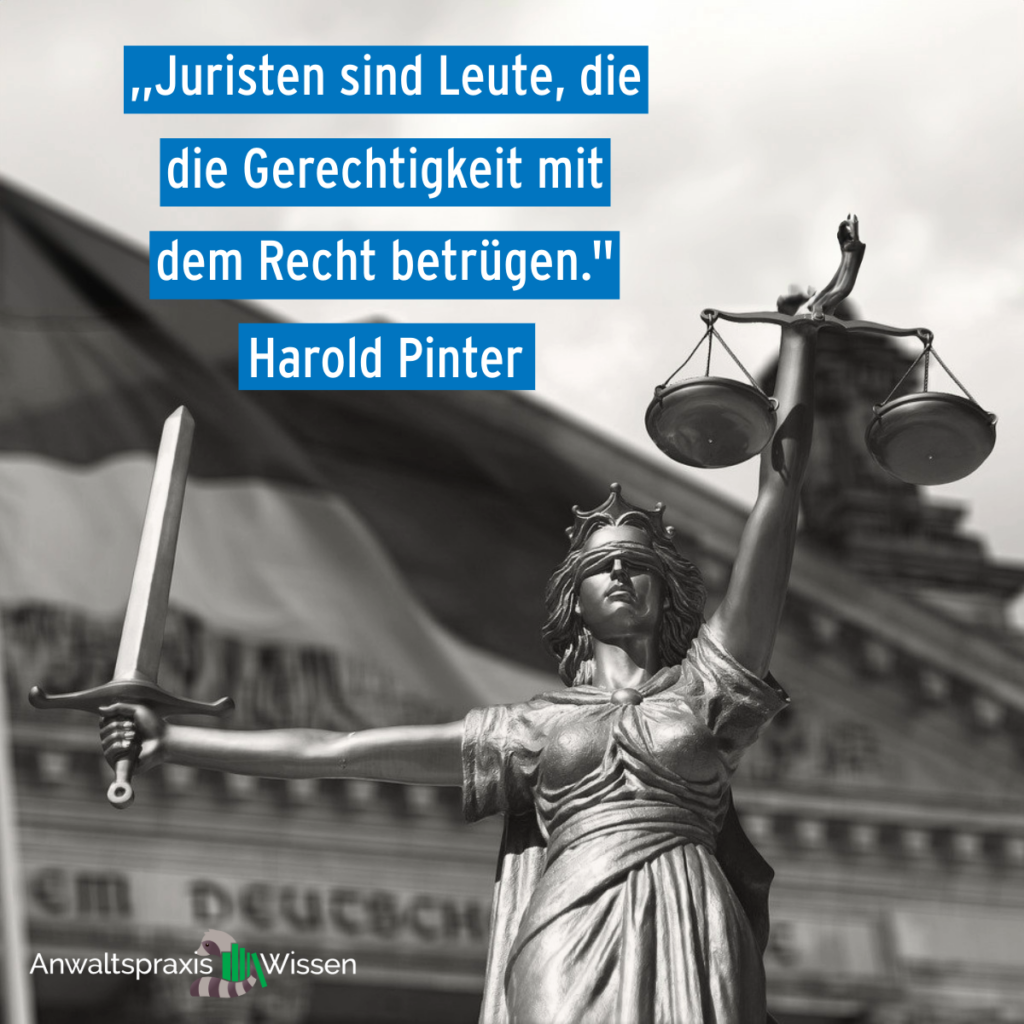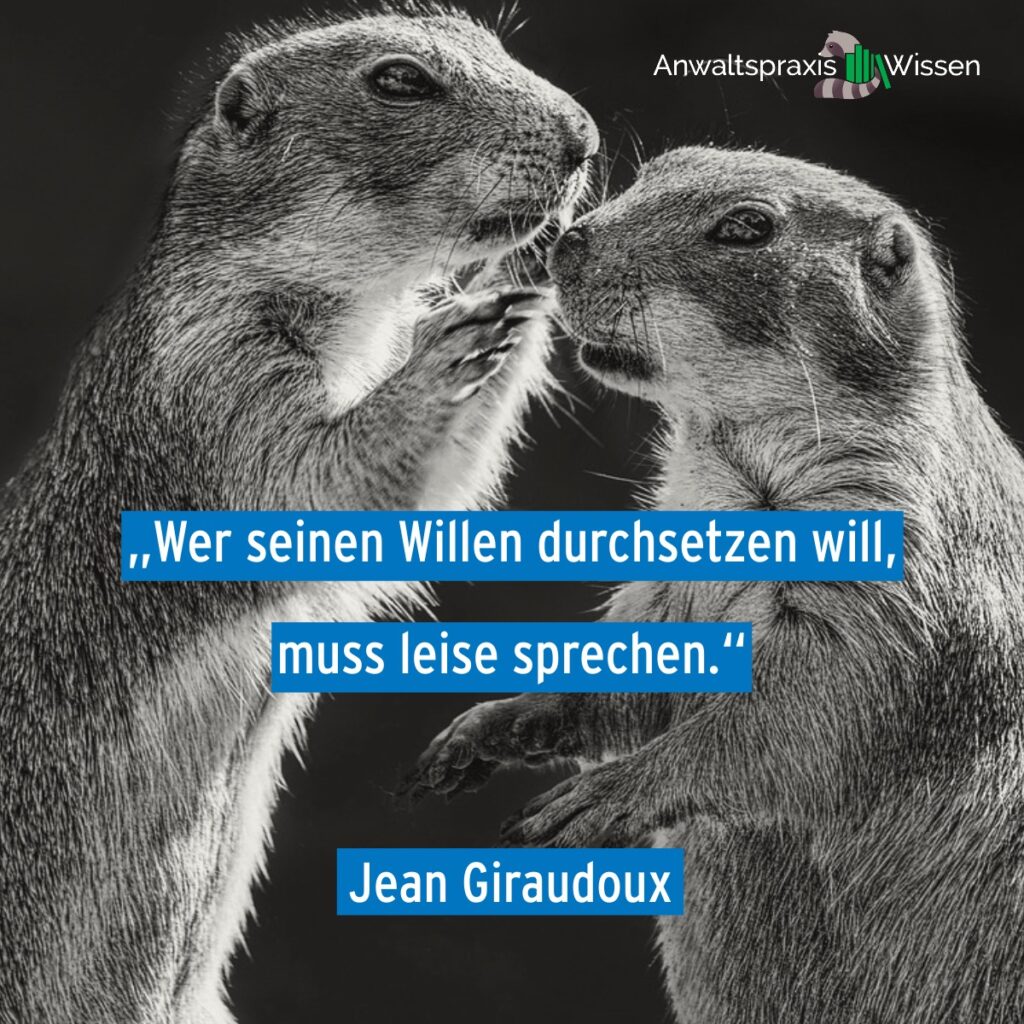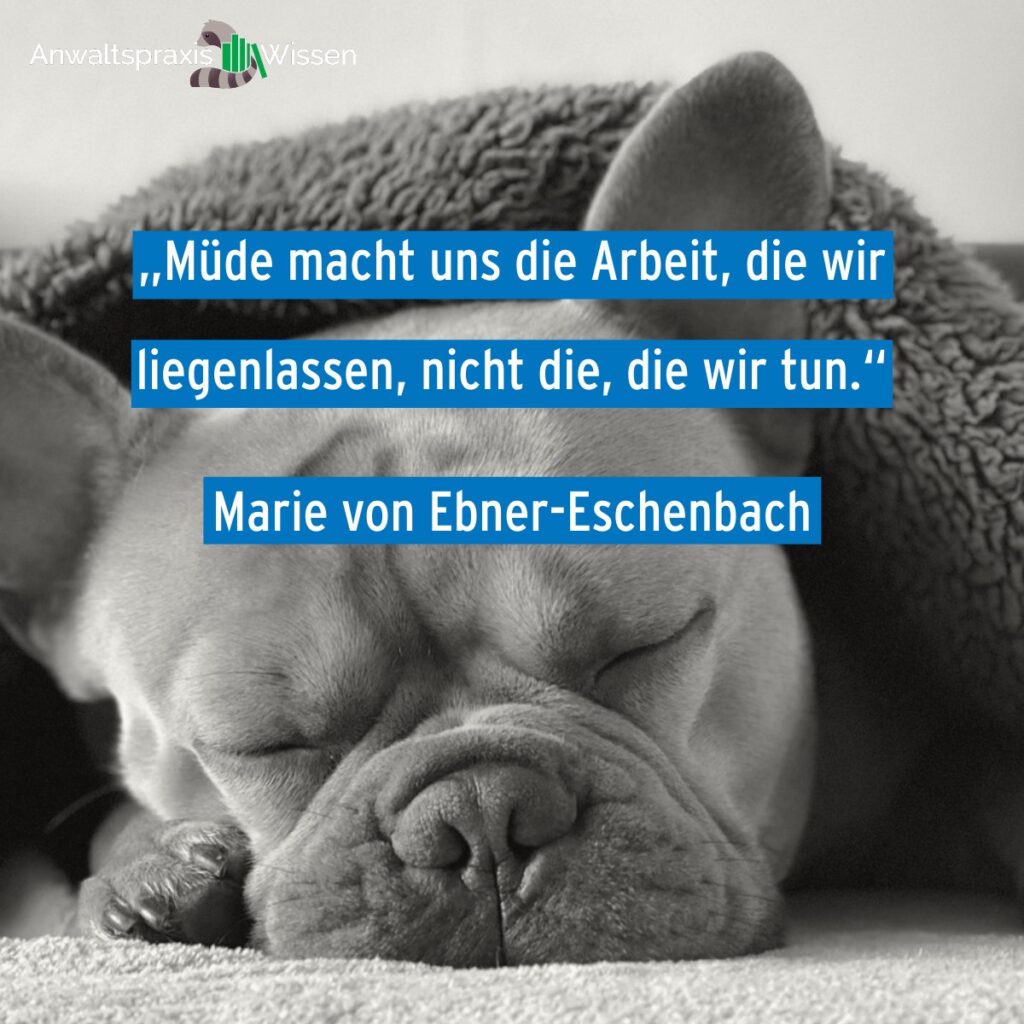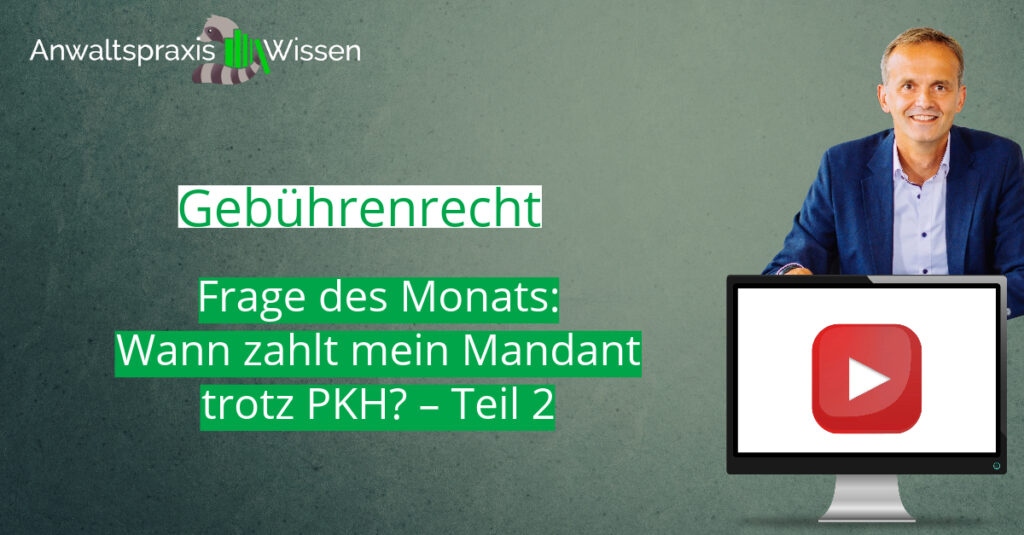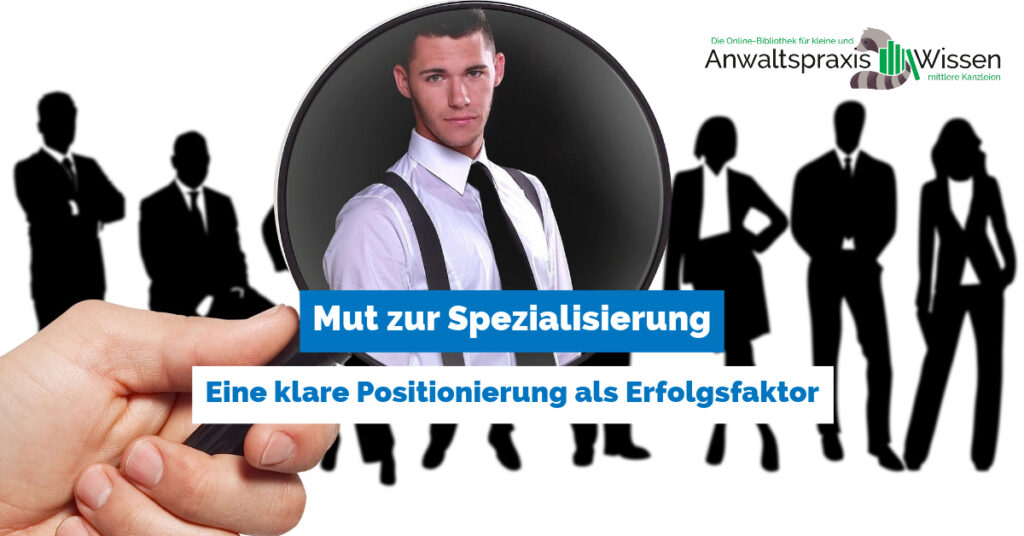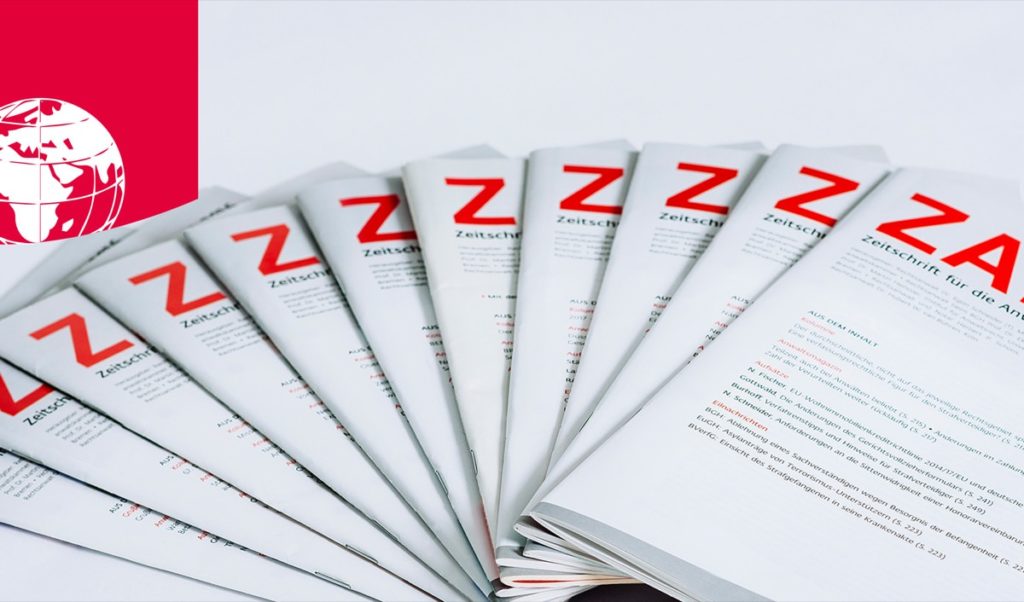1. Ein Geschädigter, der durch das deliktische Handeln eines Dritten (hier: Fahrzeughersteller) zum Abschluss eines Kaufvertrags (hier: über ein Dieselfahrzeug mit Prüfstanderkennungssoftware) bestimmt worden ist, kann, wenn er die Kaufsache behalten möchte, als Schaden von dem Dritten den Betrag ersetzt verlangen, um den er den Kaufgegenstand – gemessen an dem objektiven Wert von Leistung und Gegenleistung – zu teuer erworben hat (sog. kleiner Schadensersatz).
2. Für die Bemessung dieses kleinen Schadensersatzes ist grundsätzlich zunächst der Vergleich der Werte von Leistung (Fahrzeug) und Gegenleistung (Kaufpreis) im Zeitpunkt des Vertragsschlusses maßgeblich. Eine etwaige Aufwertung des Fahrzeugs durch eine nachträgliche Maßnahme (hier: Softwareupdate) des Schädigers, die gerade der Beseitigung der Prüfstanderkennungssoftware dienen sollte, ist im Rahmen der Vorteilsausgleichung zu berücksichtigen; dabei sind etwaige mit dem Softwareupdate verbundene Nachteile in die Bewertung des Vorteils einzubeziehen.
3. In den so zu bemessenden Schaden (Minderwert) sind Nachteile, die mit der Prüfstanderkennungssoftware oder dem Softwareupdate (Vorteilsausgleichung) verbunden sind, bereits „eingepreist“. Für eine Feststellung der Ersatzpflicht für diesbezügliche weitere Schäden ist daher kein Raum.
(Leitsätze des Gerichts)
BGH, Urt. v. 6.7.2021 – VI ZR 40/20
I. Sachverhalt
Die Klägerin hatte im Juli für 22.730 EUR einen von der beklagten VW-AG hergestellten, gebrauchten VW Passat Variant 2.0 TDI mit einer Laufleistung von 58.500 km erworben. Das im Februar 2012 Fahrzeug zugelassene Fahrzeug war mit einem Dieselmotor des Typs EA189 (EUR 5) ausgestattet. Die im Zusammenhang mit dem Motor ursprünglich verwendete Software erkannte, ob das Fahrzeug auf einem Prüfstand dem Neuen Europäischen Fahrzyklus (NEFZ) unterzogen wurde, und schaltete in diesem Fall vom regulären Abgasrückführungsmodus 0 in einen stickoxid(NOXX-Emissionswerte als im normalen Fahrbetrieb. Die Grenzwerte der Euro-5-Norm wurden nur im „Modus 1“ eingehalten.
Im Jahr 2015 ordnete das KBA gegenüber der Beklagten den Rückruf der mit dieser Software ausgestatteten Fahrzeuge an, weil es die Software als unzulässige Abschalteinrichtung einstufte. Die Beklagte entwickelte in der Folge ein Softwareupdate, das vom KFB freigegeben und auch im Fahrzeug der Klägerin installiert wurde.
Die Klägerin hat Klage auf Ersatz des Minderwerts, dessen Höhe in das Ermessen des Gerichts gestellt werde, der jedoch mindestens 5.682,50 EUR (25 % des Kaufpreises) betragen sollte. Das LG hat die Klage abgewiesen. Auf die Berufung der Klägerin hat das OLG in einem Grundurteil die Ansprüche auf Ersatz des Minderwerts und auf Freistellung von den vorgerichtlich entstandenen Rechtsanwaltskosten dem Grunde nach für gerechtfertigt erklärt. Die Berufung der Klägerin gegen die Abweisung ihres Feststellungsantrags hat es durch Endurteil zurückgewiesen. Dagegen sowohl die Revision der Klägerin als auch der Beklagten. Beide Rechtsmittel hatten keinen Erfolg.
II. Entscheidung
Die Beklagte sei, so der BGH, der Klägerin gegenüber dem Grunde nach zum Schadensersatz wegen vorsätzlicher sittenwidriger Schädigung verpflichtet (vgl. grundlegend BGH, Urt. v. 25.5.2020 – VRR 8/2020, 14). Die Klägerin könnte deshalb, wie sich aus der Rechtsprechung des BGH folge, Erstattung des Kaufpreises abzüglich der Nutzungsvorteile auf der Grundlage der gefahrenen Kilometer Zug um Zug gegen Übertragung des Fahrzeugs verlangen (sog. großer Schadensersatz). Die Klägerin könne aber stattdessen das Fahrzeug behalten und von der Beklagten den Betrag ersetzt verlangen, um den sie das Fahrzeug – gemessen an dem objektiven Wert von Leistung und Gegenleistung – zu teuer erworben habe (sog. kleiner Schadensersatz).
Für die Bemessung dieses kleinen Schadensersatzes sei zunächst der Vergleich der Werte von Leistung (Fahrzeug) und Gegenleistung (Kaufpreis) im Zeitpunkt des Vertragsschlusses maßgeblich. Sollte allerdings das Software-Update der Beklagten, das gerade der Beseitigung der unzulässigen Prüfstanderkennungssoftware diente, das Fahrzeug aufgewertet haben, sei dies im Rahmen der Vorteilsausgleichung zu berücksichtigen. Dabei seien in die Bewertung des Vorteils etwaige mit dem Software-Update verbundene Nachteile einzubeziehen. Ob und in welchem Umfang eine Differenz zwischen dem objektiven Wert des Fahrzeugs und dem Kaufpreis im Zeitpunkt des Kaufs bestanden habe und ob und inwieweit sich durch das Software-Update diese Wertdifferenz reduziert habe, werde im nunmehr folgenden Betragsverfahren festzustellen sein.
In den so zu bemessenden Schaden (Minderwert) seien aber Nachteile, die mit der Prüfstanderkennungssoftware oder dem Software-Update (als etwaiger Vorteil) verbunden sind, bereits „eingepreist“. Für die von der Klägerin gewünschte Feststellung der Ersatzpflicht der Beklagten für diesbezügliche weitere Schäden sei daher kein Raum.
III. Bedeutung für die Praxis
Eine weitere der doch recht vielen Entscheidungen des BGH zur Aufarbeitung des Dieselskandals. Der BGH hat also das Grundurteil des OLG Stuttgart gehalten. Das darf dann jetzt im Betragsverfahren den dem Beklagten zugesprochenen kleinen Schadensersatz berechnen. Man muss m.E. kein Hellseher sein, wenn man angesichts des Verhaltens der VW-AG in den Verfahren voraussagt, dass auch insoweit wahrscheinlich erst wieder der BGH das letzte Wort hat.
RA Detlef Burhoff, RiOLG a.D., Leer/Augsburg