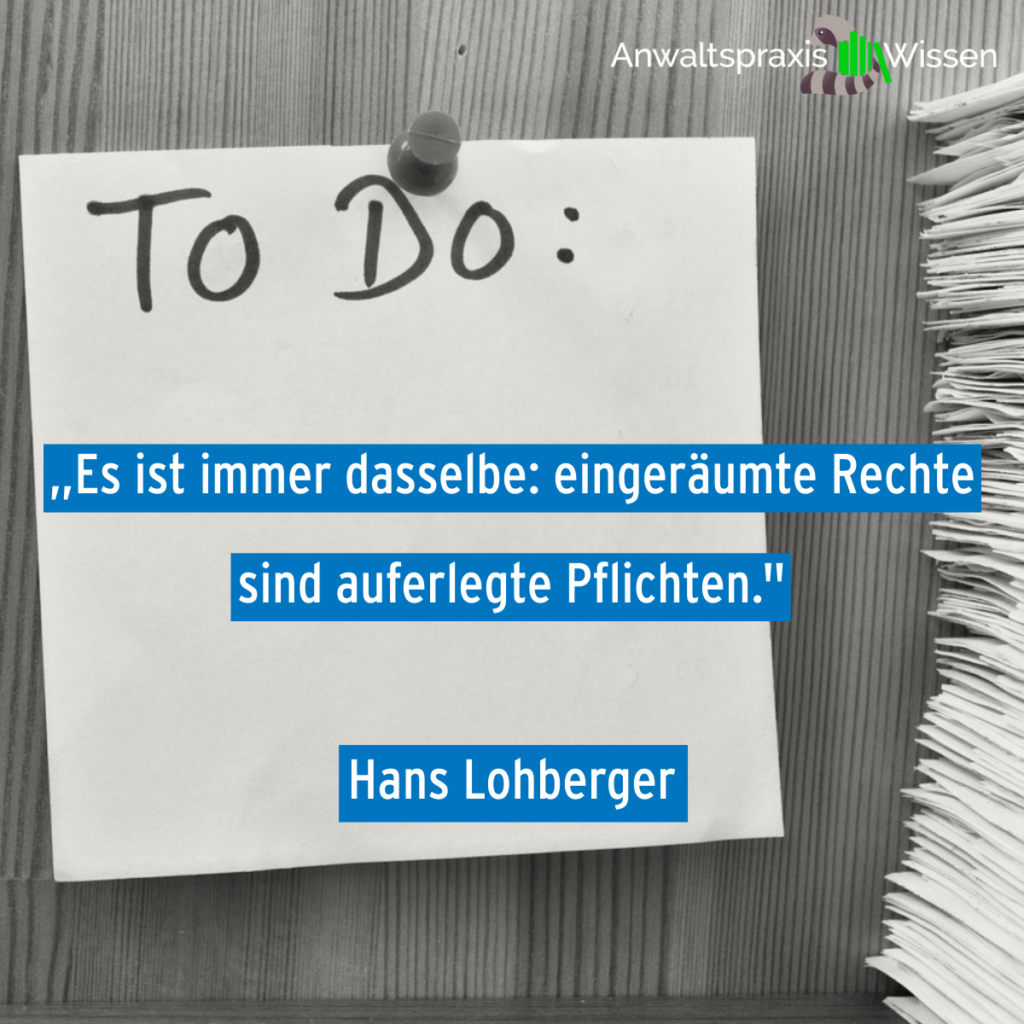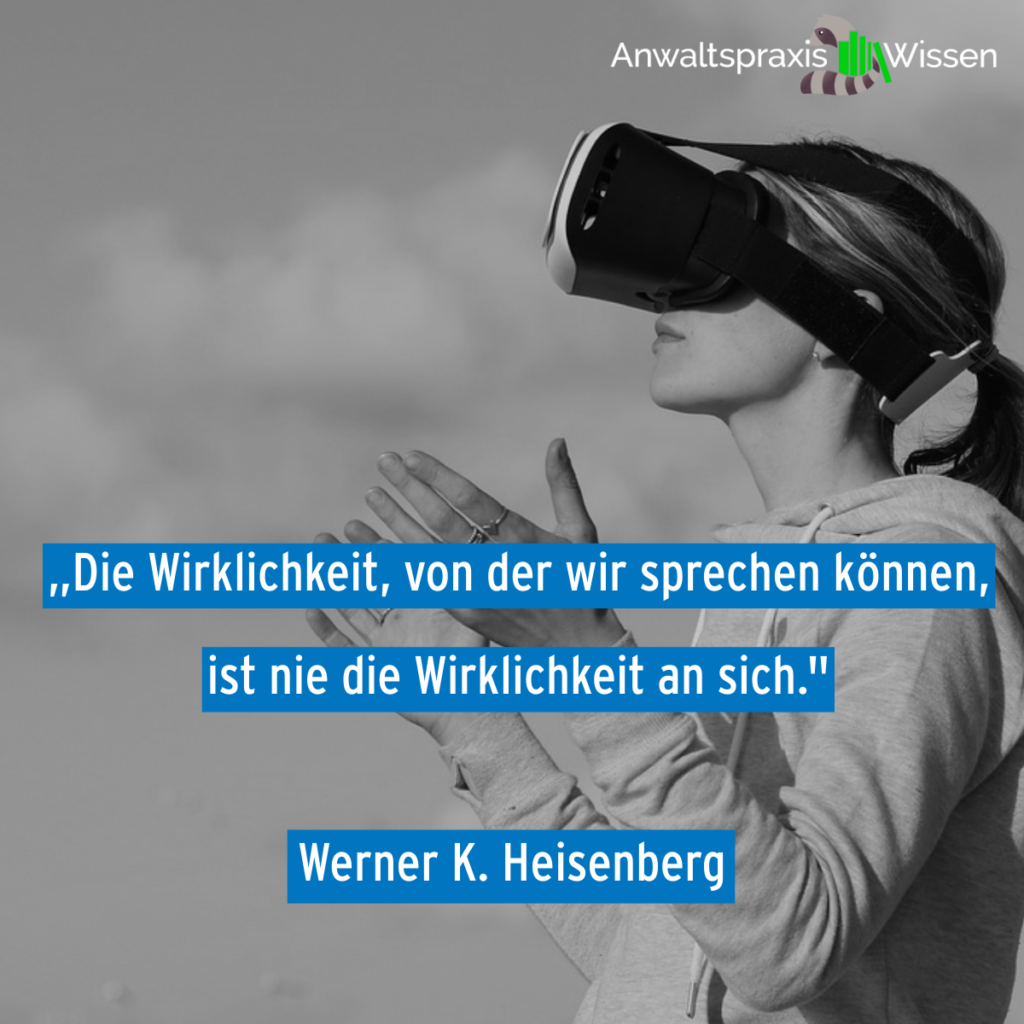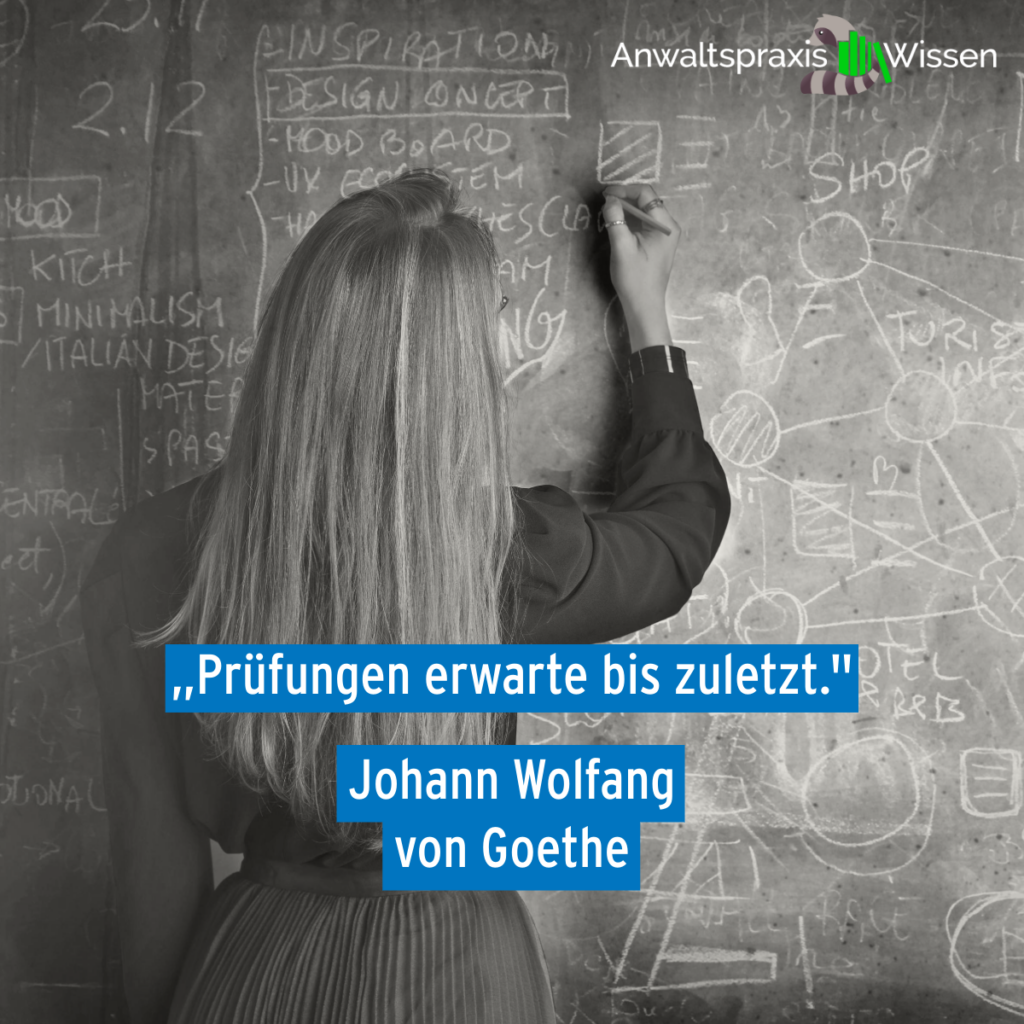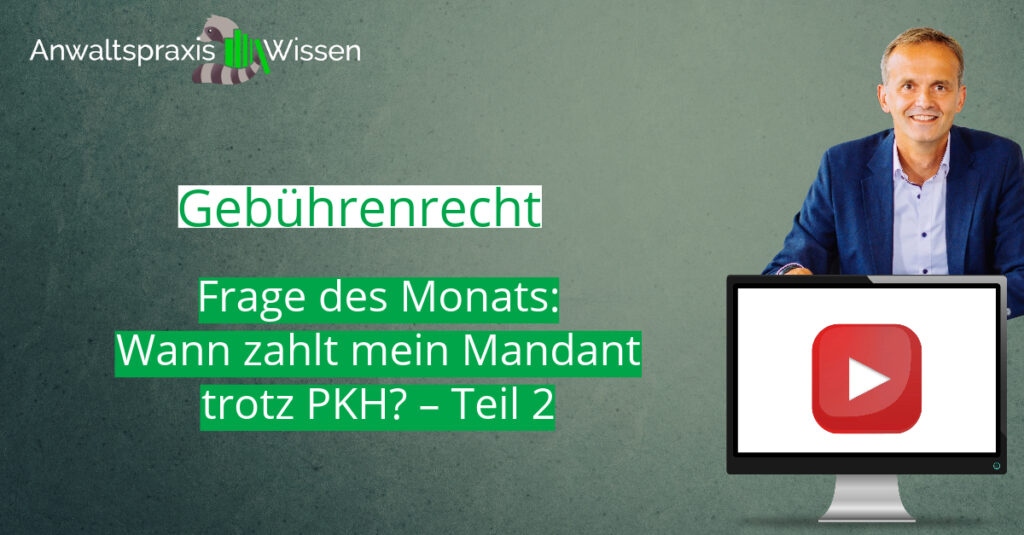Dieser Beitrag knüpft an die Übersicht in StRR 4/2021, 5 ff. an; berücksichtigt wurden Entscheidungen bis Dezember 2022.
Gefährliche Körperverletzung, § 224 StGB
1. Waffe bzw. gefährliches Werkzeug
Als gefährliches Werkzeug wird ein Gegenstand bezeichnet, der unter Berücksichtigung seiner objektiven Beschaffenheit und Art seiner Benutzung konkret geeignet ist, erhebliche körperliche Verletzungen herbeizuführen.
Hierbei kommt es maßgeblich auf den gefährlichen Gebrauch eines solchen Werkzeuges und nicht auf dessen objektive Beschaffenheit an (BGH NStZ 2015, 213 f., dort: Kissen). Ein „Weniger“ an gefährlicher Beschaffenheit kann nach h.M. durch ein „Mehr“ an gefährlicher Anwendungsweise ausgeglichen werden. Nach einer Entscheidung des KG (KG, Urt. v. 25.7.2022 – (3) 161 Ss 93/21 (34/22]) ist auch eine Jacke bei einer solchen Verwendung als gefährliches Werkzeug zu qualifizieren, denn nach den Urteilsausführungen war ihr Gebrauch (festes Drücken auf das Gesicht der Geschädigten) geeignet, erhebliche Verletzungen herbeizuführen (Atemnot und kurzfristiger Verlust des Bewusstseins).
Das OLG Karlsruhe hatte sich im Rahmen einer Beschwerde gegen einen Nichteröffnungsbeschluss mit der Frage zu befassen, inwiefern ärztliche Instrumente unter den Begriff des gefährlichen Werkzeugs fallen. Der angeklagte Zahnarzt hatte in mehreren Fällen Zähne extrahiert, obwohl hinreichend aussichtsreiche Behandlungsalternativen bestanden hatten. Im Vertrauen auf die Angaben des Zahnarztes hatten die Patienten der Extraktion zugestimmt. Das LG hatte eine Strafbarkeit wegen gefährlicher Körperverletzung verneint, weil das von einem zugelassenen Arzt oder Zahnarzt bei einem ärztlichen Eingriff bestimmungsgemäß verwendete ärztliche Instrument grundsätzlich weder eine Waffe noch ein gefährliches Werkzeug sei mit der Folge, dass der Arzt, wenn keine wirksame Einwilligung des Patienten in den Eingriff vorliege, nur wegen vorsätzlicher Körperverletzung gem. § 223 Abs. 1 StGB bestraft werden könne. In Instrumenten, die ein Arzt in Ausübung seines Berufes anwende, sehe die Rechtsprechung deshalb kein gefährliches Werkzeug, weil der Tathandlung in solchen Fällen der Angriffs- oder Verteidigungscharakter fehle. Das OLG weist darauf hin, dass die Einordnung eines gefährlichen Werkzeugs als Mittel der Tatbegehung im Verhältnis zur Waffe durch das 6. StrRG v. 26.1.1998 insoweit eine Änderung erfahren habe, als das gefährliche Werkzeug – anders als bei § 223a StGB a.F. – in der neuen Fassung des § 224 Abs. 1 Ziff. 2 StGB nicht mehr als Beispiel für eine Waffe, sondern eine Waffe nunmehr als Unterfall eines gefährlichen Werkzeugs zu verstehen sei (vgl. Fischer, StGB, 69. Aufl. 2022, § 224 Rn 9). Vielmehr ist auch bei ärztlichen Instrumenten wie der vorliegend vom Angeklagten verwendeten Instrumente zur Zahnextraktion danach zu fragen, ob der Gegenstand aufgrund seiner objektiven Beschaffenheit und der Verwendung im konkreten Fall dazu geeignet ist, dem Opfer erhebliche Verletzungen beizubringen. Dies sei angesichts des unwiederbringlichen Zahnverlusts, der mit offenen Wunden und länger andauernden Schmerzen einhergehe, ohne weiteres zu bejahen. Keine Rolle bei der Einordnung der vom Angeklagten verwendeten Instrumente als gefährliche Werkzeuge i.S.v. § 224 Abs. 1 Ziff. 2 StGB spiele der Umstand, dass der Angeklagte als (damals) approbierter Zahnarzt zu deren regelgerechter Anwendung grundsätzlich in der Lage war und sie auch regelgerecht angewandt hat (OLG Karlsruhe StRR 6/2022, 29 = NStZ 2022, 687 f. = MedR 2022, 752f.)
§ 224 Abs. 1 Nr. 2 StGB erfordert nach ständiger Rechtsprechung, dass die Körperverletzung durch ein von außen unmittelbar auf den Körper einwirkendes gefährliches Tatmittel eingetreten ist. Wird ein Kraftfahrzeug als Werkzeug eingesetzt, muss die körperliche Misshandlung also bereits durch den Anstoß oder den unmittelbaren Kontakt mit dem Kraftfahrzeug selbst ausgelöst sein. Verletzungen, die erst durch ein anschließendes Sturzgeschehen verursacht worden sind, genügen insoweit nicht (BGH NStZ 2022, 49; vgl. auch BGH, Beschl. v. 14.7.2020 – 4 StR 194/20).
Zur Verwendung einer mit Flüssigkeit ganz oder teilweise gefüllten Kunststoffflasche als Schlagwerkzeug äußerte sich das OLG Koblenz (Urt. v. 7.12.2021 – 4 OLG 32 Ss 179/21). Eine solche könne als gefährliches Werkzeug in Betracht kommen, was davon abhänge, wie die Flasche konkret eingesetzt werde, aus welchem Material sie bestehe (harter oder weicher Kunststoff), ob sie geöffnet oder noch verschlossen sei und wie sich im Falle des Geöffnetseins der Befüllungsgrad darstelle.
Hier habe der Tatrichter festgestellt, dass die Ein-Liter-Ölflasche aus Kunststoff zwar geöffnet, aber noch mit Öl gefüllt war. Die Kammer habe zwar keine ausdrücklichen Feststellungen hinsichtlich ihres Befüllungsstandes getroffen, doch lasse sich aus der Feststellung, dass der Angeklagte erst begonnen hatte, Öl nachzufüllen, und dass dieses herausspritzte, als er mit der Flasche zuschlug, noch ohne weiteres herleiten, dass sich jedenfalls noch eine nicht unerhebliche Menge Öl in der Flasche befand. Durch eine (Teil-)Befüllung erhalte auch eine aus weichem Kunststoff bestehende Flasche eine hohe Stabilität und Festigkeit, was mit ihr geführten Schlägen eine besondere Wucht und Schlagkraft verleihe. Mit diesem Gegenstand habe der Angeklagte zweimal fest ins Gesicht geschlagen. Dass der Geschädigte tatsächlich nur ein Hämatom und einen „blutenden Kratzer“ davongetragen habe, stehe dem nicht entgegen, da sich die potenziell verwirklichte Gefahr gerade nicht in einer erheblichen Verletzung realisiert haben müsse.
2. Lebensgefährdende Behandlung
In einer knapp begründeten Entscheidung aus dem Januar 2022 hat der BGH den erforderlichen Umfang für tatrichterliche Feststellungen hinsichtlich der Gefährlichkeit von Würgen am Hals ausgeführt. Zwar könne festes Würgen geeignet sein, eine Lebensgefährdung herbeizuführen, doch reiche insoweit nicht jeder Griff aus, ebenso wenig bloße Atemnot. Von maßgeblicher Bedeutung seien insoweit Dauer und Stärke der Einwirkung, die abstrakt geeignet sein muss, das Leben des Opfers zu gefährden. Solche Umstände, wie etwa das Abschnüren der Halsschlagader, der Bruch des Kehlkopfknorpels oder massive Würgemale, hatte das LG im entschiedenen Fall nicht festgestellt (BGH NStZ-RR 2022, 205).
Im Rahmen einer Haftbeschwerde hat sich das OLG Hamm mit einem Verfahren befasst, bei dem der Beschuldigte einem deutlich alkoholisierten Geschädigten einen einzelnen Schlag auf den Hinterkopf versetzte, wodurch dieser über die Bahnsteigkante fiel und ins Gleisbett stürzte.
Der Schlag gegen den Hinterkopf des ohnehin schon in Richtung der Bahnsteigkante taumelnden Geschädigten, durch den diese Bewegung noch weiter gefördert wurde, stelle eine abstrakt lebensgefährdende Behandlung dar. Schläge gegen den Kopf fielen jedenfalls dann unter § 224 Abs. 1 Nr. 5 StGB, wenn im Einzelfall aufgrund ihrer Ausführung, der Konstitution des Tatopfers oder anderer Umstände das Gefahrenpotential gegenüber einer einfachen Körperverletzung deutlich erhöht sei. Die Körperverletzung sei auch „mittels“ einer lebensgefährdenden Behandlung ausgeführt worden. Erforderlich sei, dass die Art der Behandlung durch den Täter nach den Umständen des Einzelfalls (generell) geeignet sei, das Leben zu gefährden (vgl. BGH NStZ 2007, 34 f.). Die Behandlung, also der Faustschlag gegen den Hinterkopf, ist für sich genommen lebensgefährdend, denn er führte dazu, dass der Geschädigte zu Boden ging, und zwar über eine Bahnsteigkante hinweg auf das Gleisbett. Da dieses tiefer liegt, berge das schlagbedingte Zubodengehen dort schon eine erhöhte, lebensgefährdende Gefahr (OLG Hamm, Beschl. v. 7.7.2022 – 5 Ws 173/22).
Misshandlung von Schutzbefohlenen, § 225 StGB
1. Rohes Misshandeln
In einem vom 6. Strafsenat des BGH entschiedenen Fall hatte die Angeklagte ihren beiden Kindern über mehrere Jahre verteilt Verletzungen zugefügt, zuletzt hatte sie ihrem damals sieben Jahre alten Sohn Nahrung verweigert, obwohl dieser über Hunger klagte und in der Folge so stark abmagerte, dass er stationär behandelt werden musste. Dennoch sah der BGH die Tatbestandsalternative des rohen Misshandelns als nicht erfüllt an. Nach ständiger Rechtsprechung liege ein solches vor, wenn der Täter einem anderen eine Körperverletzung aus gefühlloser Gesinnung zufüge, die sich in erheblichen Handlungsfolgen äußere. Eine gefühllose Gesinnung sei gegeben, wenn der Täter bei der Misshandlung das – notwendig als Hemmung wirkende – Gefühl für das Leiden des Misshandelten verloren habe, das sich bei jedem menschlich und verständlich Denkenden eingestellt hätte. Den Gründen sei zu entnehmen, dass sich die anfänglich liebevolle Beziehung der Angeklagten zu ihren Kindern mit deren zunehmender Selbstständigkeit veränderte. Es sei zu den Tathandlungen gekommen, weil der Angeklagten „irgendetwas an dem Verhalten ihres Sohnes nicht passte“ oder sie sich „über ein nicht mehr feststellbares Verhalten ärgerte“. Diese Ausführungen belegten eine gefühllose Gesinnung nicht, zumal die Strafkammer festgestellt habe, dass die Angeklagte mit der Erziehung ihrer Kinder überfordert gewesen sei (BGH NStZ-RR 2022, 13 f.).
2. Konkurrenzen zwischen Tatbestandsalternativen des § 225 Abs. 1 StGB
Der 3. Strafsenat des BGH (Beschl. v. 28.6.2022 – 3 StR 142/22) hat sich mit dem Konkurrenzverhältnis zwischen rohem Misshandeln und Quälen befasst. Der Angeklagte hatte seine beiden Kinder über einen Zeitraum von ca. sechs Wochen massiv misshandelt und war vom LG u.a. wegen Misshandelns von Schutzbefohlenen in acht Fällen verurteilt worden. Nach Auffassung des BGH stellen die Taten zum Nachteil des jeweiligen Kindes jeweils nur eine Tat nach § 225 StGB dar. Das Quälen und das rohe Misshandeln einer Person nach § 225 Abs. 1 StGB sind selbstständige Begehungsformen der Misshandlung Schutzbefohlener. Quälen im Sinne dieser Vorschrift bedeutet das Verursachen länger dauernder oder sich wiederholender (erheblicher) Schmerzen oder Leiden körperlicher oder seelischer Art. Mehrere Körperverletzungshandlungen, die für sich genommen noch nicht den Tatbestand des § 225 Abs. 1 StGB erfüllen, können als ein Quälen zu beurteilen sein, wenn die ständige Wiederholung den gegenüber § 223 StGB gesteigerten Unrechtsgehalt ausmacht.
Rohes Misshandeln i.S.d. § 225 Abs. 1 StGB liegt dagegen vor, wenn der Täter einem anderen eine Körperverletzung aus gefühlloser Gesinnung zufügt, die sich in erheblichen Handlungsfolgen äußert. Anders als das Quälen bezieht sich diese Tatvariante des § 225 Abs. 1 StGB auf ein einzelnes Körperverletzungsgeschehen. Wenngleich mehrere Einzelhandlungen – insbesondere bei deutlichen zeitlichen Zäsuren und ganz erheblichen Körperverletzungen – nicht generell im Rahmen einer tatbestandlichen Handlungseinheit als eine Tat des Quälens zusammenzufassen sind, kann in Bezug auf dasselbe Opfer bei einer äußeren und inneren Geschlossenheit des Tatgeschehens eine Bewertung als lediglich eine Tat naheliegen.
Angesichts der danach bestehenden tatbestandlichen Handlungseinheit wird das bei einzelnen Handlungen neben dem Quälen zugleich verwirklichte Tatbestandsmerkmal des rohen Misshandelns (§ 225 Abs. 1 Variante 2 StGB) wegen der Überschneidungen in Bezug auf das jeweils geschädigte Kind ebenfalls zu einer einzigen Tat verbunden.
Schwere Körperverletzung, § 226 StGB
Mit dem antiquiert anmutenden Begriff des „Siechtums“ beschäftigte sich der 5. Strafsenat. Der Angeklagte hatte eine 74 Jahre alte Bekannte in deren Wohnung überfallen und gefesselt. Beim ruckartigen Hochreißen brach sich die Geschädigte, die unter Osteoporose leidet, wie der Angeklagte auch wusste, einen Brustwirbel. Der Bruch führte zu andauernden starken Schmerzen sowie Mobilitätseinschränkungen. Da sie anschließend nicht mehr allein in ihrer Wohnung leben konnte, musste sie in einem Pflegeheim untergebracht werden.
Der BGH sah angesichts dieser festgestellten Tatfolgen das Merkmal des § 226 Abs. 1 Nr. 3 StGB erfüllt an. Siechtum bezeichnet einen chronischen Krankheitszustand, der den Gesamtorganismus in Mitleidenschaft zieht, ein Schwinden der körperlichen und geistigen Kräfte sowie allgemeine Hinfälligkeit zur Folge hat und dessen Heilung ausgeschlossen oder nicht absehbar ist. Hier zeige sich als Symptom ihrer allgemeinen Hinfälligkeit und physischen Entkräftung, die durch den Wirbelbruch ausgelöst wurde, dass die Geschädigte nicht mehr alleine wohnen könne und in ein Pflegeheim umziehen musste. Wegen anhaltender Schmerzen und Angstzuständen als psychische Tatfolgen habe sie bis heute nachts kaum Schlaf gefunden. Sie sei nicht mehr in der Lage, ohne fremde Hilfe aufzustehen und alleine zu duschen oder zur Toilette zu gehen. Eine Besserung ihres Krankheitszustands sei jedenfalls nicht absehbar, nachdem ihre behandelnden Ärzte von einer Operation des Wirbelbruchs abgeraten hätten (BGH NStZ-RR 2021, 209 f.).
In Abgrenzung zu zwei Entscheidungen aus den 1960er Jahren äußerte der 3. Strafsenat die Ansicht, dass die vollendete gefährliche Körperverletzung gem. § 224 Abs. 1 Nr. 2 StGB nicht von der vollendeten schweren Körperverletzung im Wege der Gesetzeskonkurrenz verdrängt würde, sondern dass auch insoweit – entsprechend dem Verhältnis von § 224 Abs. 1 Nr. 4 u. 5 zu § 226 StGB Abs. 1 StGB – Tateinheit bestehe. Denn die Annahme von Gesetzeseinheit dürfte das spezifische Tatunrecht, das mit dem wissentlichen und willentlichen Einsatz einer Waffe oder eines anderen gefährlichen Werkzeugs verbunden ist, nicht angemessen zum Ausdruck bringen. § 224 Abs. 1 Nr. 2 StGB erfasst als ein die Körperverletzung qualifizierendes konkretes Gefährdungsdelikt die Gefährlichkeit der Verwendung eines solchen Gegenstands im Einzelfall. Da die schwere Folge i.S.d. § 226 Abs. 1 StGB nicht zwingend mit einem solchen Tatmittel verursacht worden sein muss, trägt die Verurteilung wegen tateinheitlich begangener gefährlicher Körperverletzung der Klarstellungsfunktion des Schuldspruchs Rechnung.
Im entschiedenen Fall hatte diese wegen der Verurteilung wegen anderer Tatbestandsalternativen des § 224 StGB keine Auswirkungen. Das Hinzutreten weiterer Tatbestandsvarianten eines ohnehin abgeurteilten Delikts betreffe den Schuldumfang und daher den Strafausspruch, dessen Rechtsfehlerhaftigkeit sei auf die Revision (allein) der Nebenklage aber vom Revisionsgericht nicht zu prüfen (BGH NStZ-RR 2021, 13 = StV 2022, 157 f.).
Körperverletzung mit Todesfolge, § 227 StGB
Die beiden Angeklagten und weitere Beteiligte wollten den später Getöteten wegen einer vorangegangenen Körperverletzung zur Rede stellen, ein „Blutgeld“ fordern und ihn ggf. handgreiflich für sein Verhalten bestrafen. Nachdem die Gruppe der beiden Angeklagten den Geschädigten zunächst mit einem „rundlichen Gegenstand“ angegriffen hatte, zog ein unbekannt gebliebener Täter ein Messer und fügte dem Opfer 20 Stiche zu, an denen dieses verstarb. Nach Ansicht des BGH (NStZ 2021, 735 f.) trugen die Feststellungen die Annahme des LG, der durch die Messerstiche eingetretene Tod des Opfers sei den Angeklagten als fahrlässig herbeigeführte Folge der gemeinschaftlich begangenen Körperverletzung im Sinne der Erfolgsqualifikation des § 227 Abs. 1 StGB zuzurechnen, nicht. Bei einer gemeinschaftlich begangenen Körperverletzung setze die Strafbarkeit eines Mittäters wegen Körperverletzung mit Todesfolge nicht voraus, dass er selbst eine unmittelbar zum Tod des Opfers führende Verletzungshandlung ausführe. Es reiche vielmehr aus, dass der Mittäter aufgrund eines gemeinsamen Tatentschlusses mit dem Willen zur Tatherrschaft einen Beitrag zum Verletzungsgeschehen geleistet habe. Dabei sei im Grundsatz weiter erforderlich, dass die Handlung des anderen im Rahmen des gegenseitigen ausdrücklichen oder stillschweigenden Einverständnisses liegt und dem Täter hinsichtlich des Erfolgs Fahrlässigkeit zur Last falle.
Sei der Todeserfolg durch einen als Exzesshandlung zu qualifizierenden Gewaltakt verursacht worden, komme eine Zurechnung des Todes als qualifizierender Erfolg gemäß § 227 StGB in Betracht, wenn den gemeinschaftlich verübten Gewalthandlungen, die der todesursächlichen Exzesshandlung vorausgegangen sind, bereits die spezifische Gefahr eines tödlichen Ausgangs anhafte. Dies sei etwa in Fällen bejaht worden, in welchen das Opfer durch die mittäterschaftlich begangene Körperverletzung in eine Lage geraten sei, in der es nachfolgenden Einwirkungen eines gewaltbereiten Tatbeteiligten schutzlos ausgeliefert gewesen sei (vgl. BGH NStZ 2007, 76) oder in denen dem vom gemeinsamen Willen aller Mittäter getragenen Angriff nach den ihn kennzeichnenden konkreten tatsächlichen Gegebenheiten die naheliegende Möglichkeit einer tödlichen Eskalation innewohnte (BGH NStZ 2016, 400).
Da das LG festgestellt hatte, dass der überraschend erfolgte Einsatz des Messers von dem zuvor gemeinsam gefassten Tatentschluss, das Tatopfer körperlich zu bestrafen, nicht umfasst war und damit über das gemeinsame Wollen der übrigen Angreifer, die von dem Mitführen des Messers keine Kenntnis hatten, hinausging und nicht jedem von mehreren mit einem Schlagwerkzeug geführten tätlichen Angriff auf einen anderen per se die tatbestandsspezifische Gefahr eines in seiner Gefährlichkeit für das Leben des Opfers gesteigerten Messereinsatzes innewohne, hob der BGH das Urteil auf (NStZ 2021, 735 f.).
Einwilligung gem. § 228 StGB
Der Angeklagte und der Geschädigte hatten sich wegen länger andauernder Rivalitäten zwischen Teilanstalten einer JVA konkludent dazu verabredet, sich beim nächsten Aufeinandertreffen zu schlagen. Im Zuge der Schlägerei erlitt der Geschädigte einen Gefäßabriss im Gehirn und verstarb. Der BGH hob das Urteil des LG wegen Körperverletzung mit Todesfolge auf. Das Grunddelikt der Körperverletzung sei durch Einwilligung gem. § 228 StGB gerechtfertigt gewesen und die Todesfolge – jedenfalls nicht ausschließbar – bereits zu diesem Zeitpunkt verursacht worden (BGH NStZ 2022, 201).
Die Kontrahenten waren stillschweigend davon ausgegangen, dass es bei ihrer Auseinandersetzung zu gegenseitigen Schlägen, insbesondere auch Faustschlägen in das Gesicht, gegen den Kopf und den Körper mit entsprechenden Verletzungen kommen würde. Der Geschädigte hatte stillschweigend und wirksam in solche Körperverletzungshandlungen eingewilligt. Jeder Rechtsgutträger – seine Einwilligungsfähigkeit vorausgesetzt – kann in diesem Umfang über das Rechtsgut seiner körperlichen Unversehrtheit disponieren, dies gilt auch für in einer Justizvollzugsanstalt einsitzende Strafgefangene.
Einen Verstoß gegen die guten Sitten i.S.v. § 228 StGB vermochte der BGH nicht zu erkennen. Die Unvereinbarkeit einer Körperverletzung mit den „guten Sitten“ trotz der Einwilligung des betroffenen Rechtsgutsinhabers hänge von der ex ante zu bestimmenden Art und Schwere des Rechtsgutsangriffs unter Berücksichtigung von Art und Gewicht des eingetretenen Körperverletzungserfolgs sowie des damit einhergehenden Gefahrengrads für Leib und Leben des Opfers ab (vgl. BGH NStZ 2021, 494 ff.). Findet die Tat unter Bedingungen statt, die den Grad der aus ihr hervorgehenden Gefährlichkeit für die körperliche Unversehrtheit oder das Leben des Verletzten begrenzen, ist die Körperverletzung durch die erklärte Einwilligung gerechtfertigt, wenn das Vereinbarte in ausreichend sicherer Weise für die Verhütung gravierender, sogar mit der Gefahr des Todes einhergehender Körperverletzungen Sorge tragen kann; insoweit ist auch die Eskalationsgefahr zu berücksichtigen, die sich aus der Unkontrollierbarkeit gruppendynamischer Prozesse ergibt. Hieran gemessen war die Tat nicht sittenwidrig.
Die Anwesenheit von weiteren Strafgefangenen der Häuser, in denen die Kontrahenten jeweils untergebracht waren, führe nicht zu einem anderen Ergebnis, weil deren Eingreifen nicht verabredet gewesen sei. Ein solches wäre zwar bei einem Kampf innerhalb einer Justizvollzugsanstalt ein naheliegendes Verhalten (Eskalationsgefahr). Dieser Aspekt dürfe jedoch nicht isoliert betrachtet werden, denn die Anwesenheit zahlreicher weiterer Personen innerhalb des geschützten und durch Wachpersonal kontrollierten Bereichs einer Haftanstalt berge auch die Möglichkeit eines deeskalierenden Eingreifens. Zudem sei eine sofortige Hilfe durch Ersthelfer und eine schnelle Verständigung des Rettungsdienstes gewährleistet. Dass eine körperliche Auseinandersetzung in einer Justizvollzugsanstalt unerwünscht sei und disziplinarisch geahndet werde, sei lediglich eine Folge des Kampfes und mache die Tat als solche nicht sittenwidrig.
Fahrlässige Körperverletzung, § 229 StGB
Die im Zusammenhang mit § 229 StGB ergangene Rechtsprechung befasst sich zum Großteil mit zivilrechtlichen Fragen, lesenswert ist aber eine Entscheidung zu dem Klassiker des HWS-Syndroms bzw. „Schleudertraumas“.
Das AG Reutlingen hat mit einem Beschluss den Erlass eines Strafbefehls mangels hinreichenden Tatverdachts abgelehnt (AG Reutlingen, Beschl. v. 7.10.2022 – 5 Cs 29 Js 20198/22). Zur Begründung führte das AG aus, die Beschwerden des Zeugen seien nicht ausreichend sicher auf das Unfallgeschehen zurückzuführen. Der Zeuge sei zu den Folgen nicht vernommen worden, das ärztliche Attest sei oberflächlich und teile lediglich eine Erstdiagnose mit, die im Rahmen der Prüfung der Arbeitsunfähigkeit erfolgt sei und zudem nicht von einem Facharzt für Neurologie stamme. Die bei der Akte befindlichen Lichtbilder ließen nicht ansatzweise auf eine besonders heftige biomechanische Belastung schließen, der Unfallhergang sei insgesamt unklar.
Ein „Beweis des ersten Anscheins“, der sich im Strafverfahren spätestens mit dem Abschluss der Ermittlungen geradezu verbiete, spreche gerade nicht für solche Verletzungen, da die medizinische Beurteilung derartiger Unfälle und die dabei entstehenden biomechanischen Belastungen in der wissenschaftlichen Literatur stark umstritten seien. Allein der von dem Zeugen angegebene zeitliche Zusammenhang lasse einen Rückschluss nicht zu, zumal Rückenleiden in sehr komplexen und vielfältigen Erscheinungsformen aufträten. Es bestehe zudem die ernsthafte Möglichkeit, dass sich die Beschwerden schicksalhaft entwickelt haben oder bereits vorhanden waren. Deswegen reiche allein die zeitliche Nähe zwischen dem Unfallereignis und der Entstehung der Beschwerden und die daran anknüpfende „gefühlsmäßige“ Wertung, dass beide Ereignisse irgendwie miteinander im Zusammenhang stehen, nicht aus. Zugunsten des Angeschuldigten könne nicht ausgeschlossen werden, dass der Unfall und die in der Bevölkerung allgemein verbreitete Fehlvorstellung über die gesundheitlichen Folgen eines Auffahrunfalls („Schleudertrauma“) zu einer intensiveren Beschäftigung des Zeugen mit vorhandenen Grundbeschwerden oder Befindlichkeiten ohne Krankheitscharakter führten.
Die ärztlichen Atteste dokumentierten lediglich die Angaben des Zeugen für eine Diagnose als Behandlungsgrundlage. Der behandelnde Arzt sei in erster Linie als Therapeut und nicht als Gutachter tätig. Er unterstelle zu Recht die geklagten Beschwerden seines Patienten als zutreffend und therapiere auf Grundlage der subjektiven Angaben. Er wird bei einer Diagnose regelmäßig den „sichersten Weg“ wählen und schon aus haftungsrechtlichen Gründen im Zweifel eine Verdachtsdiagnose stellen und zum Beispiel eine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung ausstellen oder eine Cervikalstütze verordnen.