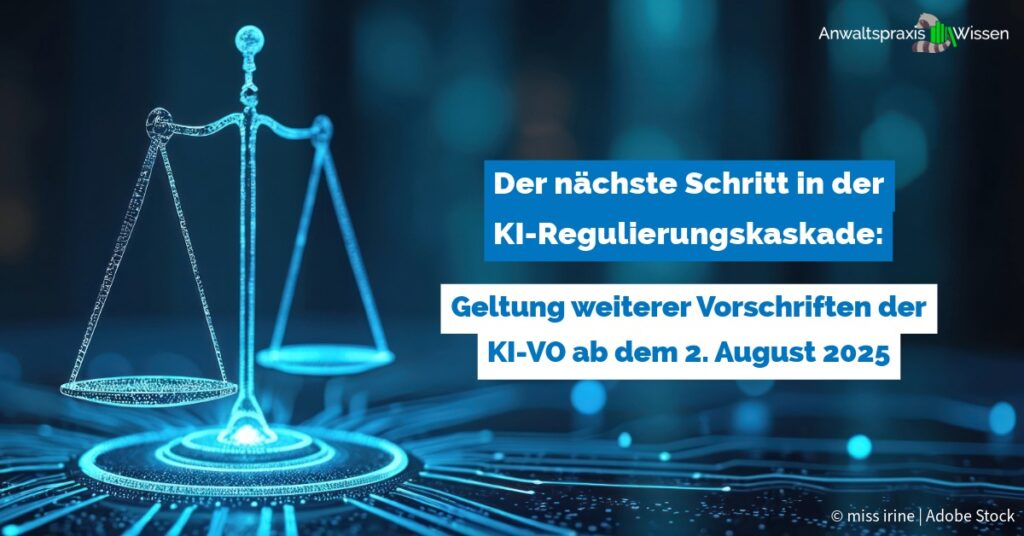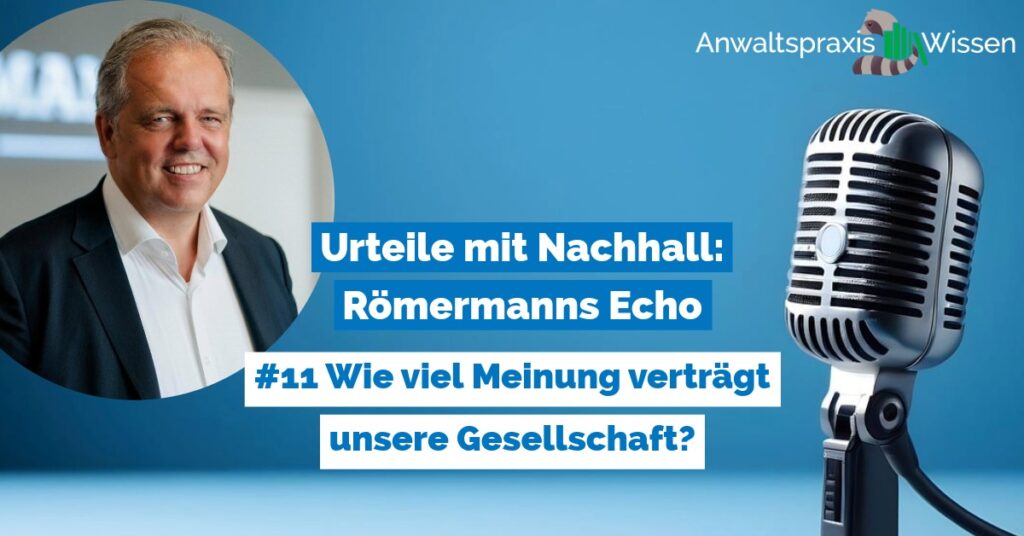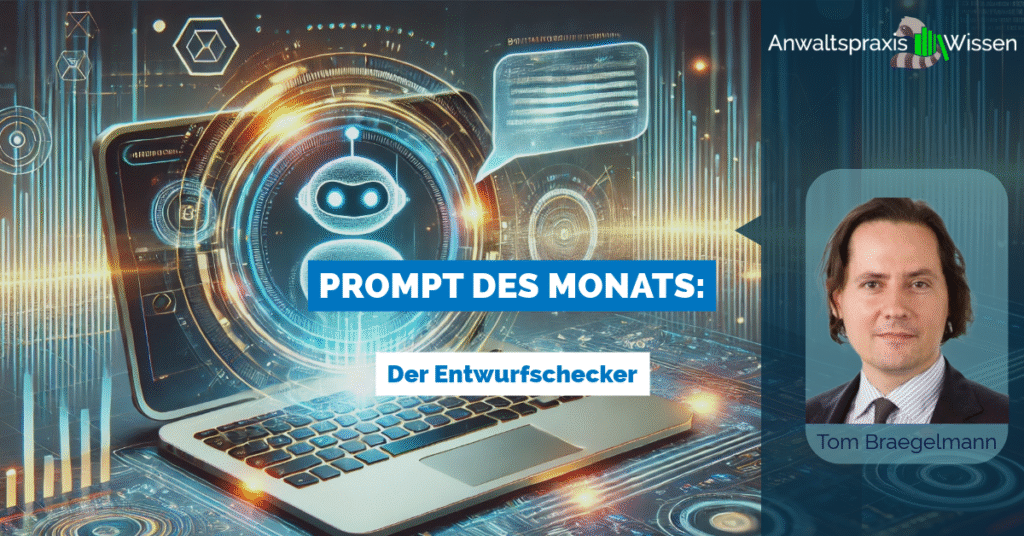In die bei der Frage, ob die Schwere der Tat die Bestellung eines Pflichtverteidigers erfordert, anzustellende Rechtsfolgenbetrachtung sind auch mittelbare schwerwiegende Nachteile, wie z.B. eine ggf. drohende Gesamtfreiheitsstrafe, einzubeziehen. Entscheidend für die Beiordnung ist ein Gesamtstrafübel, das über die nicht schematisch zu betrachtende „Jahresgrenze“ wesentlich hinausgeht. (Leitsatz des Verfassers)
LG Wuppertal,Beschl.v.18.8.2020–23 Qs 93/20
I. Sachverhalt
Der Rechtsanwalt hatte seine Beiordnung als Pflichtverteidiger wegen der Schwere der Tat (§ 140 Abs. 2 StPO) beantragt. Das AG hat die Beiordnung abgelehnt. Die dagegen gerichtete Beschwerde hatte keinen Erfolg.
II. Entscheidung
Das LG verneint einen Fall des § 140 Abs. 2 StPO. Die Anklageschrift lege dem Beschuldigten den versuchten Erwerb von 5,3 gr. Haschisch zur Last. Im Falle seiner Verurteilung habe der Beschuldigte hiernach eine dem – voraussichtlich gem. §§ 23 Abs. 2, 49 StGB gemilderten – Strafrahmen des § 29 Abs. 1 BtMG entnommene Strafe zu erwarten. Strafmildernd sei im Verurteilungsfall hierbei prognostisch zu berücksichtigen, dass die Tat eine Menge von „nur“ 5,3 gr. zum Gegenstand habe, wobei es sich bei dem Betäubungsmittel um ein Cannabisprodukt und damit um eine sog. weiche Droge handele. Strafschärfend werde zu bedenken sein, dass der Beschuldigte die angebliche Tat unter laufender Bewährung begangen hat und nicht unerheblich vorbestraft ist, wenngleich die letzte Verurteilung wegen eines Betäubungsmitteldelikts aus dem Jahr 2012 stamme. Letztlich dürfte hiernach noch mit einer Strafe im unteren – wenn auch nicht alleruntersten – Bereich des eröffneten Strafrahmens zu rechnen sein, die deutlich unter der als Richtschnur für die Annahme einer notwendigen Verteidigung in der Regel herangezogenen Straferwartung von etwa einem Jahr Freiheitsstrafe liege.
Der Beschuldigte weise zwar zutreffend darauf hin, dass in die anzustellende Rechtsfolgenbetrachtung auch mittelbare schwerwiegende Nachteile, wie etwa der hier drohende Bewährungswiderruf im Hinblick auf die Gesamtfreiheitsstrafe von einem Jahr aus einem Gesamtstrafenbeschluss, mit in die Betrachtung einzufließen haben. Ein durch diesen (möglicherweise) zu erwartenden Nachteil drohendes Gesamtstrafübel, welches über die nicht schematisch zu betrachtende „Jahresgrenze“ wesentlich hinausgehe, stehe jedoch letztlich nicht zu erwarten. Hiervon gehe offenbar auch das AG aus, welches sich in seiner Beschlussbegründung mit diesen durch die Verteidigung dargelegten Umständen freilich nicht äußerlich erkennbar auseinandergesetzt hat.
Sollten sich aus der HV für das AG jedoch weitere schulderhöhende Umstände ergeben, sodass aufgrund einer solchen veränderten Sachlage eine Verurteilung zu einer Freiheitsstrafe in Betracht zu ziehen ist, die in Zusammenschau mit dem drohenden Bewährungswiderruf die „Jahresgrenze“ wesentlich überschreitet, werde sich das AG die Frage nach dem Vorliegen der Voraussetzungen der notwendigen Verteidigung erneut – ggf. auch von Amts wegen – zu stellen haben.
III. Bedeutung für die Praxis
In Rechtsprechung und Literatur war bisher unbestritten, dass dem Beschuldigten ein Pflichtverteidiger beizuordnen ist, wenn im Verfahren eine Strafe von einem Jahr zu erwarten ist. Diese Grenze wurde auch angenommen in den Fällen, in denen eine Gesamtfreiheitsstrafe gebildet werden muss oder der Widerruf einer Bewährungsstrafe drohte (zu allemBurhoff, Handbuch für das strafrechtliche Ermittlungsverfahren, 8. Aufl. 2019, Rn 3150 m.w.N. aus der Rechtsprechung). Dabei ist die Freiheitsstrafe von einem Jahr nicht als starre Grenze angesehen worden, soweit ersichtlich ist aber bislang in der Rechtsprechung nicht vertreten worden, dass die „Jahresgrenze“ wesentlich überschritten werden müsse. Davon scheint das LG Wuppertal abweichen zu wollen. Man fragt sich: Warum? Die Antwort darauf bleibt das LG schuldig. Es stellt diese „erhöhte Jahresgrenze“ in den Raum, ohne eine Begründung dafür zu geben, warum nun nicht mehr die Einjahresgrenze ausreichen soll. Das ist abzulehnen. Dies vor allem auch deshalb, weil es doch gerade Anliegen des Gesetzgebers war, mit der Umsetzung der PKH-Richtlinie dafür Sorge zu tragen, dass Beschuldigten eher als nach früherem Recht ein Pflichtverteidiger zu bestellen ist. Dem widerspricht dieser Beschluss.
RADetlef Burhoff, RiOLG a.D., Leer/Augsburg
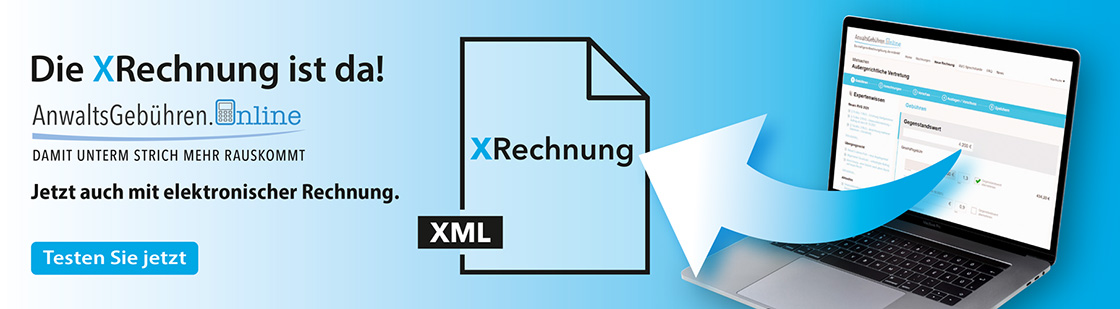

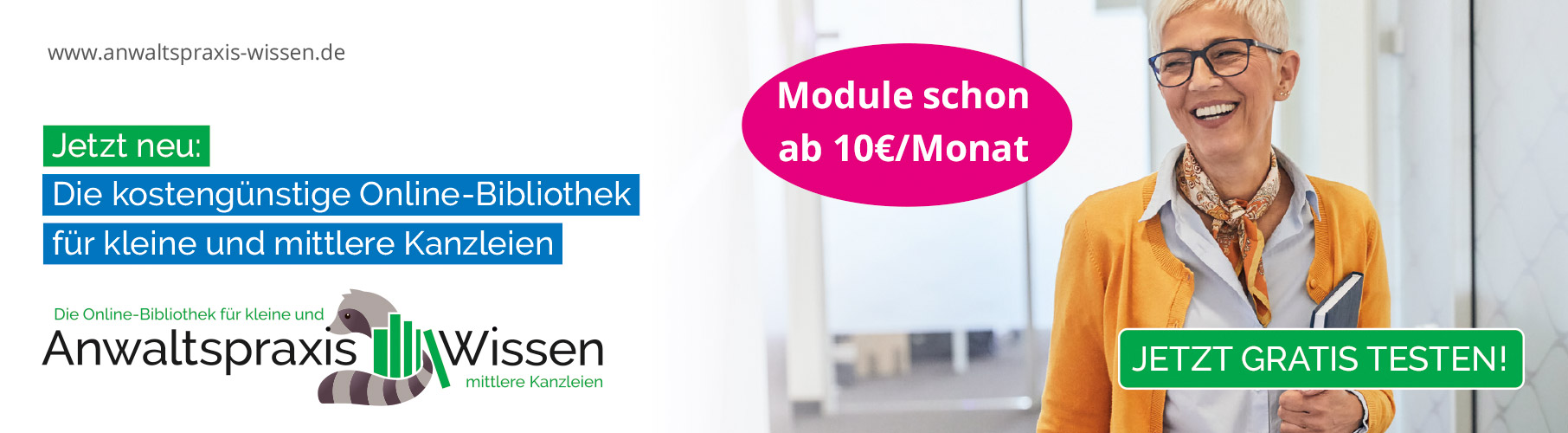

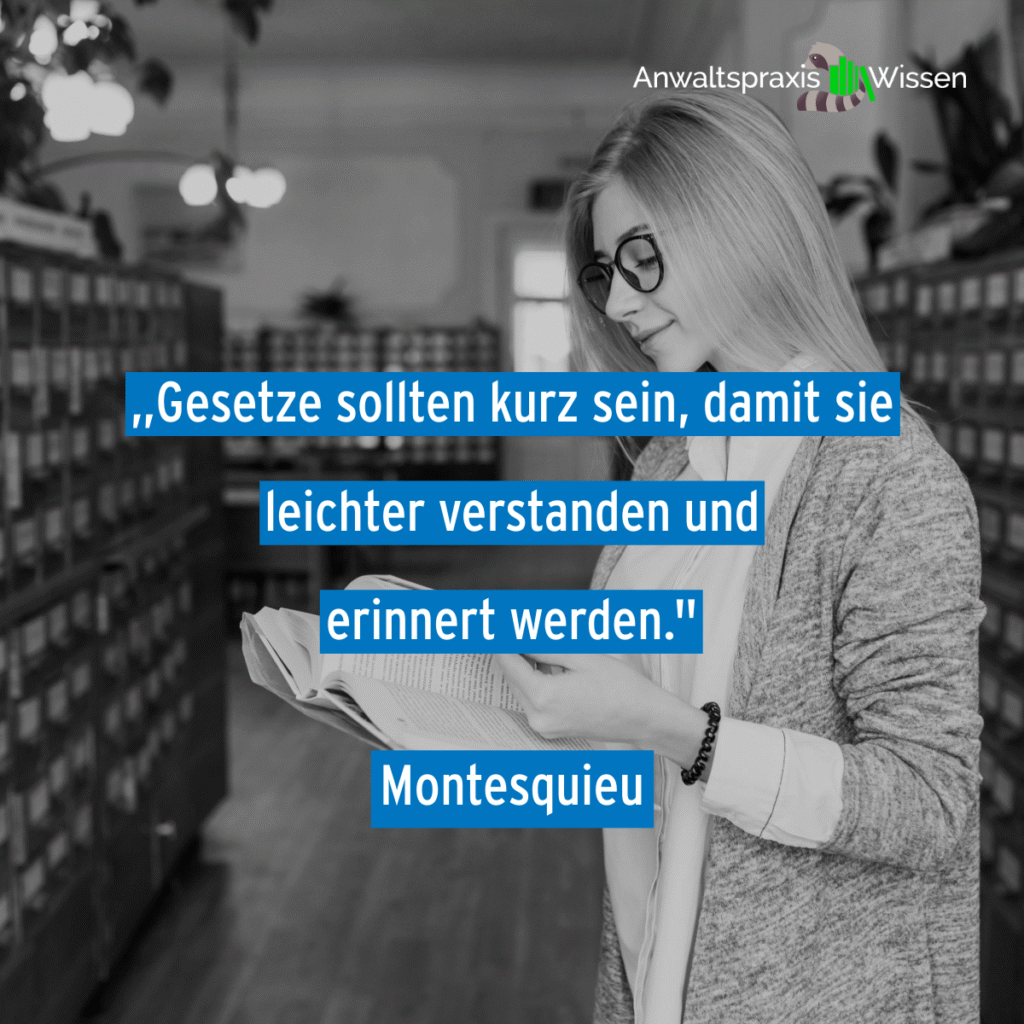
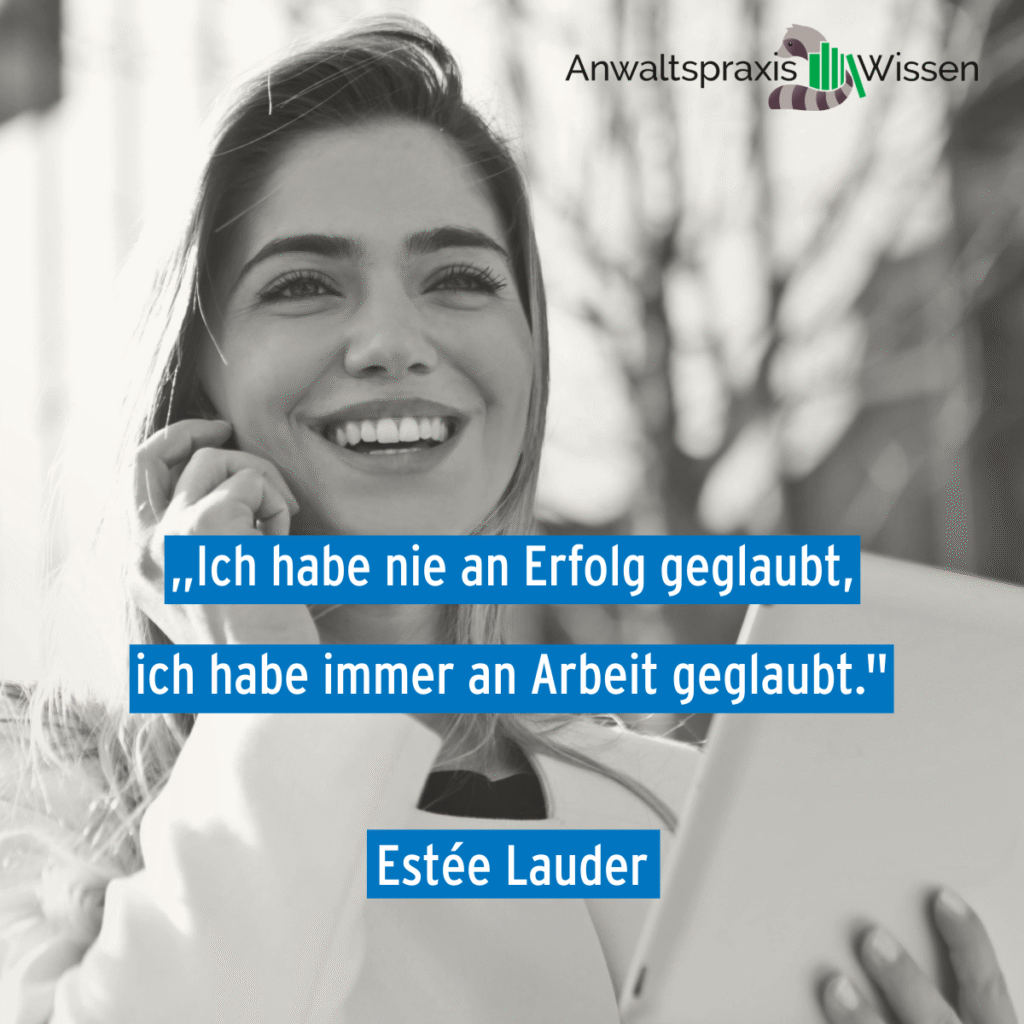

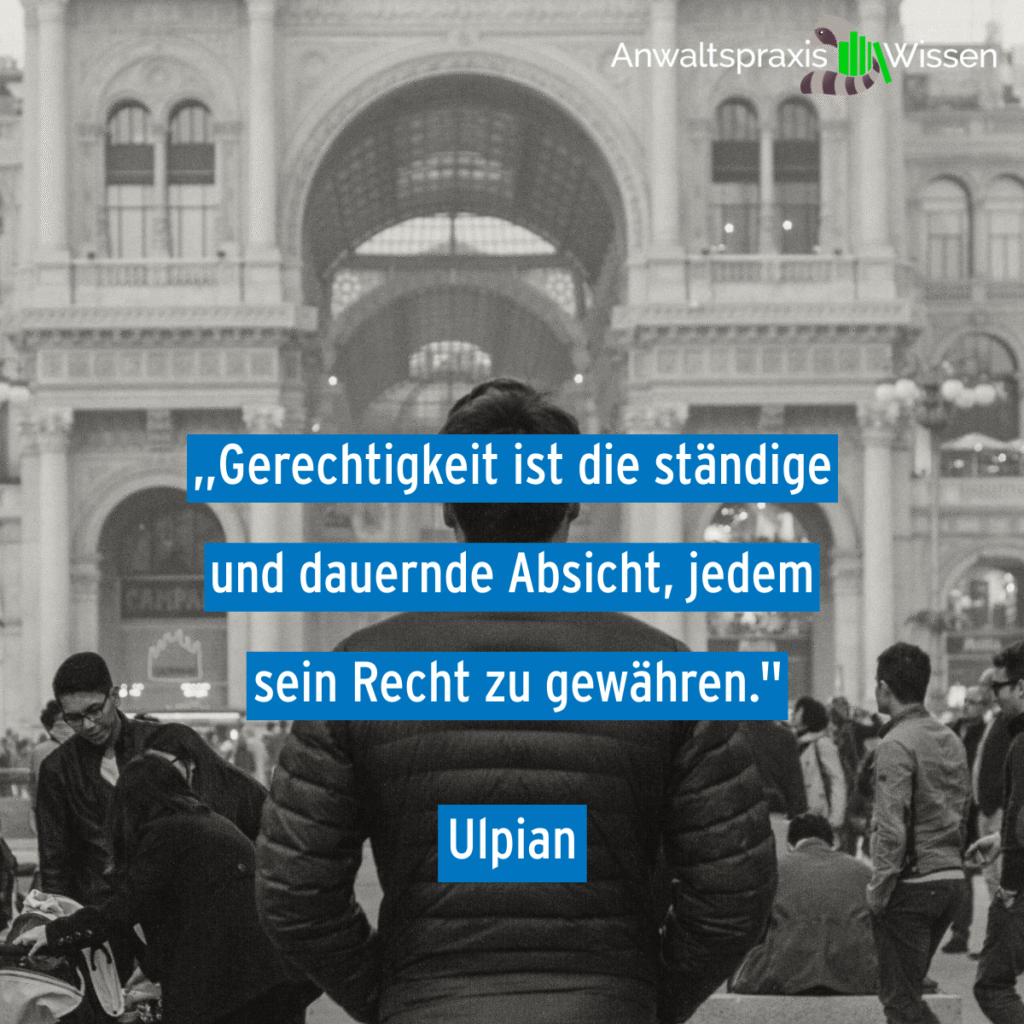

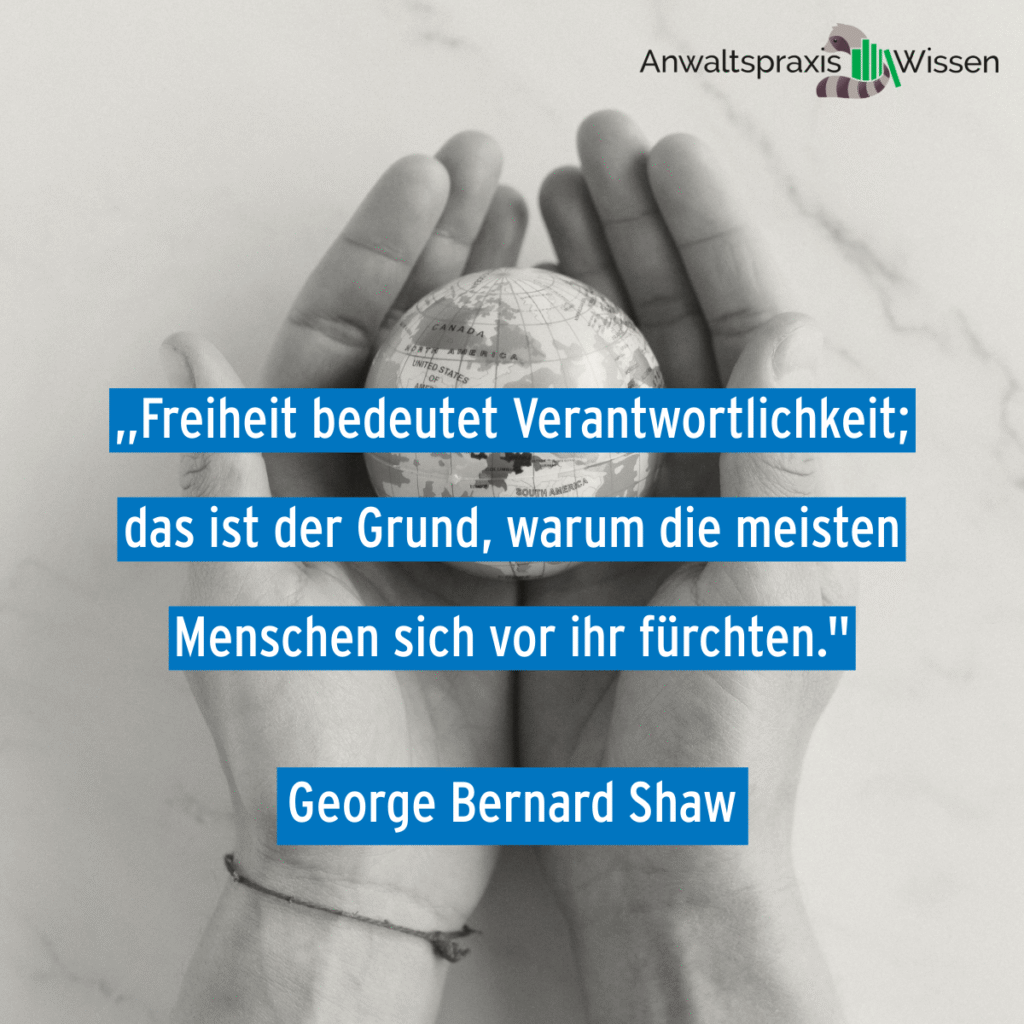

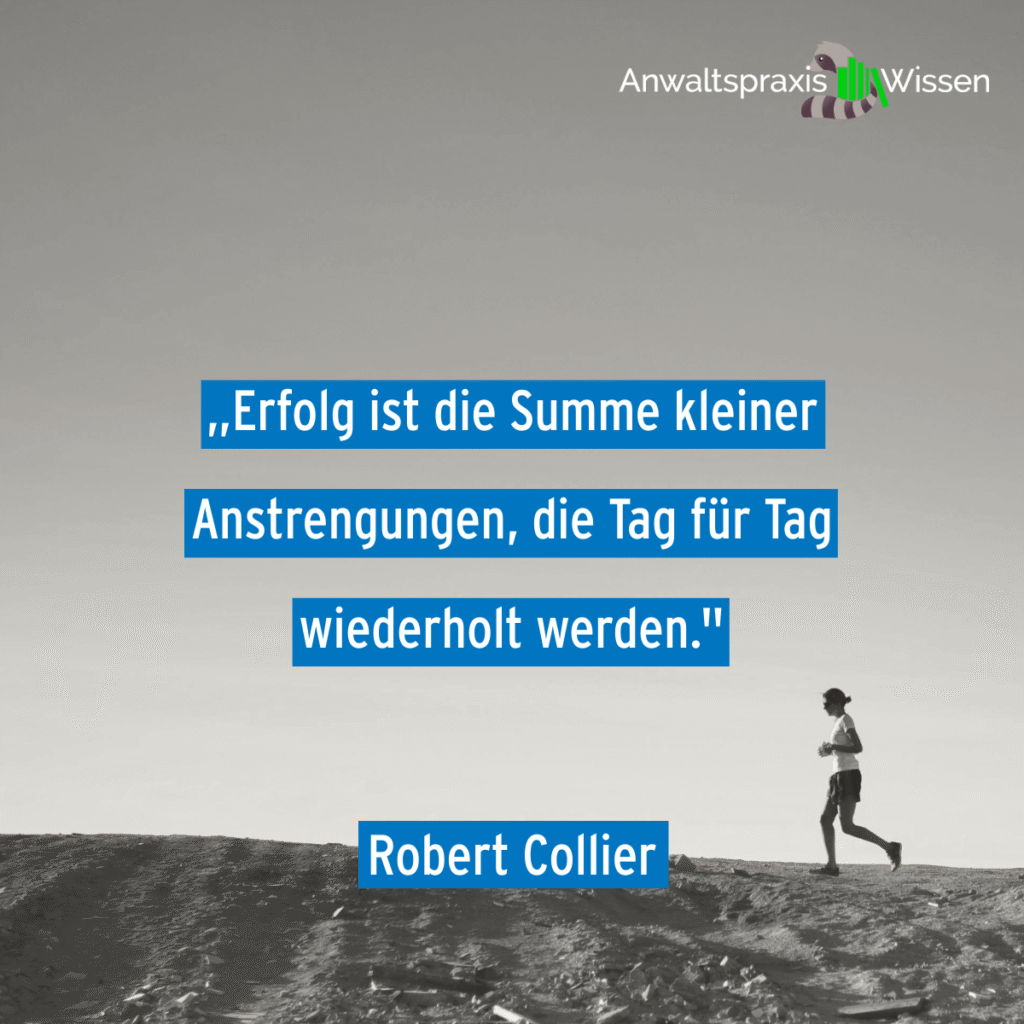

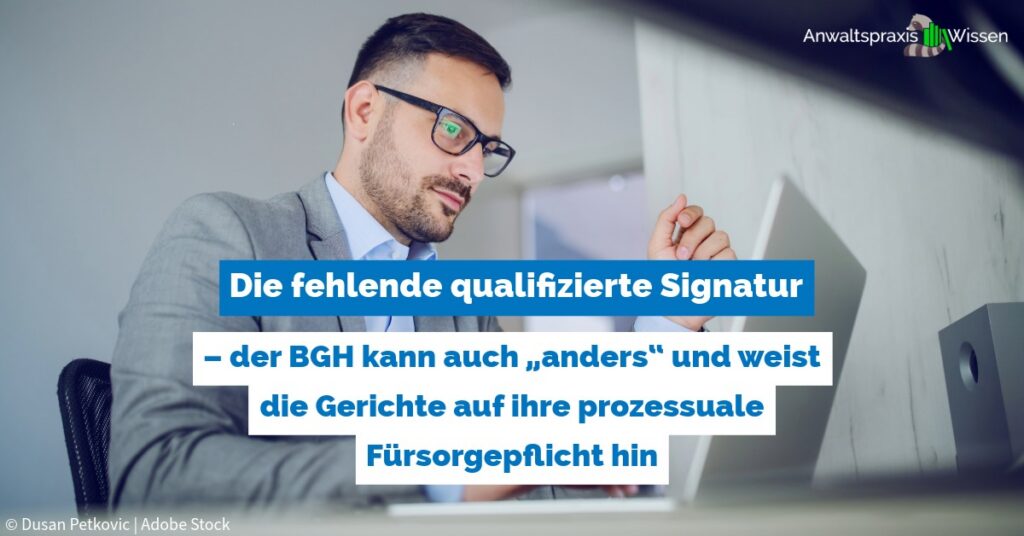

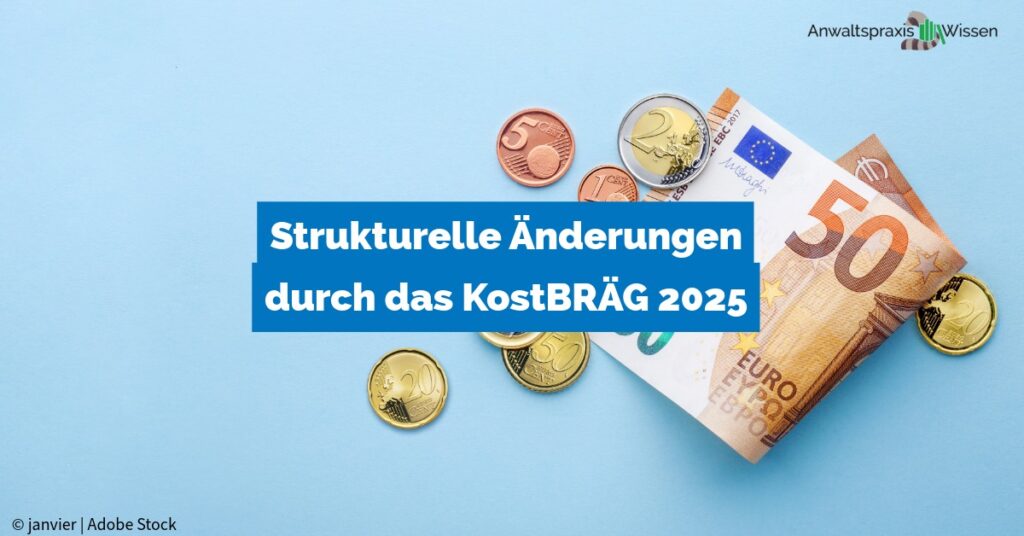

![Erbrecht im Gespräch: Kurze[s] Update: #19 Bestattungsrecht – mit Dr. Bernd Schmalenbach](https://anwaltspraxis-magazin.de/wp-content/uploads/2025/09/Erbrecht-im-Gespraech-19-1024x536.jpeg)